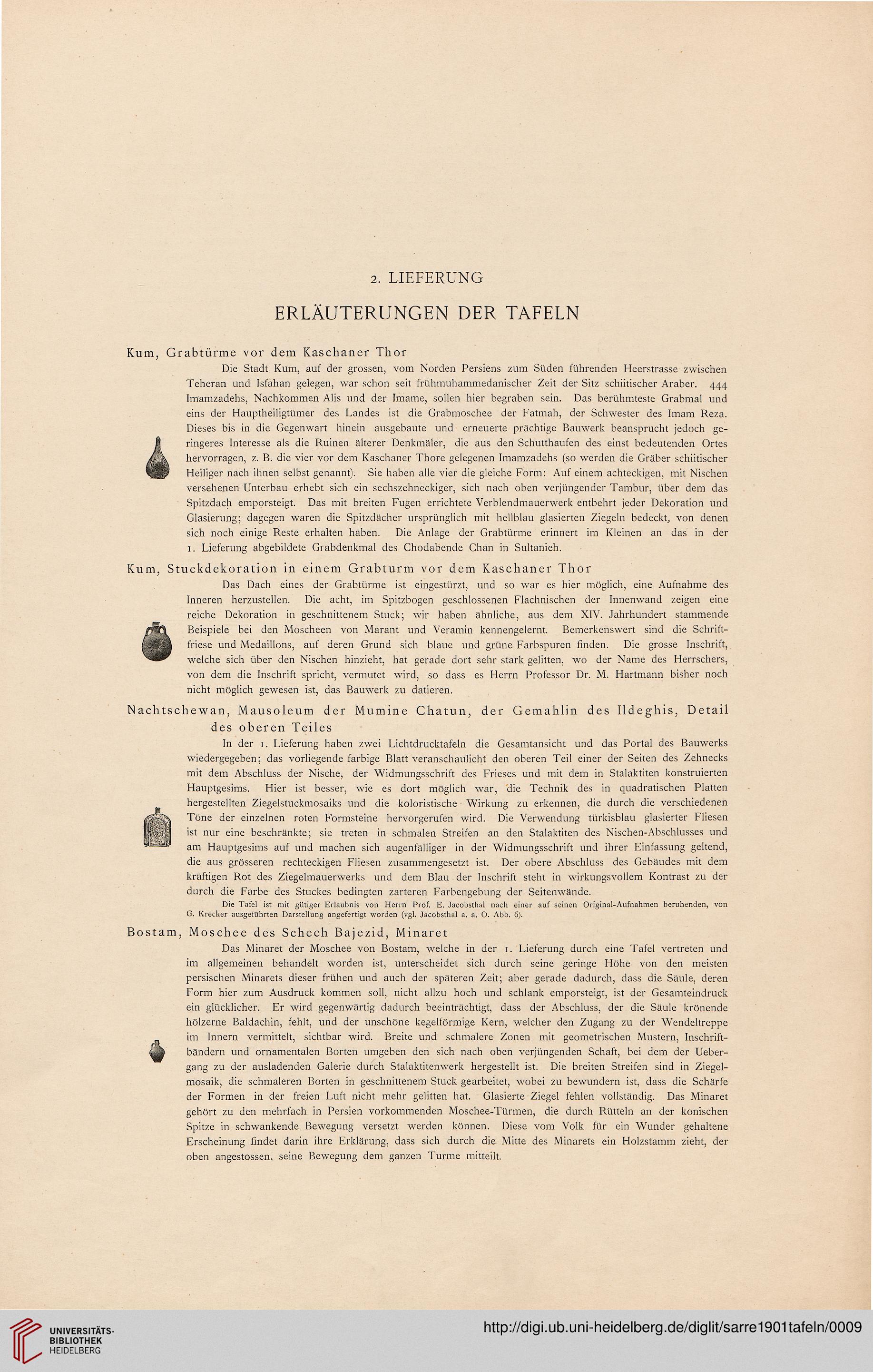2. LIEFERUNG
ERLÄUTERUNGEN DER TAFELN
Kum, Grabtürme vor dem Kaschaner Thor
Die Stadt Kum, auf der grossen, vom Norden Persiens zum Süden führenden Heerstrasse zwischen
Teheran und Isfahan gelegen, war schon seit frühmuhammedanischer Zeit der Sitz schiitischer Araber. 444
Imamzadehs, Nachkommen Alis und der Imame, sollen hier begraben sein. Das berühmteste Grabmal und
eins der Hauptheiligtümer des Landes ist die Grabmoschee der Fatmah, der Schwester des Imam Reza.
Dieses bis in die Gegenwart hinein ausgebaute und erneuerte prächtige Bauwerk beansprucht jedoch ge-
ringeres Interesse als die Ruinen älterer Denkmäler, die aus den Schutthaufen des einst bedeutenden Ortes
hervorragen, z. B. die vier vor dem Kaschaner Thore gelegenen Imamzadehs (so werden die Gräber schiitischer
Heiliger nach ihnen selbst genannt). Sie haben alle vier die gleiche Form: Auf einem achteckigen, mit Nischen
versehenen Unterbau erhebt sich ein sechszehneckiger, sich nach oben verjüngender Tambur, über dem das
Spitzdach emporsteigt. Das mit breiten Fugen errichtete Verblendmauerwerk entbehrt jeder Dekoration und
Glasierung; dagegen waren die Spitzdächer ursprünglich mit hellblau glasierten Ziegeln bedeckt, von denen
sich noch einige Reste erhalten haben.
Die Anlage der Grabtürme erinnert im Kleinen an das in der
1. Lieferung abgebildete Grabdenkmal des Chodabende Chan in Sultanieh.
Kum, Stuckdekoration in einem Grabturm vor dem Kaschaner Thor
Das Dach eines der Grabtürme ist eingestürzt, und so war es hier möglich, eine Aufnahme des
Inneren herzustellen. Die acht, im Spitzbogen geschlossenen Flachnischen der Innenwand zeigen eine
reiche Dekoration in geschnittenem Stuck; wir haben ähnliche, aus dem XIV. Jahrhundert stammende
Beispiele bei den Moscheen von Marant und Veramin kennengelernt. Bemerkenswert sind die Schrift-
friese und Medaillons, auf deren Grund sich blaue und grüne Farbspuren finden. Die grosse Inschrift,
welche sich über den Nischen hinzieht, hat gerade dort sehr stark gelitten, wo der Name des Herrschers,
von dem die Inschrift spricht, vermutet wird, so dass es Herrn Professor Dr. M. Hartmann bisher noch
nicht möglich gewesen ist, das Bauwerk zu datieren.
Nachtschewan, Mausoleum der Mumine Chatun, der Gemahlin des Ildeghis, Detail
des oberen Teiles
In der 1. Lieferung haben zwei Lichtdrucktafeln die Gesamtansicht und das Portal des Bauwerks
wiedergegeben; das vorliegende farbige Blatt veranschaulicht den oberen Teil einer der Seiten des Zehnecks
mit dem Abschluss der Nische, der Widmungsschrift des Frieses und mit dem in Stalaktiten konstruierten
Hauptgesims. Hier ist besser, wie es dort möglich war, die Technik des in quadratischen Platten
hergestellten Ziegelstuckmosaiks und die koloristische Wirkung zu erkennen, die durch die verschiedenen
Töne der einzelnen roten Formsteine hervorgerufen wird. Die Verwendung türkisblau glasierter Fliesen
ist nur eine beschränkte; sie treten in schmalen Streifen an den Stalaktiten des Nischen-Abschlusses und
am Hauptgesims auf und machen sich augenfälliger in der Widmungsschrift und ihrer Einfassung geltend,
die aus grösseren rechteckigen Fliesen zusammengesetzt ist. Der obere Abschluss des Gebäudes mit dem
kräftigen Rot des Ziegelmauerwerks und dem Blau der Inschrift steht in wirkungsvollem Kontrast zu der
durch die Farbe des Stuckes bedingten zarteren Farbengebung der Seitenwände.
Die Tafel ist mit gütiger Erlaubnis von Herrn Prof. E. Jacobsthal nach einer auf seinen Original-Aufnahmen beruhenden, von
G. Krecker ausgeführten Darstellung angefertigt worden (vgl. Jacobsthal a. a. O. Abb. 6).
Bostam, Moschee des Schech Bajezid, Minaret
Das Minaret der Moschee von Bostam, welche in der i. Lieferung durch eine Tafel vertreten und
im allgemeinen behandelt worden ist, unterscheidet sich durch seine geringe Höhe von den meisten
persischen Minarets dieser frühen und auch der späteren Zeit; aber gerade dadurch, dass die Säule, deren
Form hier zum Ausdruck kommen soll, nicht allzu hoch und schlank emporsteigt, ist der Gesamteindruck
ein glücklicher. Er wird gegenwärtig dadurch beeinträchtigt, dass der Abschluss, der die Säule krönende
hölzerne Baldachin, fehlt, und der unschöne kegelförmige Kern, welcher den Zugang zu der Wendeltreppe
im Innern vermittelt, sichtbar wird. Breite und schmalere Zonen mit geometrischen Mustern, Inschrift-
(^ bändern und ornamentalen Borten umgeben den sich nach oben verjüngenden Schaft, bei dem der Ueber-
gang zu der ausladenden Galerie durch Stalaktitenwerk hergestellt ist. Die breiten Streifen sind in Ziegel-
mosaik, die schmaleren Borten in geschnittenem Stuck gearbeitet, wobei zu bewundern ist, dass die Schärfe
der Formen in der freien Luft nicht mehr gelitten hat. Glasierte Ziegel fehlen vollständig. Das Minaret
gehört zu den mehrfach in Persien vorkommenden Moschee-Türmen, die durch Rütteln an der konischen
Spitze in schwankende Bewegung versetzt werden können. Diese vom Volk für ein Wunder gehaltene
Erscheinung findet darin ihre Erklärung, dass sich durch die Mitte des Minarets ein Holzstamm zieht, der
oben angestossen, seine Bewegung dem ganzen Turme mitteilt.
ERLÄUTERUNGEN DER TAFELN
Kum, Grabtürme vor dem Kaschaner Thor
Die Stadt Kum, auf der grossen, vom Norden Persiens zum Süden führenden Heerstrasse zwischen
Teheran und Isfahan gelegen, war schon seit frühmuhammedanischer Zeit der Sitz schiitischer Araber. 444
Imamzadehs, Nachkommen Alis und der Imame, sollen hier begraben sein. Das berühmteste Grabmal und
eins der Hauptheiligtümer des Landes ist die Grabmoschee der Fatmah, der Schwester des Imam Reza.
Dieses bis in die Gegenwart hinein ausgebaute und erneuerte prächtige Bauwerk beansprucht jedoch ge-
ringeres Interesse als die Ruinen älterer Denkmäler, die aus den Schutthaufen des einst bedeutenden Ortes
hervorragen, z. B. die vier vor dem Kaschaner Thore gelegenen Imamzadehs (so werden die Gräber schiitischer
Heiliger nach ihnen selbst genannt). Sie haben alle vier die gleiche Form: Auf einem achteckigen, mit Nischen
versehenen Unterbau erhebt sich ein sechszehneckiger, sich nach oben verjüngender Tambur, über dem das
Spitzdach emporsteigt. Das mit breiten Fugen errichtete Verblendmauerwerk entbehrt jeder Dekoration und
Glasierung; dagegen waren die Spitzdächer ursprünglich mit hellblau glasierten Ziegeln bedeckt, von denen
sich noch einige Reste erhalten haben.
Die Anlage der Grabtürme erinnert im Kleinen an das in der
1. Lieferung abgebildete Grabdenkmal des Chodabende Chan in Sultanieh.
Kum, Stuckdekoration in einem Grabturm vor dem Kaschaner Thor
Das Dach eines der Grabtürme ist eingestürzt, und so war es hier möglich, eine Aufnahme des
Inneren herzustellen. Die acht, im Spitzbogen geschlossenen Flachnischen der Innenwand zeigen eine
reiche Dekoration in geschnittenem Stuck; wir haben ähnliche, aus dem XIV. Jahrhundert stammende
Beispiele bei den Moscheen von Marant und Veramin kennengelernt. Bemerkenswert sind die Schrift-
friese und Medaillons, auf deren Grund sich blaue und grüne Farbspuren finden. Die grosse Inschrift,
welche sich über den Nischen hinzieht, hat gerade dort sehr stark gelitten, wo der Name des Herrschers,
von dem die Inschrift spricht, vermutet wird, so dass es Herrn Professor Dr. M. Hartmann bisher noch
nicht möglich gewesen ist, das Bauwerk zu datieren.
Nachtschewan, Mausoleum der Mumine Chatun, der Gemahlin des Ildeghis, Detail
des oberen Teiles
In der 1. Lieferung haben zwei Lichtdrucktafeln die Gesamtansicht und das Portal des Bauwerks
wiedergegeben; das vorliegende farbige Blatt veranschaulicht den oberen Teil einer der Seiten des Zehnecks
mit dem Abschluss der Nische, der Widmungsschrift des Frieses und mit dem in Stalaktiten konstruierten
Hauptgesims. Hier ist besser, wie es dort möglich war, die Technik des in quadratischen Platten
hergestellten Ziegelstuckmosaiks und die koloristische Wirkung zu erkennen, die durch die verschiedenen
Töne der einzelnen roten Formsteine hervorgerufen wird. Die Verwendung türkisblau glasierter Fliesen
ist nur eine beschränkte; sie treten in schmalen Streifen an den Stalaktiten des Nischen-Abschlusses und
am Hauptgesims auf und machen sich augenfälliger in der Widmungsschrift und ihrer Einfassung geltend,
die aus grösseren rechteckigen Fliesen zusammengesetzt ist. Der obere Abschluss des Gebäudes mit dem
kräftigen Rot des Ziegelmauerwerks und dem Blau der Inschrift steht in wirkungsvollem Kontrast zu der
durch die Farbe des Stuckes bedingten zarteren Farbengebung der Seitenwände.
Die Tafel ist mit gütiger Erlaubnis von Herrn Prof. E. Jacobsthal nach einer auf seinen Original-Aufnahmen beruhenden, von
G. Krecker ausgeführten Darstellung angefertigt worden (vgl. Jacobsthal a. a. O. Abb. 6).
Bostam, Moschee des Schech Bajezid, Minaret
Das Minaret der Moschee von Bostam, welche in der i. Lieferung durch eine Tafel vertreten und
im allgemeinen behandelt worden ist, unterscheidet sich durch seine geringe Höhe von den meisten
persischen Minarets dieser frühen und auch der späteren Zeit; aber gerade dadurch, dass die Säule, deren
Form hier zum Ausdruck kommen soll, nicht allzu hoch und schlank emporsteigt, ist der Gesamteindruck
ein glücklicher. Er wird gegenwärtig dadurch beeinträchtigt, dass der Abschluss, der die Säule krönende
hölzerne Baldachin, fehlt, und der unschöne kegelförmige Kern, welcher den Zugang zu der Wendeltreppe
im Innern vermittelt, sichtbar wird. Breite und schmalere Zonen mit geometrischen Mustern, Inschrift-
(^ bändern und ornamentalen Borten umgeben den sich nach oben verjüngenden Schaft, bei dem der Ueber-
gang zu der ausladenden Galerie durch Stalaktitenwerk hergestellt ist. Die breiten Streifen sind in Ziegel-
mosaik, die schmaleren Borten in geschnittenem Stuck gearbeitet, wobei zu bewundern ist, dass die Schärfe
der Formen in der freien Luft nicht mehr gelitten hat. Glasierte Ziegel fehlen vollständig. Das Minaret
gehört zu den mehrfach in Persien vorkommenden Moschee-Türmen, die durch Rütteln an der konischen
Spitze in schwankende Bewegung versetzt werden können. Diese vom Volk für ein Wunder gehaltene
Erscheinung findet darin ihre Erklärung, dass sich durch die Mitte des Minarets ein Holzstamm zieht, der
oben angestossen, seine Bewegung dem ganzen Turme mitteilt.