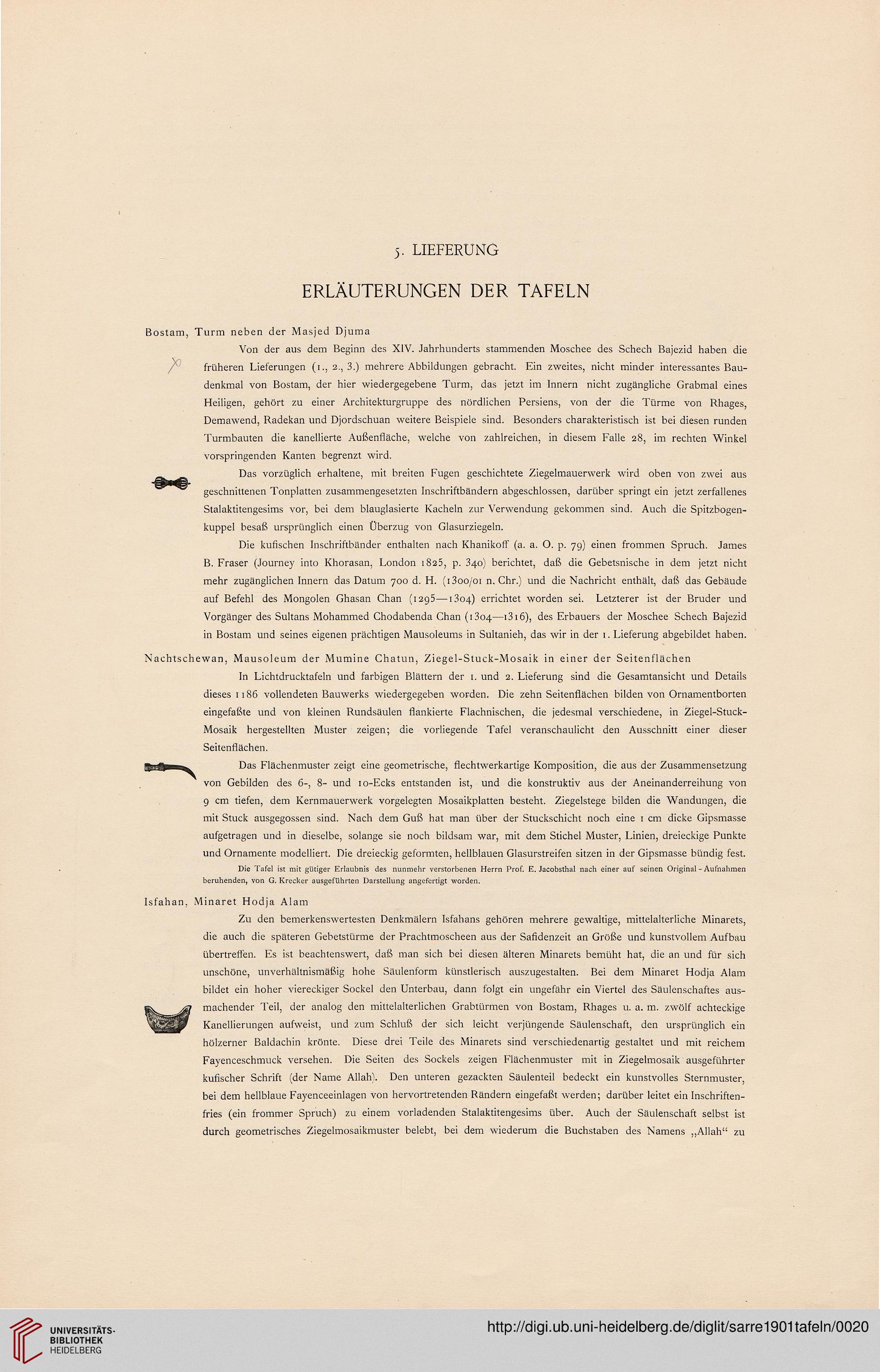y LIEFERUNG
ERLÄUTERUNGEN DER TAFELN
Bostam, Turm neben der Masjed Djuma
Von der aus dem Beginn des XIV. Jahrhunderts stammenden Moschee des Schech Bajezid haben die
früheren Lieferungen (i., 2., 3.) mehrere Abbildungen gebracht. Ein zweites, nicht minder interessantes Bau-
denkmal von Bostam, der hier wiedergegebene Turm, das jetzt im Innern nicht zugängliche Grabmal eines
Heiligen, gehört zu einer Architekturgruppe des nördlichen Persiens, von der die Türme von Rhages,
Demawend, Radekan und Djordschuan weitere Beispiele sind. Besonders charakteristisch ist bei diesen runden
Turmbauten die kanellierte Außenfläche, welche von zahlreichen, in diesem Falle 28, im rechten Winkel
vorspringenden Kanten begrenzt wird.
Das vorzüglich erhaltene, mit breiten Fugen geschichtete Ziegelmauerwerk wird oben von zwei aus
geschnittenen Tonplatten zusammengesetzten Inschriftbändern abgeschlossen, darüber springt ein jetzt zerfallenes
Stalaktitengesims vor, bei dem blauglasierte Kacheln zur Verwendung gekommen sind. Auch die Spitzbogen-
kuppel besaß ursprünglich einen Überzug von Glasurziegeln.
Die kufischen Inschriftbänder enthalten nach Khanikoff (a. a. O. p. 79) einen frommen Spruch. James
B. Fräser (Journey into Khorasan, London 1825, p. 340) berichtet, daß die Gebetsnische in dem jetzt nicht
mehr zugänglichen Innern das Datum 700 d. H. (i3oo/oi n.Chr.) und die Nachricht enthält, daß das Gebäude
auf Befehl des Mongolen Ghasan Chan (1295—1304) errichtet worden sei. Letzterer ist der Bruder und
Vorgänger des Sultans Mohammed Chodabenda Chan (1304—i3i6), des Erbauers der Moschee Schech Bajezid
in Bostam und seines eigenen prächtigen Mausoleums in Sultanieh, das wir in der 1. Lieferung abgebildet haben.
Nachtschewan, Mausoleum der Mumine Chatun, Ziegel-Stuck-Mosaik in einer der Seitenflächen
In Lichtdrucktafeln und farbigen Blättern der 1. und 2. Lieferung sind die Gesamtansicht und Details
dieses 1186 vollendeten Bauwerks wiedergegeben worden. Die zehn Seitenflächen bilden von Ornamentborten
eingefaßte und von kleinen Rundsäulen flankierte Flachnischen, die jedesmal verschiedene, in Ziegel-Stuck-
Mosaik hergestellten Muster zeigen; die vorliegende Tafel veranschaulicht den Ausschnitt einer dieser
Seitenflächen.
^^■■^^ Das Flächenmuster zeigt eine geometrische, flechtwerkartige Komposition, die aus der Zusammensetzung
von Gebilden des 6-, 8- und 10-Ecks entstanden ist, und die konstruktiv aus der Aneinanderreihung von
9 cm tiefen, dem Kernmauerwerk vorgelegten Mosaikplatten besteht. Ziegelstege bilden die Wandungen, die
mit Stuck ausgegossen sind. Nach dem Guß hat man über der Stuckschicht noch eine 1 cm dicke Gipsmasse
aufgetragen und in dieselbe, solange sie noch bildsam war, mit dem Stichel Muster, Linien, dreieckige Punkte
und Ornamente modelliert. Die dreieckig geformten, hellblauen Glasurstreifen sitzen in der Gipsmasse bündig fest.
Die Tafel ist mit gütiger Erlaubnis des nunmehr verstorbenen Herrn Prof. E. Jacobsthal nach einer auf seinen Original-Aufnahmen
beruhenden, von G. Krecker ausgeführten Darstellung angefertigt worden.
Isfahan, Minaret Hodja Alam
Zu den bemerkenswertesten Denkmälern Isfahans gehören mehrere gewaltige, mittelalterliche Minarets,
die auch die späteren Gebetstürme der Prachtmoscheen aus der Safidenzeit an Größe und kunstvollem Aufbau
übertreffen. Es ist beachtenswert, daß man sich bei diesen älteren Minarets bemüht hat, die an und für sich
unschöne, unverhältnismäßig hohe Säulenform künstlerisch auszugestalten. Bei dem Minaret Hodja Alam
bildet ein hoher viereckiger Sockel den Unterbau, dann folgt ein ungefähr ein Viertel des Säulenschaftes aus-
machender Teil, der analog den mittelalterlichen Grabtürmen von Bostam, Rhages u. a. m. zwölf achteckige
Kanellierungen aufweist, und zum Schluß der sich leicht verjüngende Säulenschaft, den ursprünglich ein
hölzerner Baldachin krönte. Diese drei Teile des Minarets sind verschiedenartig gestaltet und mit reichem
Fayenceschmuck versehen. Die Seiten des Sockels zeigen Flächenmuster mit in Ziegelmosaik ausgeführter
kufischer Schrift (der Name Allah). Den unteren gezackten Säulenteil bedeckt ein kunstvolles Sternmuster,
bei dem hellblaue Fayenceeinlagen von hervortretenden Rändern eingefaßt werden; darüber leitet ein Inschriften-
fries (ein frommer Spruch) zu einem vorladenden Stalaktitengesims über. Auch der Säulenschaft selbst ist
durch geometrisches Ziegelmosaikmuster belebt, bei dem wiederum die Buchstaben des Namens „Allah" zu
ERLÄUTERUNGEN DER TAFELN
Bostam, Turm neben der Masjed Djuma
Von der aus dem Beginn des XIV. Jahrhunderts stammenden Moschee des Schech Bajezid haben die
früheren Lieferungen (i., 2., 3.) mehrere Abbildungen gebracht. Ein zweites, nicht minder interessantes Bau-
denkmal von Bostam, der hier wiedergegebene Turm, das jetzt im Innern nicht zugängliche Grabmal eines
Heiligen, gehört zu einer Architekturgruppe des nördlichen Persiens, von der die Türme von Rhages,
Demawend, Radekan und Djordschuan weitere Beispiele sind. Besonders charakteristisch ist bei diesen runden
Turmbauten die kanellierte Außenfläche, welche von zahlreichen, in diesem Falle 28, im rechten Winkel
vorspringenden Kanten begrenzt wird.
Das vorzüglich erhaltene, mit breiten Fugen geschichtete Ziegelmauerwerk wird oben von zwei aus
geschnittenen Tonplatten zusammengesetzten Inschriftbändern abgeschlossen, darüber springt ein jetzt zerfallenes
Stalaktitengesims vor, bei dem blauglasierte Kacheln zur Verwendung gekommen sind. Auch die Spitzbogen-
kuppel besaß ursprünglich einen Überzug von Glasurziegeln.
Die kufischen Inschriftbänder enthalten nach Khanikoff (a. a. O. p. 79) einen frommen Spruch. James
B. Fräser (Journey into Khorasan, London 1825, p. 340) berichtet, daß die Gebetsnische in dem jetzt nicht
mehr zugänglichen Innern das Datum 700 d. H. (i3oo/oi n.Chr.) und die Nachricht enthält, daß das Gebäude
auf Befehl des Mongolen Ghasan Chan (1295—1304) errichtet worden sei. Letzterer ist der Bruder und
Vorgänger des Sultans Mohammed Chodabenda Chan (1304—i3i6), des Erbauers der Moschee Schech Bajezid
in Bostam und seines eigenen prächtigen Mausoleums in Sultanieh, das wir in der 1. Lieferung abgebildet haben.
Nachtschewan, Mausoleum der Mumine Chatun, Ziegel-Stuck-Mosaik in einer der Seitenflächen
In Lichtdrucktafeln und farbigen Blättern der 1. und 2. Lieferung sind die Gesamtansicht und Details
dieses 1186 vollendeten Bauwerks wiedergegeben worden. Die zehn Seitenflächen bilden von Ornamentborten
eingefaßte und von kleinen Rundsäulen flankierte Flachnischen, die jedesmal verschiedene, in Ziegel-Stuck-
Mosaik hergestellten Muster zeigen; die vorliegende Tafel veranschaulicht den Ausschnitt einer dieser
Seitenflächen.
^^■■^^ Das Flächenmuster zeigt eine geometrische, flechtwerkartige Komposition, die aus der Zusammensetzung
von Gebilden des 6-, 8- und 10-Ecks entstanden ist, und die konstruktiv aus der Aneinanderreihung von
9 cm tiefen, dem Kernmauerwerk vorgelegten Mosaikplatten besteht. Ziegelstege bilden die Wandungen, die
mit Stuck ausgegossen sind. Nach dem Guß hat man über der Stuckschicht noch eine 1 cm dicke Gipsmasse
aufgetragen und in dieselbe, solange sie noch bildsam war, mit dem Stichel Muster, Linien, dreieckige Punkte
und Ornamente modelliert. Die dreieckig geformten, hellblauen Glasurstreifen sitzen in der Gipsmasse bündig fest.
Die Tafel ist mit gütiger Erlaubnis des nunmehr verstorbenen Herrn Prof. E. Jacobsthal nach einer auf seinen Original-Aufnahmen
beruhenden, von G. Krecker ausgeführten Darstellung angefertigt worden.
Isfahan, Minaret Hodja Alam
Zu den bemerkenswertesten Denkmälern Isfahans gehören mehrere gewaltige, mittelalterliche Minarets,
die auch die späteren Gebetstürme der Prachtmoscheen aus der Safidenzeit an Größe und kunstvollem Aufbau
übertreffen. Es ist beachtenswert, daß man sich bei diesen älteren Minarets bemüht hat, die an und für sich
unschöne, unverhältnismäßig hohe Säulenform künstlerisch auszugestalten. Bei dem Minaret Hodja Alam
bildet ein hoher viereckiger Sockel den Unterbau, dann folgt ein ungefähr ein Viertel des Säulenschaftes aus-
machender Teil, der analog den mittelalterlichen Grabtürmen von Bostam, Rhages u. a. m. zwölf achteckige
Kanellierungen aufweist, und zum Schluß der sich leicht verjüngende Säulenschaft, den ursprünglich ein
hölzerner Baldachin krönte. Diese drei Teile des Minarets sind verschiedenartig gestaltet und mit reichem
Fayenceschmuck versehen. Die Seiten des Sockels zeigen Flächenmuster mit in Ziegelmosaik ausgeführter
kufischer Schrift (der Name Allah). Den unteren gezackten Säulenteil bedeckt ein kunstvolles Sternmuster,
bei dem hellblaue Fayenceeinlagen von hervortretenden Rändern eingefaßt werden; darüber leitet ein Inschriften-
fries (ein frommer Spruch) zu einem vorladenden Stalaktitengesims über. Auch der Säulenschaft selbst ist
durch geometrisches Ziegelmosaikmuster belebt, bei dem wiederum die Buchstaben des Namens „Allah" zu