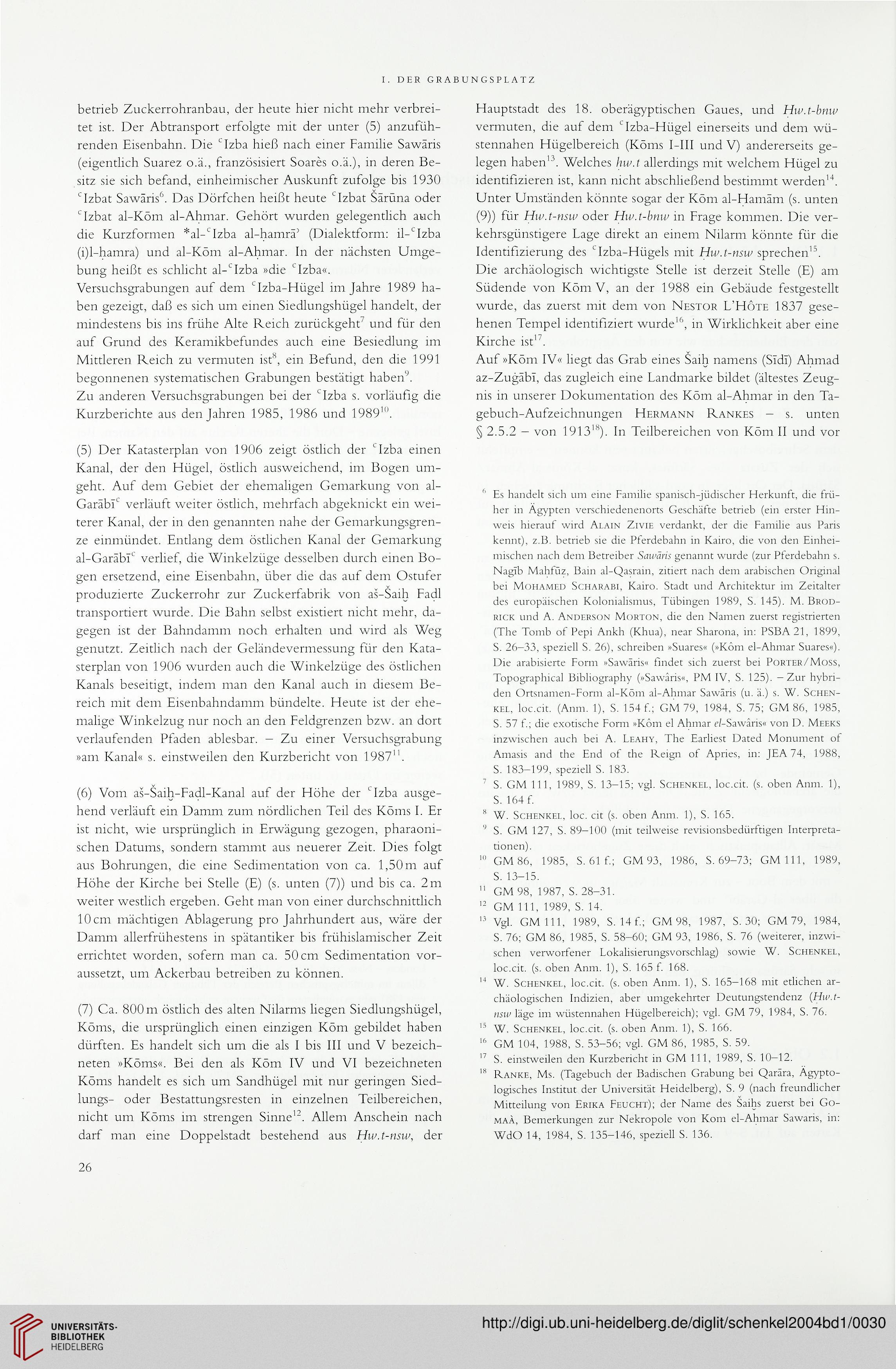i. der grabungsplatz
betrieb Zuckerrohranbau, der heute hier nicht mehr verbrei-
tet ist. Der Abtransport erfolgte mit der unter (5) anzufüh-
renden Eisenbahn. Die cIzba hieß nach einer Familie Sawäris
(eigentlich Suarez o.a., französisiert Soares o.a.), in deren Be-
sitz sie sich befand, einheimischer Auskunft zufolge bis 1930
cIzbat Sawäris6. Das Dörfchen heißt heute Hzbat Särüna oder
Izbat al-Köm al-Ahmar. Gehört wurden gelegentlich auch
die Kurzformen *al-cIzba al-hamrä3 (Dialektform: il-cIzba
(i)l-hamra) und al-Köm al-Ahmar. In der nächsten Umge-
bung heißt es schlicht al-cIzba »die cIzba«.
Versuchsgrabungen auf dem cIzba-Hügel im Jahre 1989 ha-
ben gezeigt, daß es sich um einen Siedlungshügel handelt, der
mindestens bis ins frühe Alte Reich zurückgeht' und für den
auf Grund des Keramikbefundes auch eine Besiedlung im
Mittleren Reich zu vermuten istK, ein Befund, den die 1991
begonnenen systematischen Grabungen bestätigt haben9.
Zu anderen Versuchsgrabungen bei der LIzba s. vorläufig die
Kurzberichte aus den Jahren 1985, 1986 und 19891".
(5) Der Katasterplan von 1906 zeigt östlich der LIzba einen
Kanal, der den Hügel, östlich ausweichend, im Bogen um-
geht. Auf dem Gebiet der ehemaligen Gemarkung von al-
GaräbiL verläuft weiter östlich, mehrfach abgeknickt ein wei-
terer Kanal, der in den genannten nahe der Gemarkungsgren-
ze einmündet. Entlang dem östlichen Kanal der Gemarkung
al-Garäbic verlief, die Winkelzüge desselben durch einen Bo-
gen ersetzend, eine Eisenbahn, über die das auf dem Ostufer
produzierte Zuckerrohr zur Zuckerfabrik von as-Saih Fadl
transportiert wurde. Die Bahn selbst existiert nicht mehr, da-
gegen ist der Bahndamm noch erhalten und wird als Weg
genutzt. Zeitlich nach der Geländevermessung für den Kata-
sterplan von 1906 wurden auch die Winkelzüge des östlichen
Kanals beseitigt, indem man den Kanal auch in diesem Be-
reich mit dem Eisenbahndamm bündelte. Heute ist der ehe-
malige Winkelzug nur noch an den Feldgrenzen bzw. an dort
verlaufenden Pfaden ablesbar. — Zu einer Versuchsgrabung
»am Kanal« s. einstweilen den Kurzbericht von 1987".
(6) Vom as-Saih-Fadl-Kanal auf der Höhe der LIzba ausge-
hend verläuft ein Damm zum nördlichen Teil des Köms I. Er
ist nicht, wie ursprünglich in Erwägung gezogen, pharaom-
schen Datums, sondern stammt aus neuerer Zeit. Dies folgt
aus Bohrungen, die eine Sedimentation von ca. 1,50 m auf
Höhe der Kirche bei Stelle (E) (s. unten (7)) und bis ca. 2 m
weiter westlich ergeben. Geht man von einer durchschnittlich
10 cm mächtigen Ablagerung pro Jahrhundert aus, wäre der
Damm allerfrühestens in spätantiker bis frühislamischer Zeit
errichtet worden, sofern man ca. 50 cm Sedimentation vor-
aussetzt, um Ackerbau betreiben zu können.
(7) Ca. 800 m östlich des alten Nilarms liegen Siedlungshügel,
Köms, die ursprünglich einen einzigen Köm gebildet haben
dürften. Es handelt sich um die als I bis III und V bezeich-
neten »Köms«. Bei den als Köm IV und VI bezeichneten
Köms handelt es sich um Sandhügel mit nur geringen Sied-
lungs- oder Bestattungsresten in einzelnen Teilbereichen,
nicht um Köms im strengen Sinne12. Allem Anschein nach
darf man eine Doppelstadt bestehend aus Hw.t-nsw, der
Hauptstadt des 18. oberägyptischen Gaues, und Hw.t-bnw
vermuten, die auf dem Hzba-Hügel einerseits und dem wü-
stennahen Hügelbereich (Köms I-III und V) andererseits ge-
legen haben13. Welches hw.t allerdings mit welchem Hügel zu
identifizieren ist, kann nicht abschließend bestimmt werden14.
Unter Umständen könnte sogar der Köm al-Hamäm (s. unten
(9)) für Hw.t-nsw oder Hw.t-bnw in Frage kommen. Die ver-
kehrsgünstigere Lage direkt an einem Nilarm könnte für die
Identifizierung des c Izba-Hügels mit Hw.t-nsw sprechen13.
Die archäologisch wichtigste Stelle ist derzeit Stelle (E) am
Südende von Köm V, an der 1988 ein Gebäude festgestellt
wurde, das zuerst mit dem von Nestor L'Hote 1837 gese-
henen Tempel identifiziert wurde16, in Wirklichkeit aber eine
Kirche ist17.
Auf »Köm IV« liegt das Grab eines Saih namens (Sldl) Ahmad
az-Zugäbi, das zugleich eine Landmarke bildet (ältestes Zeug-
nis in unserer Dokumentation des Köm al-Ahmar in den Ta-
gebuch-Aufzeichnungen Hermann Rankes — s. unten
§ 2.5.2 — von 1 9131 <s). In Teilbereichen von Köm II und vor
'' Es handelt sich um eine Familie spanisch-jüdischer Herkunft, die frü-
her in Ägypten verschiedenenorts Geschäfte betrieb (ein erster Hin-
weis hierauf wird Alain Zivie verdankt, der die Familie aus Paris
kennt), z.B. betrieb sie die Pferdebahn in Kairo, die von den Einhei-
mischen nach dem Betreiber Sawäris genannt wurde (zur Pferdebahn s.
NagTb Mahfüz, Bain al-Qasrain, zitiert nach dem arabischen Original
bei Mohamed Scharabi, Kairo. Stadt und Architektur im Zeitalter
des europäischen Kolonialismus, Tübingen 1989, S. 145). M. Brod-
rick und A. Anderson Morton, die den Namen zuerst registrierten
(The Tomb of Fepi Ankh (Khua), near Sharona, in: PSBA 21, 1899,
S. 26-33, speziell S. 26), schreiben »Suares« (»Köm el-Ahmar Suares«).
Die arabisierte Form »Sawäris« findet sich zuerst bei Porter/Moss,
Topographical Bibhography (»Sawäris«, PM IV, S. 125). - Zur hybri-
den Ortsnamen-Form al-Köm al-Ahmar Sawäris (u. ä.) s. W. Schen-
kel, loc.cit. (Anm. 1), S. 154 f.; GM 79, 1984, S. 75; GM 86, 1985,
S. 57 f.; die exotische Form »Köm el Ahmar e/-Sawäris« von D. Meeks
inzwischen auch bei A. Leahy, The Earhest Dated Monument of
Amasis and the End of the Reign of Apnes, in: JEA 74, 1988,
S. 183-199, speziell S. 183.
7 S. GM 111, 1989, S. 13-15; vgl. Schenkel, loc.cit. (s. oben Anm. 1),
S. 164 f.
* W. Schenkel, loc. cit (s. oben Anm. 1), S. 165.
'J S. GM 127, S. 89-100 (mit teilweise revisionsbedürftigen Interpreta-
tionen).
10 GM 86, 1985, S. 61 f.; GM 93, 1986, S. 69-73; GM 111, 1989,
S. 13-15.
11 GM 98, 1987, S. 28-31.
12 GM 111, 1989, S. 14.
13 Vgl. GM 111, 1989, S. 14 f.; GM 98, 1987, S. 30; GM 79, 1984,
S. 76; GM 86, 1985, S. 58-60; GM 93, 1986, S. 76 (weiterer, inzwi-
schen verworfener Lokalisierungsvorschlag) sowie W. Schenkel,
loc.cit. (s. oben Anm. 1), S. 165 f. 168.
14 W. Schenkel, loc.cit. (s. oben Anm. 1), S. 165-168 mit etlichen ar-
chäologischen Indizien, aber umgekehrter Deutungstendenz {Hw.t-
nsw läge im wüstennahen Hügelbereich); vgl. GM 79, 1984, S. 76.
15 W. Schenkel, loc.cit. (s. oben Anm. 1), S. 166.
16 GM 104, 1988, S. 53-56; vgl. GM 86, 1985, S. 59.
17 S. einstweilen den Kurzbericht in GM 111, 1989, S. 10-12.
18 Ranke, Ms. (Tagebuch der Badischen Grabung bei Qarära, Ägypto-
logisches Institut der Universität Heidelberg), S. 9 (nach freundlicher
Mitteilung von Erika Feucht); der Name des Saihs zuerst bei Go-
maä, Bemerkungen zur Nekropole von Koni el-Ahmar Sawans, in:
WdO 14, 1984, S. 135-146, speziell S. 136.
26
betrieb Zuckerrohranbau, der heute hier nicht mehr verbrei-
tet ist. Der Abtransport erfolgte mit der unter (5) anzufüh-
renden Eisenbahn. Die cIzba hieß nach einer Familie Sawäris
(eigentlich Suarez o.a., französisiert Soares o.a.), in deren Be-
sitz sie sich befand, einheimischer Auskunft zufolge bis 1930
cIzbat Sawäris6. Das Dörfchen heißt heute Hzbat Särüna oder
Izbat al-Köm al-Ahmar. Gehört wurden gelegentlich auch
die Kurzformen *al-cIzba al-hamrä3 (Dialektform: il-cIzba
(i)l-hamra) und al-Köm al-Ahmar. In der nächsten Umge-
bung heißt es schlicht al-cIzba »die cIzba«.
Versuchsgrabungen auf dem cIzba-Hügel im Jahre 1989 ha-
ben gezeigt, daß es sich um einen Siedlungshügel handelt, der
mindestens bis ins frühe Alte Reich zurückgeht' und für den
auf Grund des Keramikbefundes auch eine Besiedlung im
Mittleren Reich zu vermuten istK, ein Befund, den die 1991
begonnenen systematischen Grabungen bestätigt haben9.
Zu anderen Versuchsgrabungen bei der LIzba s. vorläufig die
Kurzberichte aus den Jahren 1985, 1986 und 19891".
(5) Der Katasterplan von 1906 zeigt östlich der LIzba einen
Kanal, der den Hügel, östlich ausweichend, im Bogen um-
geht. Auf dem Gebiet der ehemaligen Gemarkung von al-
GaräbiL verläuft weiter östlich, mehrfach abgeknickt ein wei-
terer Kanal, der in den genannten nahe der Gemarkungsgren-
ze einmündet. Entlang dem östlichen Kanal der Gemarkung
al-Garäbic verlief, die Winkelzüge desselben durch einen Bo-
gen ersetzend, eine Eisenbahn, über die das auf dem Ostufer
produzierte Zuckerrohr zur Zuckerfabrik von as-Saih Fadl
transportiert wurde. Die Bahn selbst existiert nicht mehr, da-
gegen ist der Bahndamm noch erhalten und wird als Weg
genutzt. Zeitlich nach der Geländevermessung für den Kata-
sterplan von 1906 wurden auch die Winkelzüge des östlichen
Kanals beseitigt, indem man den Kanal auch in diesem Be-
reich mit dem Eisenbahndamm bündelte. Heute ist der ehe-
malige Winkelzug nur noch an den Feldgrenzen bzw. an dort
verlaufenden Pfaden ablesbar. — Zu einer Versuchsgrabung
»am Kanal« s. einstweilen den Kurzbericht von 1987".
(6) Vom as-Saih-Fadl-Kanal auf der Höhe der LIzba ausge-
hend verläuft ein Damm zum nördlichen Teil des Köms I. Er
ist nicht, wie ursprünglich in Erwägung gezogen, pharaom-
schen Datums, sondern stammt aus neuerer Zeit. Dies folgt
aus Bohrungen, die eine Sedimentation von ca. 1,50 m auf
Höhe der Kirche bei Stelle (E) (s. unten (7)) und bis ca. 2 m
weiter westlich ergeben. Geht man von einer durchschnittlich
10 cm mächtigen Ablagerung pro Jahrhundert aus, wäre der
Damm allerfrühestens in spätantiker bis frühislamischer Zeit
errichtet worden, sofern man ca. 50 cm Sedimentation vor-
aussetzt, um Ackerbau betreiben zu können.
(7) Ca. 800 m östlich des alten Nilarms liegen Siedlungshügel,
Köms, die ursprünglich einen einzigen Köm gebildet haben
dürften. Es handelt sich um die als I bis III und V bezeich-
neten »Köms«. Bei den als Köm IV und VI bezeichneten
Köms handelt es sich um Sandhügel mit nur geringen Sied-
lungs- oder Bestattungsresten in einzelnen Teilbereichen,
nicht um Köms im strengen Sinne12. Allem Anschein nach
darf man eine Doppelstadt bestehend aus Hw.t-nsw, der
Hauptstadt des 18. oberägyptischen Gaues, und Hw.t-bnw
vermuten, die auf dem Hzba-Hügel einerseits und dem wü-
stennahen Hügelbereich (Köms I-III und V) andererseits ge-
legen haben13. Welches hw.t allerdings mit welchem Hügel zu
identifizieren ist, kann nicht abschließend bestimmt werden14.
Unter Umständen könnte sogar der Köm al-Hamäm (s. unten
(9)) für Hw.t-nsw oder Hw.t-bnw in Frage kommen. Die ver-
kehrsgünstigere Lage direkt an einem Nilarm könnte für die
Identifizierung des c Izba-Hügels mit Hw.t-nsw sprechen13.
Die archäologisch wichtigste Stelle ist derzeit Stelle (E) am
Südende von Köm V, an der 1988 ein Gebäude festgestellt
wurde, das zuerst mit dem von Nestor L'Hote 1837 gese-
henen Tempel identifiziert wurde16, in Wirklichkeit aber eine
Kirche ist17.
Auf »Köm IV« liegt das Grab eines Saih namens (Sldl) Ahmad
az-Zugäbi, das zugleich eine Landmarke bildet (ältestes Zeug-
nis in unserer Dokumentation des Köm al-Ahmar in den Ta-
gebuch-Aufzeichnungen Hermann Rankes — s. unten
§ 2.5.2 — von 1 9131 <s). In Teilbereichen von Köm II und vor
'' Es handelt sich um eine Familie spanisch-jüdischer Herkunft, die frü-
her in Ägypten verschiedenenorts Geschäfte betrieb (ein erster Hin-
weis hierauf wird Alain Zivie verdankt, der die Familie aus Paris
kennt), z.B. betrieb sie die Pferdebahn in Kairo, die von den Einhei-
mischen nach dem Betreiber Sawäris genannt wurde (zur Pferdebahn s.
NagTb Mahfüz, Bain al-Qasrain, zitiert nach dem arabischen Original
bei Mohamed Scharabi, Kairo. Stadt und Architektur im Zeitalter
des europäischen Kolonialismus, Tübingen 1989, S. 145). M. Brod-
rick und A. Anderson Morton, die den Namen zuerst registrierten
(The Tomb of Fepi Ankh (Khua), near Sharona, in: PSBA 21, 1899,
S. 26-33, speziell S. 26), schreiben »Suares« (»Köm el-Ahmar Suares«).
Die arabisierte Form »Sawäris« findet sich zuerst bei Porter/Moss,
Topographical Bibhography (»Sawäris«, PM IV, S. 125). - Zur hybri-
den Ortsnamen-Form al-Köm al-Ahmar Sawäris (u. ä.) s. W. Schen-
kel, loc.cit. (Anm. 1), S. 154 f.; GM 79, 1984, S. 75; GM 86, 1985,
S. 57 f.; die exotische Form »Köm el Ahmar e/-Sawäris« von D. Meeks
inzwischen auch bei A. Leahy, The Earhest Dated Monument of
Amasis and the End of the Reign of Apnes, in: JEA 74, 1988,
S. 183-199, speziell S. 183.
7 S. GM 111, 1989, S. 13-15; vgl. Schenkel, loc.cit. (s. oben Anm. 1),
S. 164 f.
* W. Schenkel, loc. cit (s. oben Anm. 1), S. 165.
'J S. GM 127, S. 89-100 (mit teilweise revisionsbedürftigen Interpreta-
tionen).
10 GM 86, 1985, S. 61 f.; GM 93, 1986, S. 69-73; GM 111, 1989,
S. 13-15.
11 GM 98, 1987, S. 28-31.
12 GM 111, 1989, S. 14.
13 Vgl. GM 111, 1989, S. 14 f.; GM 98, 1987, S. 30; GM 79, 1984,
S. 76; GM 86, 1985, S. 58-60; GM 93, 1986, S. 76 (weiterer, inzwi-
schen verworfener Lokalisierungsvorschlag) sowie W. Schenkel,
loc.cit. (s. oben Anm. 1), S. 165 f. 168.
14 W. Schenkel, loc.cit. (s. oben Anm. 1), S. 165-168 mit etlichen ar-
chäologischen Indizien, aber umgekehrter Deutungstendenz {Hw.t-
nsw läge im wüstennahen Hügelbereich); vgl. GM 79, 1984, S. 76.
15 W. Schenkel, loc.cit. (s. oben Anm. 1), S. 166.
16 GM 104, 1988, S. 53-56; vgl. GM 86, 1985, S. 59.
17 S. einstweilen den Kurzbericht in GM 111, 1989, S. 10-12.
18 Ranke, Ms. (Tagebuch der Badischen Grabung bei Qarära, Ägypto-
logisches Institut der Universität Heidelberg), S. 9 (nach freundlicher
Mitteilung von Erika Feucht); der Name des Saihs zuerst bei Go-
maä, Bemerkungen zur Nekropole von Koni el-Ahmar Sawans, in:
WdO 14, 1984, S. 135-146, speziell S. 136.
26