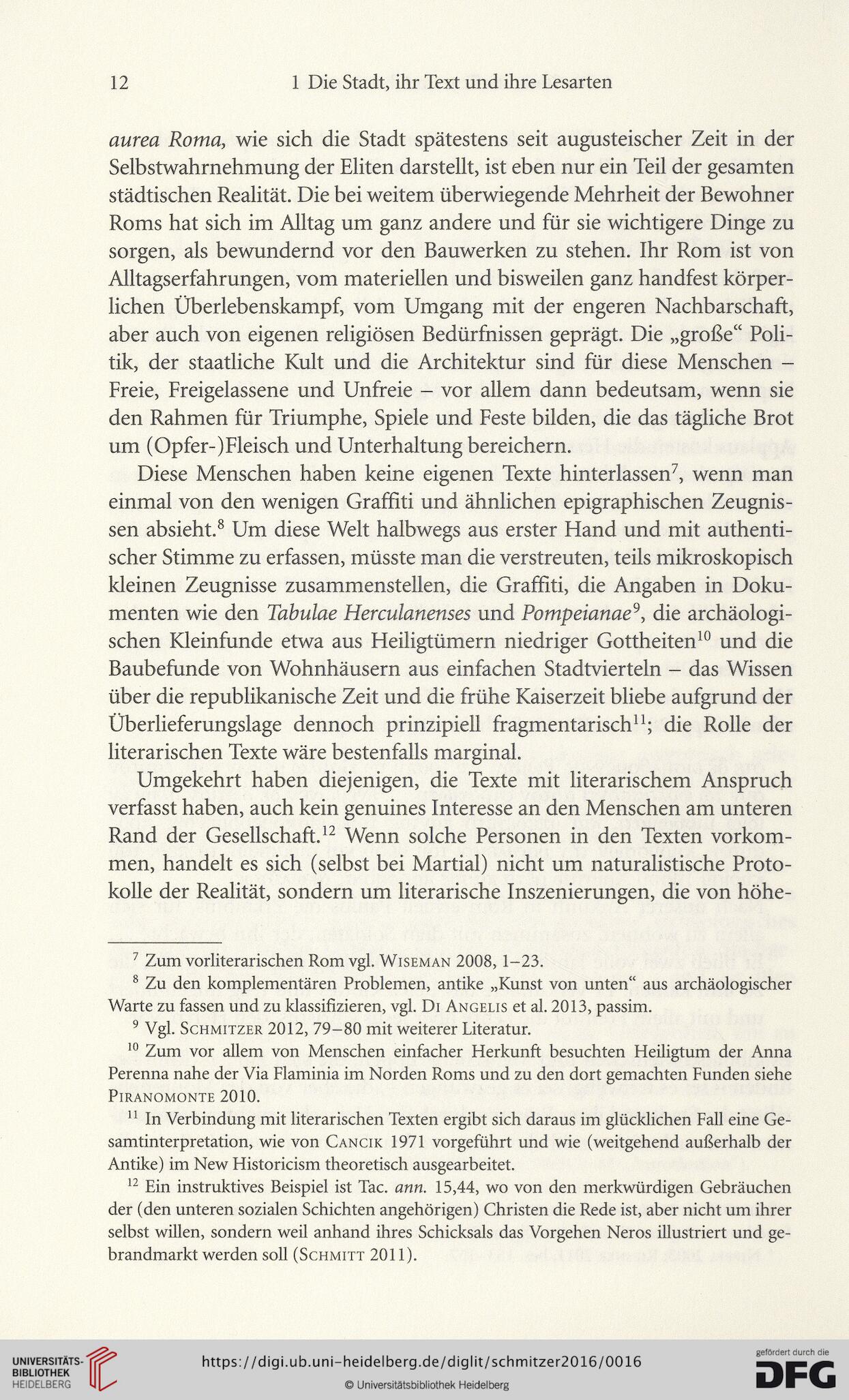12
1 Die Stadt, ihr Text und ihre Lesarten
aurea Roma, wie sich die Stadt spätestens seit augusteischer Zeit in der
Selbstwahrnehmung der Eliten darstellt, ist eben nur ein Teil der gesamten
städtischen Realität. Die bei weitem überwiegende Mehrheit der Bewohner
Roms hat sich im Alltag um ganz andere und für sie wichtigere Dinge zu
sorgen, als bewundernd vor den Bauwerken zu stehen. Ihr Rom ist von
Alltagserfahrungen, vom materiellen und bisweilen ganz handfest körper-
lichen Überlebenskampf, vom Umgang mit der engeren Nachbarschaft,
aber auch von eigenen religiösen Bedürfnissen geprägt. Die „große" Poli-
tik, der staatliche Kult und die Architektur sind für diese Menschen -
Freie, Freigelassene und Unfreie - vor allem dann bedeutsam, wenn sie
den Rahmen für Triumphe, Spiele und Feste bilden, die das tägliche Brot
um (Opfer-)Fleisch und Unterhaltung bereichern.
Diese Menschen haben keine eigenen Texte hinterlassen7, wenn man
einmal von den wenigen Graffiti und ähnlichen epigraphischen Zeugnis-
sen absieht.8 Um diese Welt halbwegs aus erster Hand und mit authenti-
scher Stimme zu erfassen, müsste man die verstreuten, teils mikroskopisch
kleinen Zeugnisse zusammenstellen, die Graffiti, die Angaben in Doku-
menten wie den Tabulae Herculanenses und Pompeianae9, die archäologi-
schen Kleinfunde etwa aus Heiligtümern niedriger Gottheiten10 und die
Baubefunde von Wohnhäusern aus einfachen Stadtvierteln - das Wissen
über die republikanische Zeit und die frühe Kaiserzeit bliebe aufgrund der
Überlieferungslage dennoch prinzipiell fragmentarisch11; die Rolle der
literarischen Texte wäre bestenfalls marginal.
Umgekehrt haben diejenigen, die Texte mit literarischem Anspruch
verfasst haben, auch kein genuines Interesse an den Menschen am unteren
Rand der Gesellschaft.12 Wenn solche Personen in den Texten vorkom-
men, handelt es sich (selbst bei Martial) nicht um naturalistische Proto-
kolle der Realität, sondern um literarische Inszenierungen, die von höhe-
7 Zum vorliterarischen Rom vgl. Wiseman 2008, 1-23.
8 Zu den komplementären Problemen, antike „Kunst von unten" aus archäologischer
Warte zu fassen und zu klassifizieren, vgl. Di Angelis et al. 2013, passim.
9 Vgl. Schmitzer 2012, 79-80 mit weiterer Literatur.
10 Zum vor allem von Menschen einfacher Herkunft besuchten Heiligtum der Anna
Perenna nahe der Via Flaminia im Norden Roms und zu den dort gemachten Funden siehe
PiRANOMONTE 2010.
11 In Verbindung mit literarischen Texten ergibt sich daraus im glücklichen Fall eine Ge-
samtinterpretation, wie von Cancik 1971 vorgeführt und wie (weitgehend außerhalb der
Antike) im New Historicism theoretisch ausgearbeitet.
12 Ein instruktives Beispiel ist Tac. ann. 15,44, wo von den merkwürdigen Gebräuchen
der (den unteren sozialen Schichten angehörigen) Christen die Rede ist, aber nicht um ihrer
selbst willen, sondern weil anhand ihres Schicksals das Vorgehen Neros illustriert und ge-
brandmarkt werden soll (Schmitt 2011).
1 Die Stadt, ihr Text und ihre Lesarten
aurea Roma, wie sich die Stadt spätestens seit augusteischer Zeit in der
Selbstwahrnehmung der Eliten darstellt, ist eben nur ein Teil der gesamten
städtischen Realität. Die bei weitem überwiegende Mehrheit der Bewohner
Roms hat sich im Alltag um ganz andere und für sie wichtigere Dinge zu
sorgen, als bewundernd vor den Bauwerken zu stehen. Ihr Rom ist von
Alltagserfahrungen, vom materiellen und bisweilen ganz handfest körper-
lichen Überlebenskampf, vom Umgang mit der engeren Nachbarschaft,
aber auch von eigenen religiösen Bedürfnissen geprägt. Die „große" Poli-
tik, der staatliche Kult und die Architektur sind für diese Menschen -
Freie, Freigelassene und Unfreie - vor allem dann bedeutsam, wenn sie
den Rahmen für Triumphe, Spiele und Feste bilden, die das tägliche Brot
um (Opfer-)Fleisch und Unterhaltung bereichern.
Diese Menschen haben keine eigenen Texte hinterlassen7, wenn man
einmal von den wenigen Graffiti und ähnlichen epigraphischen Zeugnis-
sen absieht.8 Um diese Welt halbwegs aus erster Hand und mit authenti-
scher Stimme zu erfassen, müsste man die verstreuten, teils mikroskopisch
kleinen Zeugnisse zusammenstellen, die Graffiti, die Angaben in Doku-
menten wie den Tabulae Herculanenses und Pompeianae9, die archäologi-
schen Kleinfunde etwa aus Heiligtümern niedriger Gottheiten10 und die
Baubefunde von Wohnhäusern aus einfachen Stadtvierteln - das Wissen
über die republikanische Zeit und die frühe Kaiserzeit bliebe aufgrund der
Überlieferungslage dennoch prinzipiell fragmentarisch11; die Rolle der
literarischen Texte wäre bestenfalls marginal.
Umgekehrt haben diejenigen, die Texte mit literarischem Anspruch
verfasst haben, auch kein genuines Interesse an den Menschen am unteren
Rand der Gesellschaft.12 Wenn solche Personen in den Texten vorkom-
men, handelt es sich (selbst bei Martial) nicht um naturalistische Proto-
kolle der Realität, sondern um literarische Inszenierungen, die von höhe-
7 Zum vorliterarischen Rom vgl. Wiseman 2008, 1-23.
8 Zu den komplementären Problemen, antike „Kunst von unten" aus archäologischer
Warte zu fassen und zu klassifizieren, vgl. Di Angelis et al. 2013, passim.
9 Vgl. Schmitzer 2012, 79-80 mit weiterer Literatur.
10 Zum vor allem von Menschen einfacher Herkunft besuchten Heiligtum der Anna
Perenna nahe der Via Flaminia im Norden Roms und zu den dort gemachten Funden siehe
PiRANOMONTE 2010.
11 In Verbindung mit literarischen Texten ergibt sich daraus im glücklichen Fall eine Ge-
samtinterpretation, wie von Cancik 1971 vorgeführt und wie (weitgehend außerhalb der
Antike) im New Historicism theoretisch ausgearbeitet.
12 Ein instruktives Beispiel ist Tac. ann. 15,44, wo von den merkwürdigen Gebräuchen
der (den unteren sozialen Schichten angehörigen) Christen die Rede ist, aber nicht um ihrer
selbst willen, sondern weil anhand ihres Schicksals das Vorgehen Neros illustriert und ge-
brandmarkt werden soll (Schmitt 2011).