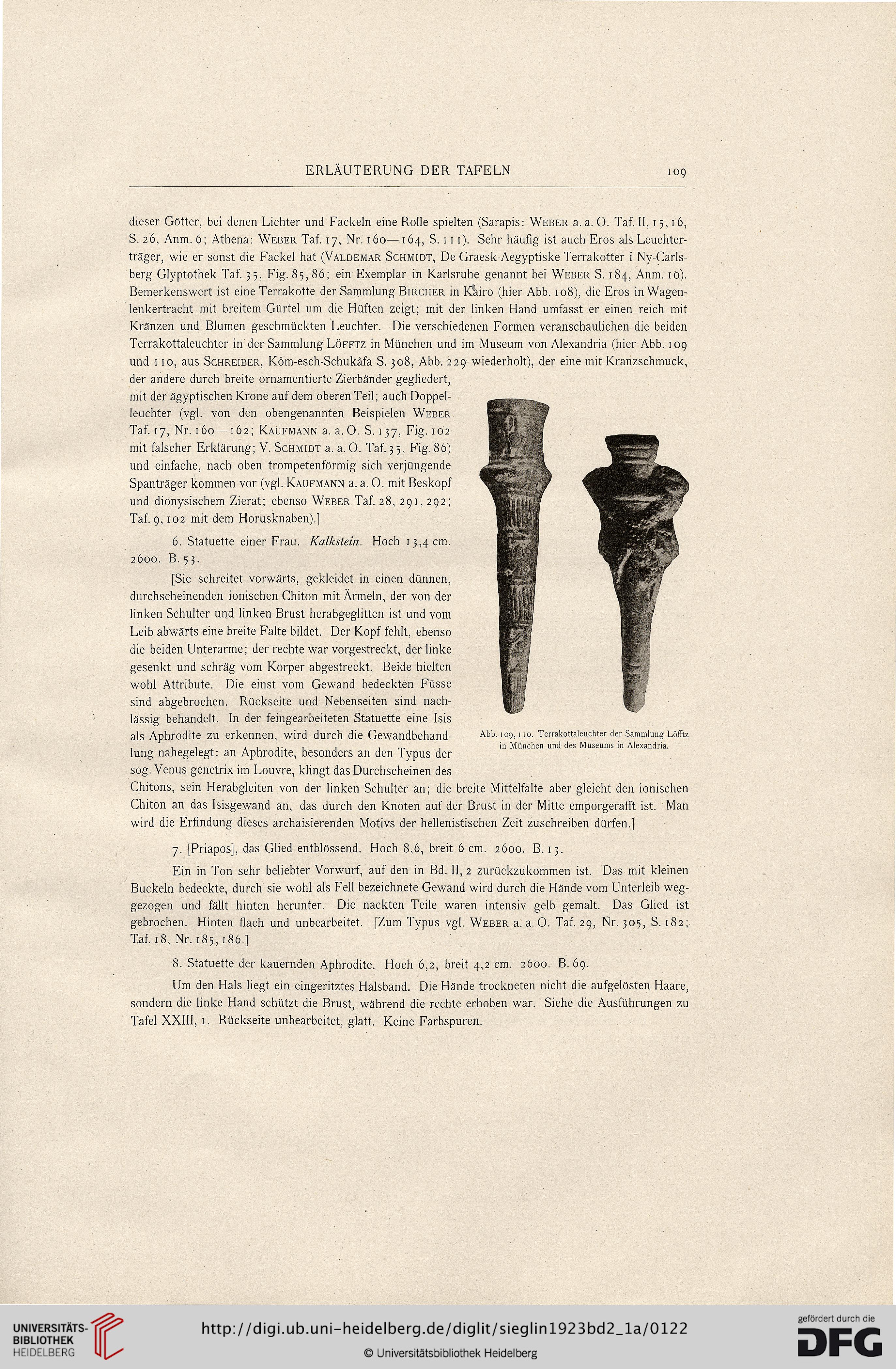ERLÄUTERUNG DER TAFELN
109
dieser Götter, bei denen Lichter und Fackeln eine Rolle spielten (Sarapis: Weber a. a. O. Taf. II, 15,16,
S. 26, Anm. 6; Athena: Weber Taf. 17, Nr. 160—164, S. 111). Sehr häufig ist auch Eros als Leuchter-
träger, wie er sonst die Fackel hat (Valdemar Schmidt, De Graesk-Aegyptiske Terrakotter i Ny-Carls-
berg Glyptothek Taf. 35, Fig. 85,86; ein Exemplar in Karlsruhe genannt bei Weber S. 184, Anm. 10).
Bemerkenswert ist eine Terrakotte der Sammlung Bircher in Kltiro (hier Abb. 108), die Eros in Wagen-
lenkertracht mit breitem Gürtel um die Hüften zeigt; mit der linken Hand umfasst er einen reich mit
Kränzen und Blumen geschmückten Leuchter. Die verschiedenen Formen veranschaulichen die beiden
Terrakottaleuchter in der Sammlung Löfftz in München und im Museum von Alexandria (hier Abb. 109
und 110, aus Schreiber, Köm-esch-Schukäfa S. 308, Abb. 229 wiederholt), der eine mit Kranzschmuck,
der andere durch breite ornamentierte Zierbänder gegliedert,
mit der ägyptischen Krone auf dem oberen Teil; auch Doppel-
leuchter (vgl. von den obengenannten Beispielen Weber
Taf. 17, Nr. 160—162; Kaufmann a. a. 0. S. 137, Fig. 102
mit falscher Erklärung; V. Schmidt a. a. 0. Taf. 35, Fig. 86)
und einfache, nach oben trompetenförmig sich verjüngende
Spanträger kommen vor (vgl. Kaufmann a. a. 0. mit Beskopf
und dionysischem Zierat; ebenso Weber Taf. 28, 291, 292;
Taf. 9,102 mit dem Horusknaben).]
6. Statuette einer Frau. Kalkstein. Hoch 13,4 cm.
2600. B.53.
[Sie schreitet vorwärts, gekleidet in einen dünnen,
durchscheinenden ionischen Chiton mit Ärmeln, der von der
linken Schulter und linken Brust herabgeglitten ist und vom
Leib abwärts eine breite Falte bildet. Der Kopf fehlt, ebenso
die beiden Unterarme; der rechte war vorgestreckt, der linke
gesenkt und schräg vom Körper abgestreckt. Beide hielten
wohl Attribute. Die einst vom Gewand bedeckten Füsse
sind abgebrochen. Rückseite und Nebenseiten sind nach-
lässig behandelt. In der feingearbeiteten Statuette eine Isis
als Aphrodite zu erkennen, wird durch die Gewandbehand-
lung nahegelegt: an Aphrodite, besonders an den Typus der
sog. Venus genetrix im Louvre, klingt das Durchscheinen des
Chitons, sein Herabgleiten von der linken Schulter an; die breite Mittelfalte aber gleicht den ionischen
Chiton an das Isisgewand an, das durch den Knoten auf der Brust in der Mitte emporgerafft ist. Man
wird die Erfindung dieses archaisierenden Motivs der hellenistischen Zeit zuschreiben dürfen.]
Abb. 109, 110. Terrakottaleuchter der Sammlung Löfftz
in München und des Museums in Alexandria.
7. [Priapos], das Glied entblössend. Hoch 8,6, breit 6 cm. 2600. B. 13.
Ein in Ton sehr beliebter Vorwurf, auf den in Bd. II, 2 zurückzukommen ist. Das mit kleinen
Buckeln bedeckte, durch sie wohl als Fell bezeichnete Gewand wird durch die Hände vom Unterleib weg-
gezogen und fällt hinten herunter. Die nackten Teile waren intensiv gelb gemalt. Das Glied ist
gebrochen. Hinten flach und unbearbeitet. [Zum Typus vgl. Weber a. a. O. Taf. 29, Nr. 305, S. 182;
Taf. 18, Nr. 185, 186.]
8. Statuette der kauernden Aphrodite. Hoch 6,2, breit 4,2 cm. 2600. B. 69.
Um den Hals liegt ein eingeritztes Halsband. Die Hände trockneten nicht die aufgelösten Haare,
sondern die linke Hand schützt die Brust, während die rechte erhoben war. Siehe die Ausführungen zu
Tafel XXIII, 1. Rückseite unbearbeitet, glatt. Keine Farbspuren.
109
dieser Götter, bei denen Lichter und Fackeln eine Rolle spielten (Sarapis: Weber a. a. O. Taf. II, 15,16,
S. 26, Anm. 6; Athena: Weber Taf. 17, Nr. 160—164, S. 111). Sehr häufig ist auch Eros als Leuchter-
träger, wie er sonst die Fackel hat (Valdemar Schmidt, De Graesk-Aegyptiske Terrakotter i Ny-Carls-
berg Glyptothek Taf. 35, Fig. 85,86; ein Exemplar in Karlsruhe genannt bei Weber S. 184, Anm. 10).
Bemerkenswert ist eine Terrakotte der Sammlung Bircher in Kltiro (hier Abb. 108), die Eros in Wagen-
lenkertracht mit breitem Gürtel um die Hüften zeigt; mit der linken Hand umfasst er einen reich mit
Kränzen und Blumen geschmückten Leuchter. Die verschiedenen Formen veranschaulichen die beiden
Terrakottaleuchter in der Sammlung Löfftz in München und im Museum von Alexandria (hier Abb. 109
und 110, aus Schreiber, Köm-esch-Schukäfa S. 308, Abb. 229 wiederholt), der eine mit Kranzschmuck,
der andere durch breite ornamentierte Zierbänder gegliedert,
mit der ägyptischen Krone auf dem oberen Teil; auch Doppel-
leuchter (vgl. von den obengenannten Beispielen Weber
Taf. 17, Nr. 160—162; Kaufmann a. a. 0. S. 137, Fig. 102
mit falscher Erklärung; V. Schmidt a. a. 0. Taf. 35, Fig. 86)
und einfache, nach oben trompetenförmig sich verjüngende
Spanträger kommen vor (vgl. Kaufmann a. a. 0. mit Beskopf
und dionysischem Zierat; ebenso Weber Taf. 28, 291, 292;
Taf. 9,102 mit dem Horusknaben).]
6. Statuette einer Frau. Kalkstein. Hoch 13,4 cm.
2600. B.53.
[Sie schreitet vorwärts, gekleidet in einen dünnen,
durchscheinenden ionischen Chiton mit Ärmeln, der von der
linken Schulter und linken Brust herabgeglitten ist und vom
Leib abwärts eine breite Falte bildet. Der Kopf fehlt, ebenso
die beiden Unterarme; der rechte war vorgestreckt, der linke
gesenkt und schräg vom Körper abgestreckt. Beide hielten
wohl Attribute. Die einst vom Gewand bedeckten Füsse
sind abgebrochen. Rückseite und Nebenseiten sind nach-
lässig behandelt. In der feingearbeiteten Statuette eine Isis
als Aphrodite zu erkennen, wird durch die Gewandbehand-
lung nahegelegt: an Aphrodite, besonders an den Typus der
sog. Venus genetrix im Louvre, klingt das Durchscheinen des
Chitons, sein Herabgleiten von der linken Schulter an; die breite Mittelfalte aber gleicht den ionischen
Chiton an das Isisgewand an, das durch den Knoten auf der Brust in der Mitte emporgerafft ist. Man
wird die Erfindung dieses archaisierenden Motivs der hellenistischen Zeit zuschreiben dürfen.]
Abb. 109, 110. Terrakottaleuchter der Sammlung Löfftz
in München und des Museums in Alexandria.
7. [Priapos], das Glied entblössend. Hoch 8,6, breit 6 cm. 2600. B. 13.
Ein in Ton sehr beliebter Vorwurf, auf den in Bd. II, 2 zurückzukommen ist. Das mit kleinen
Buckeln bedeckte, durch sie wohl als Fell bezeichnete Gewand wird durch die Hände vom Unterleib weg-
gezogen und fällt hinten herunter. Die nackten Teile waren intensiv gelb gemalt. Das Glied ist
gebrochen. Hinten flach und unbearbeitet. [Zum Typus vgl. Weber a. a. O. Taf. 29, Nr. 305, S. 182;
Taf. 18, Nr. 185, 186.]
8. Statuette der kauernden Aphrodite. Hoch 6,2, breit 4,2 cm. 2600. B. 69.
Um den Hals liegt ein eingeritztes Halsband. Die Hände trockneten nicht die aufgelösten Haare,
sondern die linke Hand schützt die Brust, während die rechte erhoben war. Siehe die Ausführungen zu
Tafel XXIII, 1. Rückseite unbearbeitet, glatt. Keine Farbspuren.