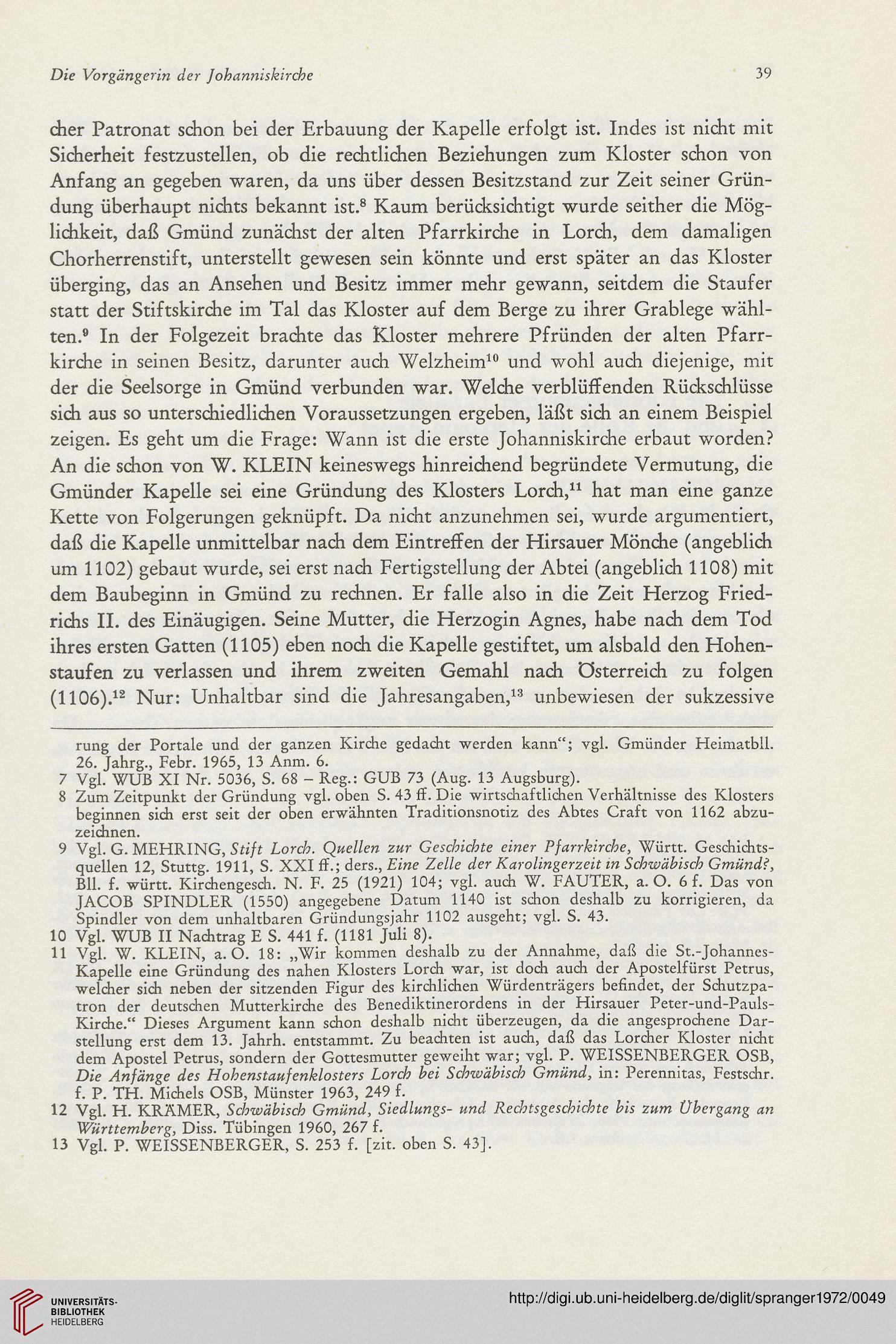Die Vorgängerin der Johanniskirche
39
eher Patronat schon bei der Erbauung der Kapelle erfolgt ist. Indes ist nicht mit
Sicherheit festzustellen, ob die rechtlichen Beziehungen zum Kloster schon von
Anfang an gegeben waren, da uns über dessen Besitzstand zur Zeit seiner Grün-
dung überhaupt nichts bekannt ist.* * 7 8 Kaum berücksichtigt wurde seither die Mög-
lichkeit, daß Gmünd zunächst der alten Pfarrkirche in Lorch, dem damaligen
Chorherrenstift, unterstellt gewesen sein könnte und erst später an das Kloster
überging, das an Ansehen und Besitz immer mehr gewann, seitdem die Staufer
statt der Stiftskirche im Tal das Kloster auf dem Berge zu ihrer Grablege wähl-
ten.9 In der Folgezeit brachte das Kloster mehrere Pfründen der alten Pfarr-
kirche in seinen Besitz, darunter auch Welzheim10 und wohl auch diejenige, mit
der die Seelsorge in Gmünd verbunden war. Welche verblüffenden Rückschlüsse
sich aus so unterschiedlichen Voraussetzungen ergeben, läßt sich an einem Beispiel
zeigen. Es geht um die Frage: Wann ist die erste Johanniskirche erbaut worden?
An die schon von W. KLEIN keineswegs hinreichend begründete Vermutung, die
Gmünder Kapelle sei eine Gründung des Klosters Lorch,11 hat man eine ganze
Kette von Folgerungen geknüpft. Da nicht anzunehmen sei, wurde argumentiert,
daß die Kapelle unmittelbar nach dem Eintreffen der Hirsauer Mönche (angeblich
um 1102) gebaut wurde, sei erst nach Fertigstellung der Abtei (angeblich 1108) mit
dem Baubeginn in Gmünd zu rechnen. Er falle also in die Zeit Herzog Fried-
richs II. des Einäugigen. Seine Mutter, die Herzogin Agnes, habe nach dem Tod
ihres ersten Gatten (1105) eben noch die Kapelle gestiftet, um alsbald den Hohen-
staufen zu verlassen und ihrem zweiten Gemahl nach Österreich zu folgen
(1106).12 Nur: Unhaltbar sind die Jahresangaben,13 unbewiesen der sukzessive
rung der Portale und der ganzen Kirche gedacht werden kann“; vgl. Gmünder Heimatbll.
26. Jahrg., Febr. 1965, 13 Anm. 6.
7 Vgl. WUB XI Nr. 5036, S. 68 - Reg.: GUB 73 (Aug. 13 Augsburg).
8 Zum Zeitpunkt der Gründung vgl. oben S. 43 ff. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Klosters
beginnen sich erst seit der oben erwähnten Traditionsnotiz des Abtes Craft von 1162 abzu-
zeichnen.
9 Vgl. G. MEHRING, Stift Lorch. Quellen zur Geschichte einer Pfarrkirche, Württ. Geschichts-
quellen 12, Stuttg. 1911, S. XXI ff.; ders., Eine Zelle der Karolingerzeit in Schwäbisch Gmünd?,
Bll. f. württ. Kirchengesch. N. F. 25 (1921) 104; vgl. auch W. FAUTER, a. O. 6 f. Das von
JACOB SPINDLER (1550) angegebene Datum 1140 ist schon deshalb zu korrigieren, da
Spindler von dem unhaltbaren Gründungsjahr 1102 ausgeht; vgl. S. 43.
10 Vgl. WUB II Nachtrag E S. 441 f. (1181 Juli 8).
11 Vgl. W. KLEIN, a. O. 18: „Wir kommen deshalb zu der Annahme, daß die St.-Johannes-
Kapelle eine Gründung des nahen Klosters Lorch war, ist doch auch der Apostelfürst Petrus,
welcher sich neben der sitzenden Figur des kirchlichen Würdenträgers befindet, der Schutzpa-
tron der deutschen Mutterkirche des Benediktinerordens in der Hirsauer Peter-und-Pauls-
Kirche.“ Dieses Argument kann schon deshalb nicht überzeugen, da die angesprochene Dar-
stellung erst dem 13. Jahrh. entstammt. Zu beachten ist auch, daß das Lorcher Kloster nicht
dem Apostel Petrus, sondern der Gottesmutter geweiht war; vgl. P. WEISSENBERGER OSB,
Die Anfänge des Hohenstaufenklosters Lorch bei Schwäbisch Gmünd, in: Perennitas, Festschr.
f. P. TH. Michels OSB, Münster 1963, 249 f.
12 Vgl. H. KRÄMER, Schwäbisch Gmünd, Siedlungs- und Rechtsgeschichte bis zum Übergang an
Württemberg, Diss. Tübingen 1960, 267 f.
13 Vgl. P. WEISSENBERGER, S. 253 f. [zit. oben S. 43],
39
eher Patronat schon bei der Erbauung der Kapelle erfolgt ist. Indes ist nicht mit
Sicherheit festzustellen, ob die rechtlichen Beziehungen zum Kloster schon von
Anfang an gegeben waren, da uns über dessen Besitzstand zur Zeit seiner Grün-
dung überhaupt nichts bekannt ist.* * 7 8 Kaum berücksichtigt wurde seither die Mög-
lichkeit, daß Gmünd zunächst der alten Pfarrkirche in Lorch, dem damaligen
Chorherrenstift, unterstellt gewesen sein könnte und erst später an das Kloster
überging, das an Ansehen und Besitz immer mehr gewann, seitdem die Staufer
statt der Stiftskirche im Tal das Kloster auf dem Berge zu ihrer Grablege wähl-
ten.9 In der Folgezeit brachte das Kloster mehrere Pfründen der alten Pfarr-
kirche in seinen Besitz, darunter auch Welzheim10 und wohl auch diejenige, mit
der die Seelsorge in Gmünd verbunden war. Welche verblüffenden Rückschlüsse
sich aus so unterschiedlichen Voraussetzungen ergeben, läßt sich an einem Beispiel
zeigen. Es geht um die Frage: Wann ist die erste Johanniskirche erbaut worden?
An die schon von W. KLEIN keineswegs hinreichend begründete Vermutung, die
Gmünder Kapelle sei eine Gründung des Klosters Lorch,11 hat man eine ganze
Kette von Folgerungen geknüpft. Da nicht anzunehmen sei, wurde argumentiert,
daß die Kapelle unmittelbar nach dem Eintreffen der Hirsauer Mönche (angeblich
um 1102) gebaut wurde, sei erst nach Fertigstellung der Abtei (angeblich 1108) mit
dem Baubeginn in Gmünd zu rechnen. Er falle also in die Zeit Herzog Fried-
richs II. des Einäugigen. Seine Mutter, die Herzogin Agnes, habe nach dem Tod
ihres ersten Gatten (1105) eben noch die Kapelle gestiftet, um alsbald den Hohen-
staufen zu verlassen und ihrem zweiten Gemahl nach Österreich zu folgen
(1106).12 Nur: Unhaltbar sind die Jahresangaben,13 unbewiesen der sukzessive
rung der Portale und der ganzen Kirche gedacht werden kann“; vgl. Gmünder Heimatbll.
26. Jahrg., Febr. 1965, 13 Anm. 6.
7 Vgl. WUB XI Nr. 5036, S. 68 - Reg.: GUB 73 (Aug. 13 Augsburg).
8 Zum Zeitpunkt der Gründung vgl. oben S. 43 ff. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Klosters
beginnen sich erst seit der oben erwähnten Traditionsnotiz des Abtes Craft von 1162 abzu-
zeichnen.
9 Vgl. G. MEHRING, Stift Lorch. Quellen zur Geschichte einer Pfarrkirche, Württ. Geschichts-
quellen 12, Stuttg. 1911, S. XXI ff.; ders., Eine Zelle der Karolingerzeit in Schwäbisch Gmünd?,
Bll. f. württ. Kirchengesch. N. F. 25 (1921) 104; vgl. auch W. FAUTER, a. O. 6 f. Das von
JACOB SPINDLER (1550) angegebene Datum 1140 ist schon deshalb zu korrigieren, da
Spindler von dem unhaltbaren Gründungsjahr 1102 ausgeht; vgl. S. 43.
10 Vgl. WUB II Nachtrag E S. 441 f. (1181 Juli 8).
11 Vgl. W. KLEIN, a. O. 18: „Wir kommen deshalb zu der Annahme, daß die St.-Johannes-
Kapelle eine Gründung des nahen Klosters Lorch war, ist doch auch der Apostelfürst Petrus,
welcher sich neben der sitzenden Figur des kirchlichen Würdenträgers befindet, der Schutzpa-
tron der deutschen Mutterkirche des Benediktinerordens in der Hirsauer Peter-und-Pauls-
Kirche.“ Dieses Argument kann schon deshalb nicht überzeugen, da die angesprochene Dar-
stellung erst dem 13. Jahrh. entstammt. Zu beachten ist auch, daß das Lorcher Kloster nicht
dem Apostel Petrus, sondern der Gottesmutter geweiht war; vgl. P. WEISSENBERGER OSB,
Die Anfänge des Hohenstaufenklosters Lorch bei Schwäbisch Gmünd, in: Perennitas, Festschr.
f. P. TH. Michels OSB, Münster 1963, 249 f.
12 Vgl. H. KRÄMER, Schwäbisch Gmünd, Siedlungs- und Rechtsgeschichte bis zum Übergang an
Württemberg, Diss. Tübingen 1960, 267 f.
13 Vgl. P. WEISSENBERGER, S. 253 f. [zit. oben S. 43],