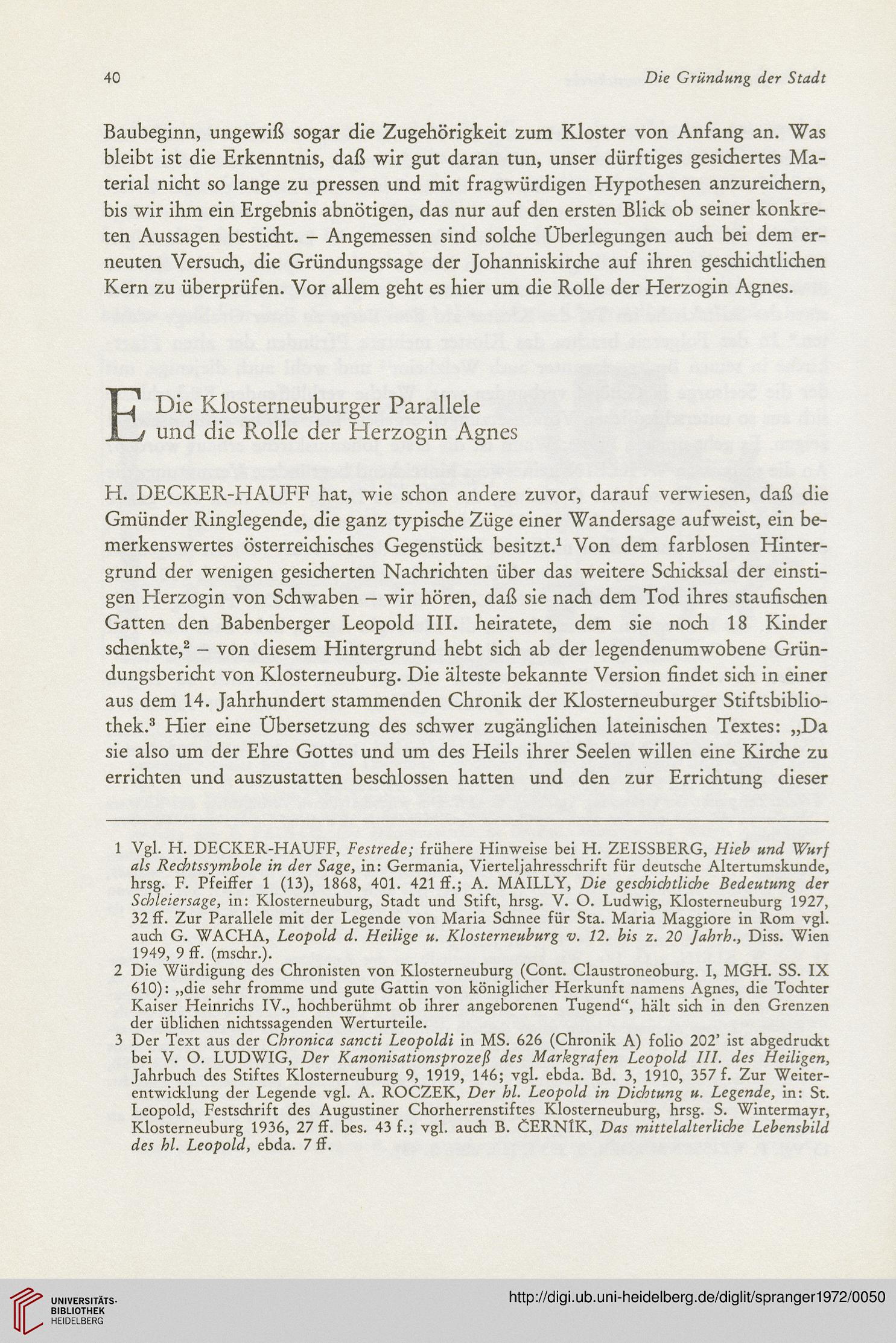40
Die Gründung der Stadt
Baubeginn, ungewiß sogar die Zugehörigkeit zum Kloster von Anfang an. Was
bleibt ist die Erkenntnis, daß wir gut daran tun, unser dürftiges gesichertes Ma-
terial nicht so lange zu pressen und mit fragwürdigen Hypothesen anzureichern,
bis wir ihm ein Ergebnis abnötigen, das nur auf den ersten Blick ob seiner konkre-
ten Aussagen besticht. - Angemessen sind solche Überlegungen auch bei dem er-
neuten Versuch, die Gründungssage der Johanniskirche auf ihren geschichtlichen
Kern zu überprüfen. Vor allem geht es hier um die Rolle der Herzogin Agnes.
EDie Klosterneuburger Parallele
und die Rolle der Herzogin Agnes
H. DECKER-HAUFF hat, wie schon andere zuvor, darauf verwiesen, daß die
Gmünder Ringlegende, die ganz typische Züge einer Wandersage aufweist, ein be-
merkenswertes österreichisches Gegenstück besitzt.1 Von dem farblosen Hinter-
grund der wenigen gesicherten Nachrichten über das weitere Schicksal der einsti-
gen Herzogin von Schwaben - wir hören, daß sie nach dem Tod ihres staufischen
Gatten den Babenberger Leopold III. heiratete, dem sie noch 18 Kinder
schenkte,2 - von diesem Hintergrund hebt sich ab der legendenumwobene Grün-
dungsbericht von Klosterneuburg. Die älteste bekannte Version findet sich in einer
aus dem 14. Jahrhundert stammenden Chronik der Klosterneuburger Stiftsbiblio-
thek.3 Hier eine Übersetzung des schwer zugänglichen lateinischen Textes: „Da
sie also um der Ehre Gottes und um des Heils ihrer Seelen willen eine Kirche zu
errichten und auszustatten beschlossen hatten und den zur Errichtung dieser
1 Vgl. H. DECKER-HAUFF, Festrede; frühere Hinweise bei H. ZEISSBERG, Hieb und Wurf
als Rechtssymbole in der Sage, in: Germania, Vierteljahresschrift für deutsche Altertumskunde,
hrsg. F. Pfeiffer 1 (13), 1868, 401. 421 ff.; A. MAILLY, Die geschichtliche Bedeutung der
Schleiersage, in: Klosterneuburg, Stadt und Stift, hrsg. V. O. Ludwig, Klosterneuburg 1927,
32 ff. Zur Parallele mit der Legende von Maria Schnee für Sta. Maria Maggiore in Rom vgl.
auch G. WACHA, Leopold d. Heilige u. Klosterneuburg v. 12. bis z. 20 Jahrh., Diss. Wien
1949, 9 ff. (mschr.).
2 Die Würdigung des Chronisten von Klosterneuburg (Cont. Claustroneoburg. I, MGH. SS. IX
610): „die sehr fromme und gute Gattin von königlicher Herkunft namens Agnes, die Tochter
Kaiser Heinrichs IV., hochberühmt ob ihrer angeborenen Tugend“, hält sich in den Grenzen
der üblichen nichtssagenden Werturteile.
3 Der Text aus der Chronica sancti Leopoldi in MS. 626 (Chronik A) folio 202’ ist abgedruckt
bei V. O. LUDWIG, Der Kanonisationsprozeß des Markgrafen Leopold HI. des Heiligen,
Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg 9, 1919, 146; vgl. ebda. Bd. 3, 1910, 357 f. Zur Weiter-
entwicklung der Legende vgl. A. ROCZEK, Der hl. Leopold in Dichtung u. Legende, in: St.
Leopold, Festschrift des Augustiner Chorherrenstiftes Klosterneuburg, hrsg. S. Wintermayr,
Klosterneuburg 1936, 27 ff. bes. 43 f.; vgl. auch B. ÖERNtK, Das mittelalterliche Lebensbild
des hl. Leopold, ebda. 7 ff.
Die Gründung der Stadt
Baubeginn, ungewiß sogar die Zugehörigkeit zum Kloster von Anfang an. Was
bleibt ist die Erkenntnis, daß wir gut daran tun, unser dürftiges gesichertes Ma-
terial nicht so lange zu pressen und mit fragwürdigen Hypothesen anzureichern,
bis wir ihm ein Ergebnis abnötigen, das nur auf den ersten Blick ob seiner konkre-
ten Aussagen besticht. - Angemessen sind solche Überlegungen auch bei dem er-
neuten Versuch, die Gründungssage der Johanniskirche auf ihren geschichtlichen
Kern zu überprüfen. Vor allem geht es hier um die Rolle der Herzogin Agnes.
EDie Klosterneuburger Parallele
und die Rolle der Herzogin Agnes
H. DECKER-HAUFF hat, wie schon andere zuvor, darauf verwiesen, daß die
Gmünder Ringlegende, die ganz typische Züge einer Wandersage aufweist, ein be-
merkenswertes österreichisches Gegenstück besitzt.1 Von dem farblosen Hinter-
grund der wenigen gesicherten Nachrichten über das weitere Schicksal der einsti-
gen Herzogin von Schwaben - wir hören, daß sie nach dem Tod ihres staufischen
Gatten den Babenberger Leopold III. heiratete, dem sie noch 18 Kinder
schenkte,2 - von diesem Hintergrund hebt sich ab der legendenumwobene Grün-
dungsbericht von Klosterneuburg. Die älteste bekannte Version findet sich in einer
aus dem 14. Jahrhundert stammenden Chronik der Klosterneuburger Stiftsbiblio-
thek.3 Hier eine Übersetzung des schwer zugänglichen lateinischen Textes: „Da
sie also um der Ehre Gottes und um des Heils ihrer Seelen willen eine Kirche zu
errichten und auszustatten beschlossen hatten und den zur Errichtung dieser
1 Vgl. H. DECKER-HAUFF, Festrede; frühere Hinweise bei H. ZEISSBERG, Hieb und Wurf
als Rechtssymbole in der Sage, in: Germania, Vierteljahresschrift für deutsche Altertumskunde,
hrsg. F. Pfeiffer 1 (13), 1868, 401. 421 ff.; A. MAILLY, Die geschichtliche Bedeutung der
Schleiersage, in: Klosterneuburg, Stadt und Stift, hrsg. V. O. Ludwig, Klosterneuburg 1927,
32 ff. Zur Parallele mit der Legende von Maria Schnee für Sta. Maria Maggiore in Rom vgl.
auch G. WACHA, Leopold d. Heilige u. Klosterneuburg v. 12. bis z. 20 Jahrh., Diss. Wien
1949, 9 ff. (mschr.).
2 Die Würdigung des Chronisten von Klosterneuburg (Cont. Claustroneoburg. I, MGH. SS. IX
610): „die sehr fromme und gute Gattin von königlicher Herkunft namens Agnes, die Tochter
Kaiser Heinrichs IV., hochberühmt ob ihrer angeborenen Tugend“, hält sich in den Grenzen
der üblichen nichtssagenden Werturteile.
3 Der Text aus der Chronica sancti Leopoldi in MS. 626 (Chronik A) folio 202’ ist abgedruckt
bei V. O. LUDWIG, Der Kanonisationsprozeß des Markgrafen Leopold HI. des Heiligen,
Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg 9, 1919, 146; vgl. ebda. Bd. 3, 1910, 357 f. Zur Weiter-
entwicklung der Legende vgl. A. ROCZEK, Der hl. Leopold in Dichtung u. Legende, in: St.
Leopold, Festschrift des Augustiner Chorherrenstiftes Klosterneuburg, hrsg. S. Wintermayr,
Klosterneuburg 1936, 27 ff. bes. 43 f.; vgl. auch B. ÖERNtK, Das mittelalterliche Lebensbild
des hl. Leopold, ebda. 7 ff.