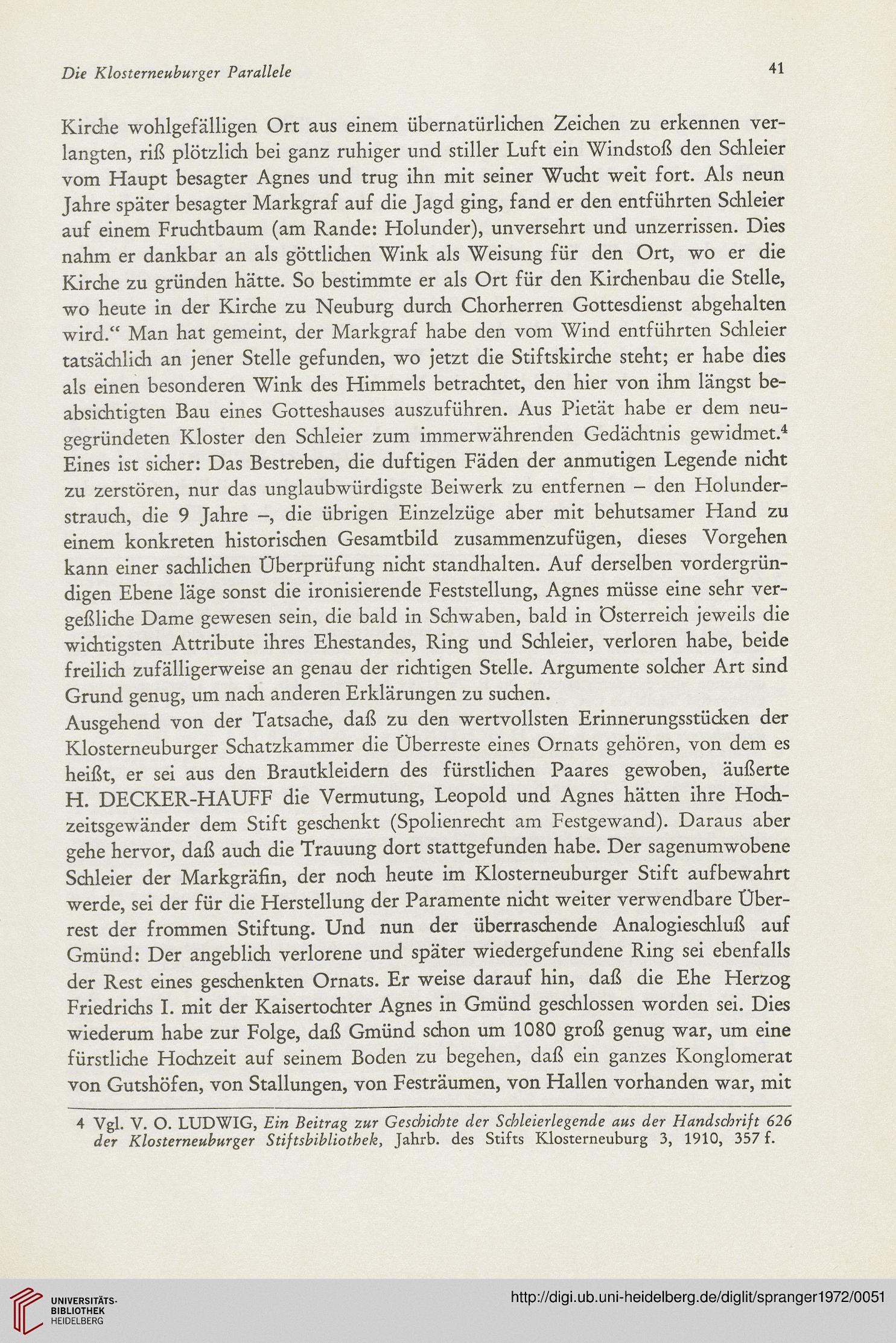Die Klosterneuburger Parallele
41
Kirche wohlgefälligen Ort aus einem übernatürlichen Zeichen zu erkennen ver-
langten, riß plötzlich bei ganz ruhiger und stiller Luft ein Windstoß den Schleier
vom Haupt besagter Agnes und trug ihn mit seiner Wucht weit fort. Als neun
Jahre später besagter Markgraf auf die Jagd ging, fand er den entführten Schleier
auf einem Fruchtbaum (am Rande: Holunder), unversehrt und unzerrissen. Dies
nahm er dankbar an als göttlichen Wink als Weisung für den Ort, wo er die
Kirche zu gründen hätte. So bestimmte er als Ort für den Kirchenbau die Stelle,
wo heute in der Kirche zu Neuburg durch Chorherren Gottesdienst abgehalten
wird.“ Man hat gemeint, der Markgraf habe den vom Wind entführten Schleier
tatsächlich an jener Stelle gefunden, wo jetzt die Stiftskirche steht; er habe dies
als einen besonderen Wink des Himmels betrachtet, den hier von ihm längst be-
absichtigten Bau eines Gotteshauses auszuführen. Aus Pietät habe er dem neu-
gegründeten Kloster den Schleier zum immerwährenden Gedächtnis gewidmet.4
Eines ist sicher: Das Bestreben, die duftigen Fäden der anmutigen Legende nicht
zu zerstören, nur das unglaubwürdigste Beiwerk zu entfernen — den Holunder-
strauch, die 9 Jahre -, die übrigen Einzelzüge aber mit behutsamer Hand zu
einem konkreten historischen Gesamtbild zusammenzufügen, dieses Vorgehen
kann einer sachlichen Überprüfung nicht standhalten. Auf derselben vordergrün-
digen Ebene läge sonst die ironisierende Feststellung, Agnes müsse eine sehr ver-
geßliche Dame gewesen sein, die bald in Schwaben, bald in Österreich jeweils die
wichtigsten Attribute ihres Ehestandes, Ring und Schleier, verloren habe, beide
freilich zufälligerweise an genau der richtigen Stelle. Argumente solcher Art sind
Grund genug, um nach anderen Erklärungen zu suchen.
Ausgehend von der Tatsache, daß zu den wertvollsten Erinnerungsstücken der
Klosterneuburger Schatzkammer die Überreste eines Ornats gehören, von dem es
heißt, er sei aus den Brautkleidern des fürstlichen Paares gewoben, äußerte
H. DECKER-HAUFF die Vermutung, Leopold und Agnes hätten ihre Hoch-
zeitsgewänder dem Stift geschenkt (Spolienrecht am Festgewand). Daraus aber
gehe hervor, daß auch die Trauung dort stattgefunden habe. Der sagenumwobene
Schleier der Markgräfin, der noch heute im Klosterneuburger Stift aufbewahrt
werde, sei der für die Herstellung der Paramente nicht weiter verwendbare Über-
rest der frommen Stiftung. Und nun der überraschende Analogieschluß auf
Gmünd: Der angeblich verlorene und später wiedergefundene Ring sei ebenfalls
der Rest eines geschenkten Ornats. Er weise darauf hin, daß die Ehe Herzog
Friedrichs I. mit der Kaisertochter Agnes in Gmünd geschlossen worden sei. Dies
wiederum habe zur Folge, daß Gmünd schon um 1080 groß genug war, um eine
fürstliche Hochzeit auf seinem Boden zu begehen, daß ein ganzes Konglomerat
von Gutshöfen, von Stallungen, von Festräumen, von Hallen vorhanden war, mit
4 Vgl. V. O. LUDWIG, Ein Beitrag zur Geschichte der Schleierlegende aus der Handschrift 626
der Klosterneuburger Stiftsbibliothek, Jahrb. des Stifts Klosterneuburg 3, 1910, 357 f.
41
Kirche wohlgefälligen Ort aus einem übernatürlichen Zeichen zu erkennen ver-
langten, riß plötzlich bei ganz ruhiger und stiller Luft ein Windstoß den Schleier
vom Haupt besagter Agnes und trug ihn mit seiner Wucht weit fort. Als neun
Jahre später besagter Markgraf auf die Jagd ging, fand er den entführten Schleier
auf einem Fruchtbaum (am Rande: Holunder), unversehrt und unzerrissen. Dies
nahm er dankbar an als göttlichen Wink als Weisung für den Ort, wo er die
Kirche zu gründen hätte. So bestimmte er als Ort für den Kirchenbau die Stelle,
wo heute in der Kirche zu Neuburg durch Chorherren Gottesdienst abgehalten
wird.“ Man hat gemeint, der Markgraf habe den vom Wind entführten Schleier
tatsächlich an jener Stelle gefunden, wo jetzt die Stiftskirche steht; er habe dies
als einen besonderen Wink des Himmels betrachtet, den hier von ihm längst be-
absichtigten Bau eines Gotteshauses auszuführen. Aus Pietät habe er dem neu-
gegründeten Kloster den Schleier zum immerwährenden Gedächtnis gewidmet.4
Eines ist sicher: Das Bestreben, die duftigen Fäden der anmutigen Legende nicht
zu zerstören, nur das unglaubwürdigste Beiwerk zu entfernen — den Holunder-
strauch, die 9 Jahre -, die übrigen Einzelzüge aber mit behutsamer Hand zu
einem konkreten historischen Gesamtbild zusammenzufügen, dieses Vorgehen
kann einer sachlichen Überprüfung nicht standhalten. Auf derselben vordergrün-
digen Ebene läge sonst die ironisierende Feststellung, Agnes müsse eine sehr ver-
geßliche Dame gewesen sein, die bald in Schwaben, bald in Österreich jeweils die
wichtigsten Attribute ihres Ehestandes, Ring und Schleier, verloren habe, beide
freilich zufälligerweise an genau der richtigen Stelle. Argumente solcher Art sind
Grund genug, um nach anderen Erklärungen zu suchen.
Ausgehend von der Tatsache, daß zu den wertvollsten Erinnerungsstücken der
Klosterneuburger Schatzkammer die Überreste eines Ornats gehören, von dem es
heißt, er sei aus den Brautkleidern des fürstlichen Paares gewoben, äußerte
H. DECKER-HAUFF die Vermutung, Leopold und Agnes hätten ihre Hoch-
zeitsgewänder dem Stift geschenkt (Spolienrecht am Festgewand). Daraus aber
gehe hervor, daß auch die Trauung dort stattgefunden habe. Der sagenumwobene
Schleier der Markgräfin, der noch heute im Klosterneuburger Stift aufbewahrt
werde, sei der für die Herstellung der Paramente nicht weiter verwendbare Über-
rest der frommen Stiftung. Und nun der überraschende Analogieschluß auf
Gmünd: Der angeblich verlorene und später wiedergefundene Ring sei ebenfalls
der Rest eines geschenkten Ornats. Er weise darauf hin, daß die Ehe Herzog
Friedrichs I. mit der Kaisertochter Agnes in Gmünd geschlossen worden sei. Dies
wiederum habe zur Folge, daß Gmünd schon um 1080 groß genug war, um eine
fürstliche Hochzeit auf seinem Boden zu begehen, daß ein ganzes Konglomerat
von Gutshöfen, von Stallungen, von Festräumen, von Hallen vorhanden war, mit
4 Vgl. V. O. LUDWIG, Ein Beitrag zur Geschichte der Schleierlegende aus der Handschrift 626
der Klosterneuburger Stiftsbibliothek, Jahrb. des Stifts Klosterneuburg 3, 1910, 357 f.