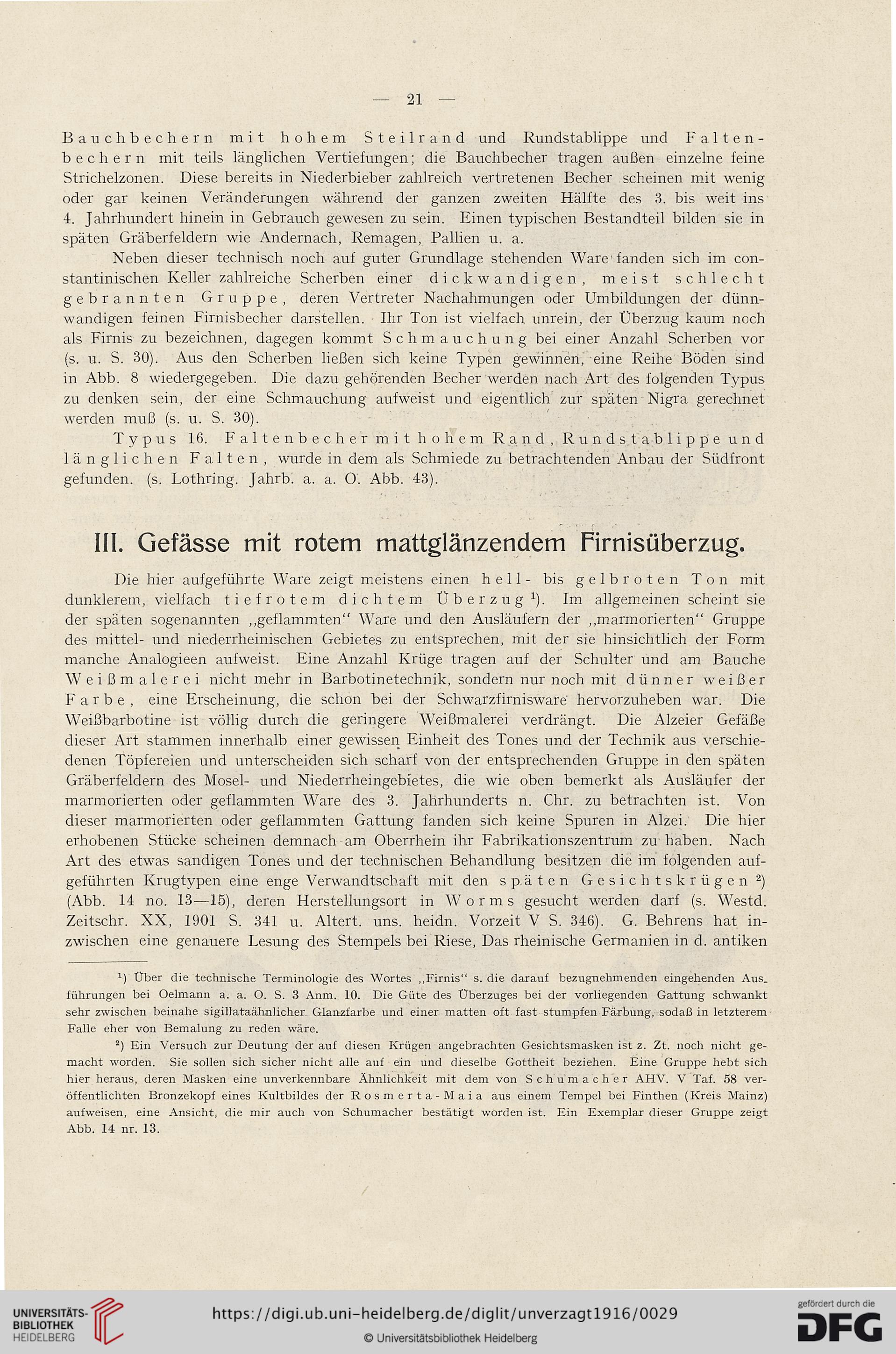21
Bauchbechern mit hohem Steilrand und Rundstablippe und Falten-
bechern mit teils länglichen Vertiefungen; die Bauchbecher tragen außen einzelne feine
Strichelzonen. Diese bereits in Niederbieber zahlreich vertretenen Becher scheinen mit wenig
oder gar keinen Veränderungen während der ganzen zweiten Hälfte des 3. bis weit ins
4. Jahrhundert hinein in Gebrauch gewesen zu sein. Einen typischen Bestandteil bilden sie in
späten Gräberfeldern wie Andernach, Remagen, Pallien u. a.
Neben dieser technisch noch auf guter Grundlage stehenden Ware'fanden sich im con-
stantinischen Keller zahlreiche Scherben einer dickwandigen, meist schlecht
gebrannten Gruppe, deren Vertreter Nachahmungen oder Umbildungen der dünn-
wandigen feinen Firnisbecher darstellen. Ihr Ton ist vielfach unrein, der Überzug kaum noch
als Firnis zu bezeichnen, dagegen kommt Schmauchung bei einer Anzahl Scherben vor
(s. u. S. 30). Aus den Scherben ließen sich keine Typen gewinnen, eine Reihe Böden sind
in Abb. 8 wiedergegeben. Die dazu gehörenden Becher werden nach Art des folgenden Typus
zu denken sein, der eine Schmauchung aufweist und eigentlich zur späten Nigra gerechnet
werden muß (s. u. S. 30).
Typus 16. Faltenbecher mit hohem Rand, Rundstablippe und
länglichen Falten, wurde in dem als Schmiede zu betrachtenden Anbau der Südfront
gefunden, (s. Lothring. Jahrb. a. a. O. Abb. 43).
III. Gefässe mit rotem mattglänzendem Firnisüberzug.
Die hier aufgeführte Ware zeigt meistens einen hell- bis gelb roten Ton mit
dunklerem, vielfach tiefrotem dichtem Überzug1). Im allgemeinen scheint sie
der spaten sogenannten „geflammten“ Ware und den Ausläufern der „marmorierten“ Gruppe
des mittel- und niederrheinischen Gebietes zu entsprechen, mit der sie hinsichtlich der Form
manche Analogieen aufweist. Eine Anzahl Krüge tragen auf der Schulter und am Bauche
Weißmalerei nicht mehr in Barbotinetechnik, sondern nur noch mit dünner weißer
Farbe, eine Erscheinung, die schon bei der Schwarzfirnisware' hervorzuheben war. Die
Weißbarbotine ist völlig durch die geringere Weißmalerei verdrängt. Die Alzeier Gefäße
dieser Art stammen innerhalb einer gewissen Einheit des Tones und der Technik aus verschie-
denen Töpfereien und unterscheiden sich scharf von der entsprechenden Gruppe in den späten
Gräberfeldern des Mosel- und Niederrheingebietes, die wie oben bemerkt als Ausläufer der
marmorierten oder geflammten Ware des 3. Jahrhunderts n. Chr. zu betrachten ist. Von
dieser marmorierten oder geflammten Gattung fanden sich keine Spuren in Alzei. Die hier
erhobenen Stücke scheinen demnach am Oberrhein ihr Fabrikationszentrum zu haben. Nach
Art des etwas sandigen Tones und der technischen Behandlung besitzen die im folgenden auf-
geführten Krugtypen eine enge Verwandtschaft mit den späten Gesichtskrügen 2)
(Abb. 14 no. 13—15), deren Herstellungsort in W o r m s gesucht werden darf (s. Westd.
Zeitschr. XX, 1901 S. 341 u. Altert, uns. heidn. Vorzeit V S. 346). G. Behrens hat in-
zwischen eine genauere Lesung des Stempels bei Riese, Das rheinische Germanien in d. antiken
’) Über die technische Terminologie des Wortes „Firnis“ s. die darauf bezugnehmenden eingehenden Aus.
führungen bei Oelmann a. a. O. S. 3 Anm. 10. Die Güte des Überzuges bei der vorliegenden Gattung schwankt
sehr zwischen beinahe sigillataähnlicher Glanzfarbe und einer matten oft fast stumpfen Färbung, sodaß in letzterem
Falle eher von Bemalung zu reden wäre.
2) Ein Versuch zur Deutung der auf diesen Krügen angebrachten Gesichtsmasken ist z. Zt. noch nicht ge-
macht worden. Sie sollen sich sicher nicht alle auf ein und dieselbe Gottheit beziehen. Eine Gruppe hebt sich
hier heraus, deren Masken eine unverkennbare Ähnlichkeit mit dem von Schumacher AHV. V Taf. 58 ver-
öffentlichten Bronzekopf eines Kultbildes der Rosmerta-Maia aus einem Tempel bei Finthen (Kreis Mainz)
aufweisen, eine Ansicht, die mir auch von Schumacher bestätigt worden ist. Ein Exemplar dieser Gruppe zeigt
Abb. 14 nr. 13.
Bauchbechern mit hohem Steilrand und Rundstablippe und Falten-
bechern mit teils länglichen Vertiefungen; die Bauchbecher tragen außen einzelne feine
Strichelzonen. Diese bereits in Niederbieber zahlreich vertretenen Becher scheinen mit wenig
oder gar keinen Veränderungen während der ganzen zweiten Hälfte des 3. bis weit ins
4. Jahrhundert hinein in Gebrauch gewesen zu sein. Einen typischen Bestandteil bilden sie in
späten Gräberfeldern wie Andernach, Remagen, Pallien u. a.
Neben dieser technisch noch auf guter Grundlage stehenden Ware'fanden sich im con-
stantinischen Keller zahlreiche Scherben einer dickwandigen, meist schlecht
gebrannten Gruppe, deren Vertreter Nachahmungen oder Umbildungen der dünn-
wandigen feinen Firnisbecher darstellen. Ihr Ton ist vielfach unrein, der Überzug kaum noch
als Firnis zu bezeichnen, dagegen kommt Schmauchung bei einer Anzahl Scherben vor
(s. u. S. 30). Aus den Scherben ließen sich keine Typen gewinnen, eine Reihe Böden sind
in Abb. 8 wiedergegeben. Die dazu gehörenden Becher werden nach Art des folgenden Typus
zu denken sein, der eine Schmauchung aufweist und eigentlich zur späten Nigra gerechnet
werden muß (s. u. S. 30).
Typus 16. Faltenbecher mit hohem Rand, Rundstablippe und
länglichen Falten, wurde in dem als Schmiede zu betrachtenden Anbau der Südfront
gefunden, (s. Lothring. Jahrb. a. a. O. Abb. 43).
III. Gefässe mit rotem mattglänzendem Firnisüberzug.
Die hier aufgeführte Ware zeigt meistens einen hell- bis gelb roten Ton mit
dunklerem, vielfach tiefrotem dichtem Überzug1). Im allgemeinen scheint sie
der spaten sogenannten „geflammten“ Ware und den Ausläufern der „marmorierten“ Gruppe
des mittel- und niederrheinischen Gebietes zu entsprechen, mit der sie hinsichtlich der Form
manche Analogieen aufweist. Eine Anzahl Krüge tragen auf der Schulter und am Bauche
Weißmalerei nicht mehr in Barbotinetechnik, sondern nur noch mit dünner weißer
Farbe, eine Erscheinung, die schon bei der Schwarzfirnisware' hervorzuheben war. Die
Weißbarbotine ist völlig durch die geringere Weißmalerei verdrängt. Die Alzeier Gefäße
dieser Art stammen innerhalb einer gewissen Einheit des Tones und der Technik aus verschie-
denen Töpfereien und unterscheiden sich scharf von der entsprechenden Gruppe in den späten
Gräberfeldern des Mosel- und Niederrheingebietes, die wie oben bemerkt als Ausläufer der
marmorierten oder geflammten Ware des 3. Jahrhunderts n. Chr. zu betrachten ist. Von
dieser marmorierten oder geflammten Gattung fanden sich keine Spuren in Alzei. Die hier
erhobenen Stücke scheinen demnach am Oberrhein ihr Fabrikationszentrum zu haben. Nach
Art des etwas sandigen Tones und der technischen Behandlung besitzen die im folgenden auf-
geführten Krugtypen eine enge Verwandtschaft mit den späten Gesichtskrügen 2)
(Abb. 14 no. 13—15), deren Herstellungsort in W o r m s gesucht werden darf (s. Westd.
Zeitschr. XX, 1901 S. 341 u. Altert, uns. heidn. Vorzeit V S. 346). G. Behrens hat in-
zwischen eine genauere Lesung des Stempels bei Riese, Das rheinische Germanien in d. antiken
’) Über die technische Terminologie des Wortes „Firnis“ s. die darauf bezugnehmenden eingehenden Aus.
führungen bei Oelmann a. a. O. S. 3 Anm. 10. Die Güte des Überzuges bei der vorliegenden Gattung schwankt
sehr zwischen beinahe sigillataähnlicher Glanzfarbe und einer matten oft fast stumpfen Färbung, sodaß in letzterem
Falle eher von Bemalung zu reden wäre.
2) Ein Versuch zur Deutung der auf diesen Krügen angebrachten Gesichtsmasken ist z. Zt. noch nicht ge-
macht worden. Sie sollen sich sicher nicht alle auf ein und dieselbe Gottheit beziehen. Eine Gruppe hebt sich
hier heraus, deren Masken eine unverkennbare Ähnlichkeit mit dem von Schumacher AHV. V Taf. 58 ver-
öffentlichten Bronzekopf eines Kultbildes der Rosmerta-Maia aus einem Tempel bei Finthen (Kreis Mainz)
aufweisen, eine Ansicht, die mir auch von Schumacher bestätigt worden ist. Ein Exemplar dieser Gruppe zeigt
Abb. 14 nr. 13.