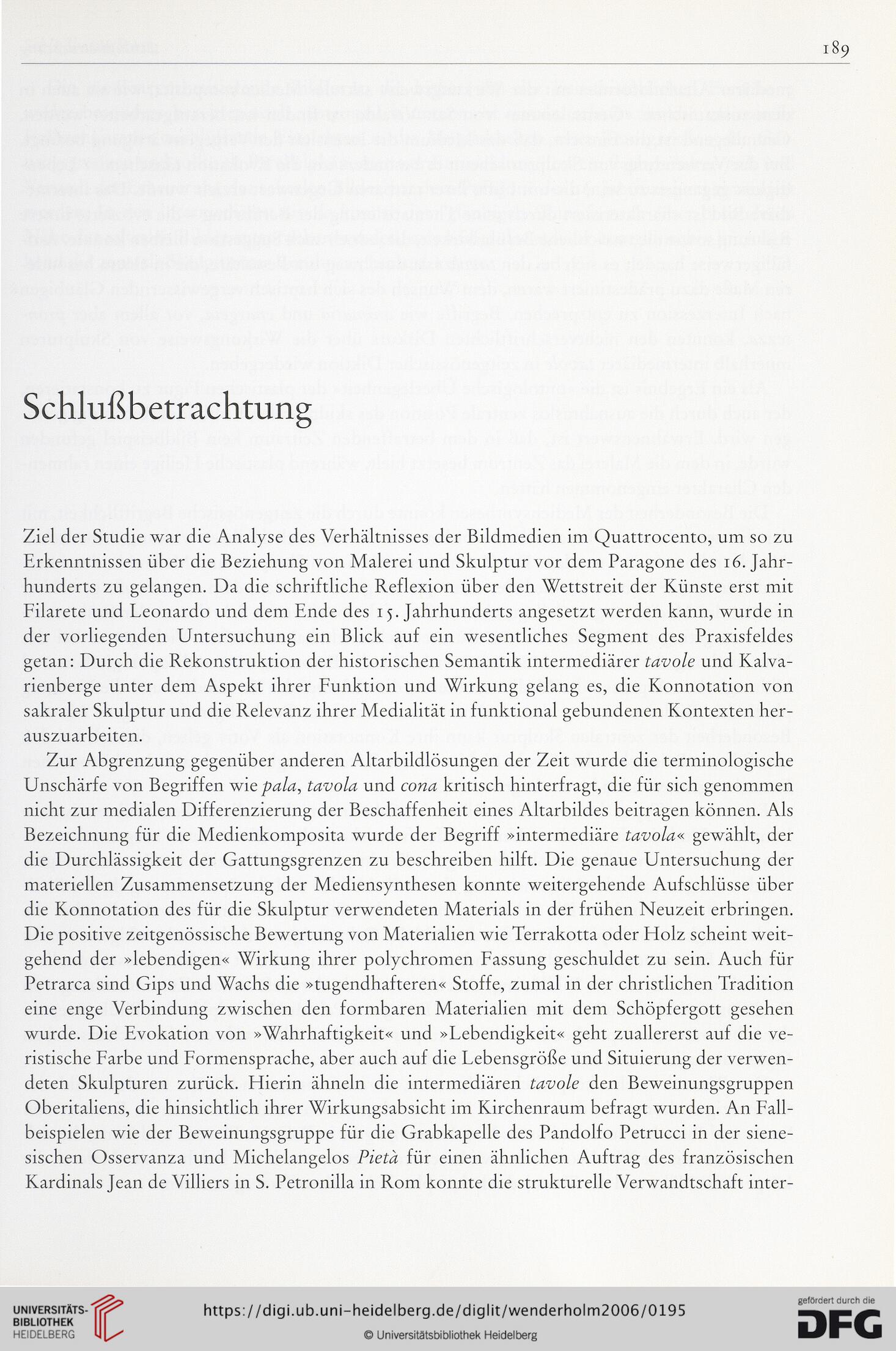189
Schlußbetrachtung
Ziel der Studie war die Analyse des Verhältnisses der Bildmedien im Quattrocento, um so zu
Erkenntnissen über die Beziehung von Malerei und Skulptur vor dem Paragone des 16. Jahr-
hunderts zu gelangen. Da die schriftliche Reflexion über den Wettstreit der Künste erst mit
Filarete und Leonardo und dem Ende des 15. Jahrhunderts angesetzt werden kann, wurde in
der vorliegenden Untersuchung ein Blick auf ein wesentliches Segment des Praxisfeldes
getan: Durch die Rekonstruktion der historischen Semantik intermediärer tavole und Kalva-
rienberge unter dem Aspekt ihrer Funktion und Wirkung gelang es, die Konnotation von
sakraler Skulptur und die Relevanz ihrer Medialität in funktional gebundenen Kontexten her-
auszuarbeiten.
Zur Abgrenzung gegenüber anderen Altarbildlösungen der Zeit wurde die terminologische
Unschärfe von Begriffen wie pala, tavola und cona kritisch hinterfragt, die für sich genommen
nicht zur medialen Differenzierung der Beschaffenheit eines Altarbildes beitragen können. Als
Bezeichnung für die Medienkomposita wurde der Begriff »intermediäre tavola« gewählt, der
die Durchlässigkeit der Gattungsgrenzen zu beschreiben hilft. Die genaue Untersuchung der
materiellen Zusammensetzung der Mediensynthesen konnte weitergehende Aufschlüsse über
die Konnotation des für die Skulptur verwendeten Materials in der frühen Neuzeit erbringen.
Die positive zeitgenössische Bewertung von Materialien wie Terrakotta oder Holz scheint weit-
gehend der »lebendigen« Wirkung ihrer polychromen Fassung geschuldet zu sein. Auch für
Petrarca sind Gips und Wachs die »tugendhafteren« Stoffe, zumal in der christlichen Tradition
eine enge Verbindung zwischen den formbaren Materialien mit dem Schöpfergott gesehen
wurde. Die Evokation von »Wahrhaftigkeit« und »Lebendigkeit« geht zuallererst auf die ve-
ristische Farbe und Formensprache, aber auch auf die Lebensgröße und Situierung der verwen-
deten Skulpturen zurück. Hierin ähneln die intermediären tavole den Beweinungsgruppen
Oberitaliens, die hinsichtlich ihrer Wirkungsabsicht im Kirchenraum befragt wurden. An Fall-
beispielen wie der Beweinungsgruppe für die Grabkapelle des Pandolfo Petrucci in der siene-
sischen Osservanza und Michelangelos Pieta für einen ähnlichen Auftrag des französischen
Kardinals Jean de Villiers in S. Petronilla in Rom konnte die strukturelle Verwandtschaft inter-
Schlußbetrachtung
Ziel der Studie war die Analyse des Verhältnisses der Bildmedien im Quattrocento, um so zu
Erkenntnissen über die Beziehung von Malerei und Skulptur vor dem Paragone des 16. Jahr-
hunderts zu gelangen. Da die schriftliche Reflexion über den Wettstreit der Künste erst mit
Filarete und Leonardo und dem Ende des 15. Jahrhunderts angesetzt werden kann, wurde in
der vorliegenden Untersuchung ein Blick auf ein wesentliches Segment des Praxisfeldes
getan: Durch die Rekonstruktion der historischen Semantik intermediärer tavole und Kalva-
rienberge unter dem Aspekt ihrer Funktion und Wirkung gelang es, die Konnotation von
sakraler Skulptur und die Relevanz ihrer Medialität in funktional gebundenen Kontexten her-
auszuarbeiten.
Zur Abgrenzung gegenüber anderen Altarbildlösungen der Zeit wurde die terminologische
Unschärfe von Begriffen wie pala, tavola und cona kritisch hinterfragt, die für sich genommen
nicht zur medialen Differenzierung der Beschaffenheit eines Altarbildes beitragen können. Als
Bezeichnung für die Medienkomposita wurde der Begriff »intermediäre tavola« gewählt, der
die Durchlässigkeit der Gattungsgrenzen zu beschreiben hilft. Die genaue Untersuchung der
materiellen Zusammensetzung der Mediensynthesen konnte weitergehende Aufschlüsse über
die Konnotation des für die Skulptur verwendeten Materials in der frühen Neuzeit erbringen.
Die positive zeitgenössische Bewertung von Materialien wie Terrakotta oder Holz scheint weit-
gehend der »lebendigen« Wirkung ihrer polychromen Fassung geschuldet zu sein. Auch für
Petrarca sind Gips und Wachs die »tugendhafteren« Stoffe, zumal in der christlichen Tradition
eine enge Verbindung zwischen den formbaren Materialien mit dem Schöpfergott gesehen
wurde. Die Evokation von »Wahrhaftigkeit« und »Lebendigkeit« geht zuallererst auf die ve-
ristische Farbe und Formensprache, aber auch auf die Lebensgröße und Situierung der verwen-
deten Skulpturen zurück. Hierin ähneln die intermediären tavole den Beweinungsgruppen
Oberitaliens, die hinsichtlich ihrer Wirkungsabsicht im Kirchenraum befragt wurden. An Fall-
beispielen wie der Beweinungsgruppe für die Grabkapelle des Pandolfo Petrucci in der siene-
sischen Osservanza und Michelangelos Pieta für einen ähnlichen Auftrag des französischen
Kardinals Jean de Villiers in S. Petronilla in Rom konnte die strukturelle Verwandtschaft inter-