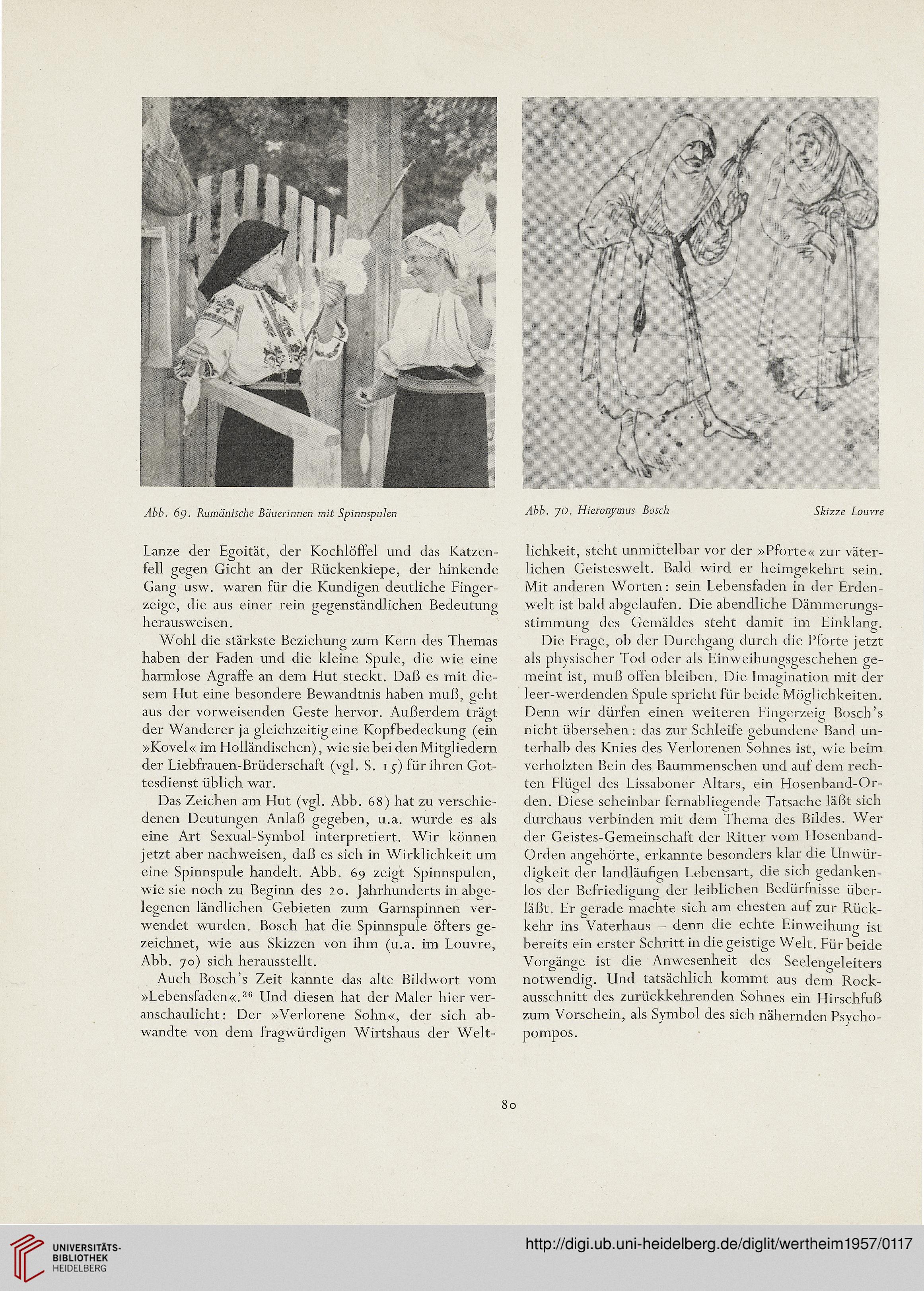Abb. 6g. Rumänische Bäuerinnen mit Spinnspulen
Abb. JO. Hieronymus Bosch
Skizze Louvre
Lanze der Egoität, der Kochlöffel und das Katzen-
fell gegen Gicht an der Rückenkiepe, der hinkende
Gang usw. waren für die Kundigen deutliche Finger-
zeige, die aus einer rein gegenständlichen Bedeutung
herausweisen.
Wohl die stärkste Beziehung zum Kern des Themas
haben der Faden und die kleine Spule, die wie eine
harmlose Agraffe an dem Hut steckt. Daß es mit die-
sem Hut eine besondere Bewandtnis haben muß, geht
aus der vorweisenden Geste hervor. Außerdem tränt
O
der Wanderer ja gleichzeitig eine Kopfbedeckung (ein
»Kovel« im Holländischen), wie sie bei den Mitgliedern
der Liebfrauen-Brüderschaft (vgl. S. i g) für ihren Got-
tesdienst üblich war.
Das Zeichen am Hut (vgl. Abb. 68) hat zu verschie-
denen Deutungen Anlaß gegeben, u.a. wurde es als
eine Art Sexual-Symbol interpretiert. Wir können
jetzt aber nach weisen, daß es sich in Wirklichkeit um
eine Spinnspule handelt. Abb. 69 zeigt Spinnspulen,
wie sie noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in abge-
legenen ländlichen Gebieten zum Garnspinnen ver-
wendet wurden. Bosch hat die Spinnspule öfters ge-
zeichnet, wie aus Skizzen von ihm (u.a. im Louvre,
Abb. 70) sich herausstellt.
Auch Bosch’s Zeit kannte das alte Bildwort vom
»Lebensfaden«.36 Und diesen hat der Maler hier ver-
anschaulicht: Der »Verlorene Sohn«, der sich ab-
wandte von dem fragwürdigen Wirtshaus der Welt-
lichkeit, steht unmittelbar vor der »Pforte« zur väter-
lichen Geisteswelt. Bald wird er beimgekehrt sein.
Mit anderen Worten : sein Lebensfaden in der Erden-
weit ist bald abgelaufen. Die abendliche Dämmerungs-
stimmung des Gemäldes steht damit im Einklang.
Die Frage, ob der Durchgang durch die Pforte jetzt
als physischer Tod oder als Einweihungsgeschehen ge-
meint ist, muß offen bleiben. Die Imagination mit der
leer-werdenden Spule spricht für beide Möglichkeiten.
Denn wir dürfen einen weiteren Fingerzeig Bosch’s
nicht übersehen : das zur Schleife gebundene Band un-
terhalb des Knies des Verlorenen Sohnes ist, wie beim
verholzten Bein des Baummenschen und auf dem rech-
ten Flügel des Lissaboner Altars, ein Hosenband-Or-
den. Diese scheinbar fernabliegende Tatsache läßt sich
durchaus verbinden mit dem Thema des Bildes. Wer
der Geistes-Gemeinschaft der Ritter vom Hosenband-
Orden angehörte, erkannte besonders klar die Unwür-
digkeit der landläufigen Lebensart, die sich gedanken-
los der Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse über-
läßt. Er gerade machte sich am ehesten auf zur Rück-
kehr ins Vaterhaus — denn die echte Einweihung ist
bereits ein erster Schritt in die geistige Welt. Für beide
Vorgänge ist die Anwesenheit des Seelengeleiters
notwendig. Und tatsächlich kommt aus dem Rock-
ausschnitt des zurückkehrenden Sohnes ein Hirschfuß
zum Vorschein, als Symbol des sich nähernden Psycho-
pompos.
80
Abb. JO. Hieronymus Bosch
Skizze Louvre
Lanze der Egoität, der Kochlöffel und das Katzen-
fell gegen Gicht an der Rückenkiepe, der hinkende
Gang usw. waren für die Kundigen deutliche Finger-
zeige, die aus einer rein gegenständlichen Bedeutung
herausweisen.
Wohl die stärkste Beziehung zum Kern des Themas
haben der Faden und die kleine Spule, die wie eine
harmlose Agraffe an dem Hut steckt. Daß es mit die-
sem Hut eine besondere Bewandtnis haben muß, geht
aus der vorweisenden Geste hervor. Außerdem tränt
O
der Wanderer ja gleichzeitig eine Kopfbedeckung (ein
»Kovel« im Holländischen), wie sie bei den Mitgliedern
der Liebfrauen-Brüderschaft (vgl. S. i g) für ihren Got-
tesdienst üblich war.
Das Zeichen am Hut (vgl. Abb. 68) hat zu verschie-
denen Deutungen Anlaß gegeben, u.a. wurde es als
eine Art Sexual-Symbol interpretiert. Wir können
jetzt aber nach weisen, daß es sich in Wirklichkeit um
eine Spinnspule handelt. Abb. 69 zeigt Spinnspulen,
wie sie noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in abge-
legenen ländlichen Gebieten zum Garnspinnen ver-
wendet wurden. Bosch hat die Spinnspule öfters ge-
zeichnet, wie aus Skizzen von ihm (u.a. im Louvre,
Abb. 70) sich herausstellt.
Auch Bosch’s Zeit kannte das alte Bildwort vom
»Lebensfaden«.36 Und diesen hat der Maler hier ver-
anschaulicht: Der »Verlorene Sohn«, der sich ab-
wandte von dem fragwürdigen Wirtshaus der Welt-
lichkeit, steht unmittelbar vor der »Pforte« zur väter-
lichen Geisteswelt. Bald wird er beimgekehrt sein.
Mit anderen Worten : sein Lebensfaden in der Erden-
weit ist bald abgelaufen. Die abendliche Dämmerungs-
stimmung des Gemäldes steht damit im Einklang.
Die Frage, ob der Durchgang durch die Pforte jetzt
als physischer Tod oder als Einweihungsgeschehen ge-
meint ist, muß offen bleiben. Die Imagination mit der
leer-werdenden Spule spricht für beide Möglichkeiten.
Denn wir dürfen einen weiteren Fingerzeig Bosch’s
nicht übersehen : das zur Schleife gebundene Band un-
terhalb des Knies des Verlorenen Sohnes ist, wie beim
verholzten Bein des Baummenschen und auf dem rech-
ten Flügel des Lissaboner Altars, ein Hosenband-Or-
den. Diese scheinbar fernabliegende Tatsache läßt sich
durchaus verbinden mit dem Thema des Bildes. Wer
der Geistes-Gemeinschaft der Ritter vom Hosenband-
Orden angehörte, erkannte besonders klar die Unwür-
digkeit der landläufigen Lebensart, die sich gedanken-
los der Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse über-
läßt. Er gerade machte sich am ehesten auf zur Rück-
kehr ins Vaterhaus — denn die echte Einweihung ist
bereits ein erster Schritt in die geistige Welt. Für beide
Vorgänge ist die Anwesenheit des Seelengeleiters
notwendig. Und tatsächlich kommt aus dem Rock-
ausschnitt des zurückkehrenden Sohnes ein Hirschfuß
zum Vorschein, als Symbol des sich nähernden Psycho-
pompos.
80