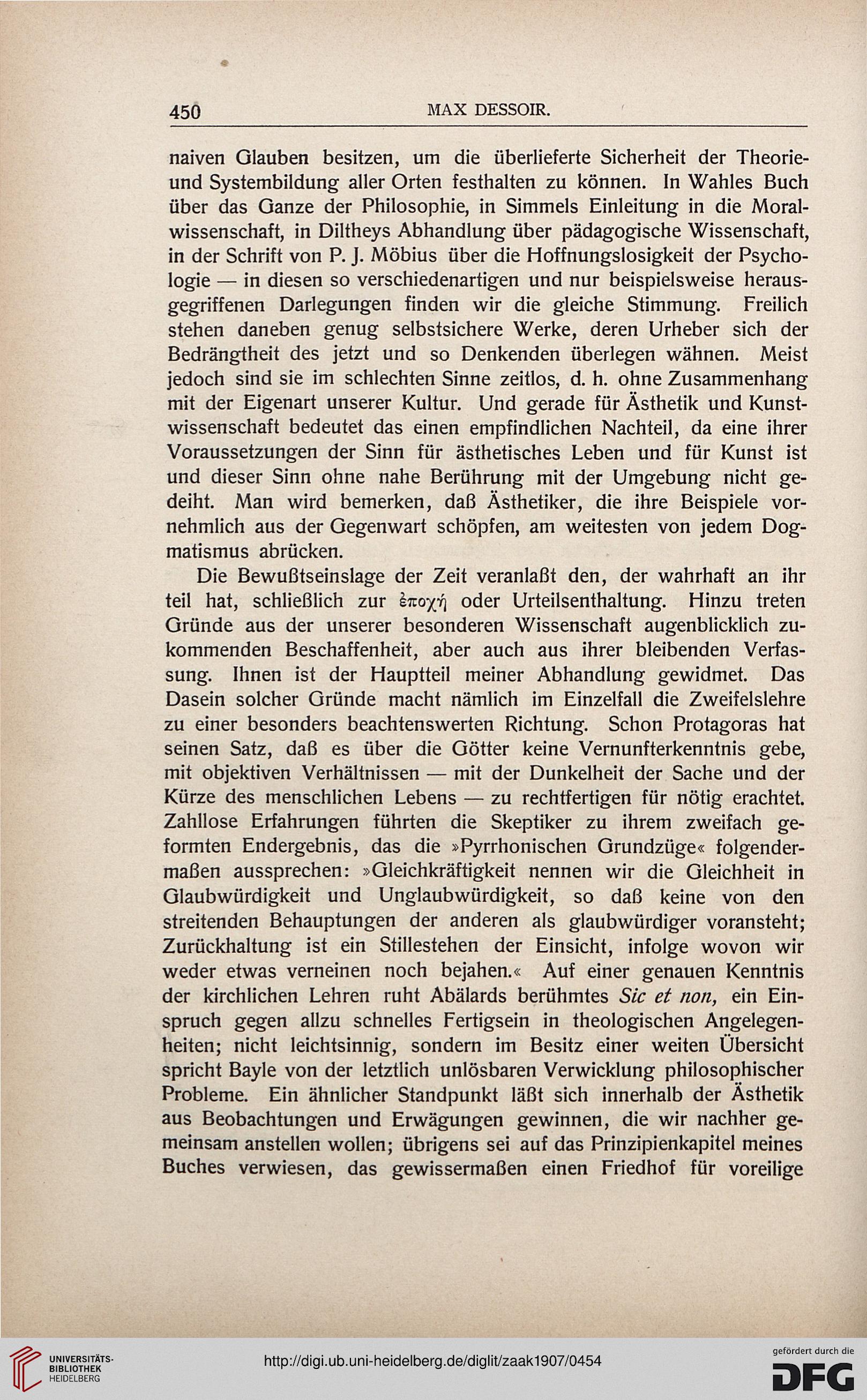450 MAX DESSOIR.
naiven Glauben besitzen, um die überlieferte Sicherheit der Theorie-
und Systembildung aller Orten festhalten zu können. In Wahles Buch
über das Ganze der Philosophie, in Simmeis Einleitung in die Moral-
wissenschaft, in Diltheys Abhandlung über pädagogische Wissenschaft,
in der Schrift von P. J. Möbius über die Hoffnungslosigkeit der Psycho-
logie — in diesen so verschiedenartigen und nur beispielsweise heraus-
gegriffenen Darlegungen finden wir die gleiche Stimmung. Freilich
stehen daneben genug selbstsichere Werke, deren Urheber sich der
Bedrängtheit des jetzt und so Denkenden überlegen wähnen. Meist
jedoch sind sie im schlechten Sinne zeitlos, d. h. ohne Zusammenhang
mit der Eigenart unserer Kultur. Und gerade für Ästhetik und Kunst-
wissenschaft bedeutet das einen empfindlichen Nachteil, da eine ihrer
Voraussetzungen der Sinn für ästhetisches Leben und für Kunst ist
und dieser Sinn ohne nahe Berührung mit der Umgebung nicht ge-
deiht. Man wird bemerken, daß Ästhetiker, die ihre Beispiele vor-
nehmlich aus der Gegenwart schöpfen, am weitesten von jedem Dog-
matismus abrücken.
Die Bewußtseinslage der Zeit veranlaßt den, der wahrhaft an ihr
teil hat, schließlich zur knoyr\ oder Urteilsenthaltung. Hinzu treten
Gründe aus der unserer besonderen Wissenschaft augenblicklich zu-
kommenden Beschaffenheit, aber auch aus ihrer bleibenden Verfas-
sung. Ihnen ist der Hauptteil meiner Abhandlung gewidmet. Das
Dasein solcher Gründe macht nämlich im Einzelfall die Zweifelslehre
zu einer besonders beachtenswerten Richtung. Schon Protagoras hat
seinen Satz, daß es über die Götter keine Vernunfterkenntnis gebe,
mit objektiven Verhältnissen — mit der Dunkelheit der Sache und der
Kürze des menschlichen Lebens — zu rechtfertigen für nötig erachtet.
Zahllose Erfahrungen führten die Skeptiker zu ihrem zweifach ge-
formten Endergebnis, das die »Pyrrhonischen Grundzüge« folgender-
maßen aussprechen: »Gleichkräftigkeit nennen wir die Gleichheit in
Glaubwürdigkeit und Unglaubwürdigkeit, so daß keine von den
streitenden Behauptungen der anderen als glaubwürdiger voransteht;
Zurückhaltung ist ein Stillestehen der Einsicht, infolge wovon wir
weder etwas verneinen noch bejahen.« Auf einer genauen Kenntnis
der kirchlichen Lehren ruht Abälards berühmtes Sic et non, ein Ein-
spruch gegen allzu schnelles Fertigsein in theologischen Angelegen-
heiten; nicht leichtsinnig, sondern im Besitz einer weiten Übersicht
spricht Bayle von der letztlich unlösbaren Verwicklung philosophischer
Probleme. Ein ähnlicher Standpunkt läßt sich innerhalb der Ästhetik
aus Beobachtungen und Erwägungen gewinnen, die wir nachher ge-
meinsam anstellen wollen; übrigens sei auf das Prinzipienkapitel meines
Buches verwiesen, das gewissermaßen einen Friedhof für voreilige
naiven Glauben besitzen, um die überlieferte Sicherheit der Theorie-
und Systembildung aller Orten festhalten zu können. In Wahles Buch
über das Ganze der Philosophie, in Simmeis Einleitung in die Moral-
wissenschaft, in Diltheys Abhandlung über pädagogische Wissenschaft,
in der Schrift von P. J. Möbius über die Hoffnungslosigkeit der Psycho-
logie — in diesen so verschiedenartigen und nur beispielsweise heraus-
gegriffenen Darlegungen finden wir die gleiche Stimmung. Freilich
stehen daneben genug selbstsichere Werke, deren Urheber sich der
Bedrängtheit des jetzt und so Denkenden überlegen wähnen. Meist
jedoch sind sie im schlechten Sinne zeitlos, d. h. ohne Zusammenhang
mit der Eigenart unserer Kultur. Und gerade für Ästhetik und Kunst-
wissenschaft bedeutet das einen empfindlichen Nachteil, da eine ihrer
Voraussetzungen der Sinn für ästhetisches Leben und für Kunst ist
und dieser Sinn ohne nahe Berührung mit der Umgebung nicht ge-
deiht. Man wird bemerken, daß Ästhetiker, die ihre Beispiele vor-
nehmlich aus der Gegenwart schöpfen, am weitesten von jedem Dog-
matismus abrücken.
Die Bewußtseinslage der Zeit veranlaßt den, der wahrhaft an ihr
teil hat, schließlich zur knoyr\ oder Urteilsenthaltung. Hinzu treten
Gründe aus der unserer besonderen Wissenschaft augenblicklich zu-
kommenden Beschaffenheit, aber auch aus ihrer bleibenden Verfas-
sung. Ihnen ist der Hauptteil meiner Abhandlung gewidmet. Das
Dasein solcher Gründe macht nämlich im Einzelfall die Zweifelslehre
zu einer besonders beachtenswerten Richtung. Schon Protagoras hat
seinen Satz, daß es über die Götter keine Vernunfterkenntnis gebe,
mit objektiven Verhältnissen — mit der Dunkelheit der Sache und der
Kürze des menschlichen Lebens — zu rechtfertigen für nötig erachtet.
Zahllose Erfahrungen führten die Skeptiker zu ihrem zweifach ge-
formten Endergebnis, das die »Pyrrhonischen Grundzüge« folgender-
maßen aussprechen: »Gleichkräftigkeit nennen wir die Gleichheit in
Glaubwürdigkeit und Unglaubwürdigkeit, so daß keine von den
streitenden Behauptungen der anderen als glaubwürdiger voransteht;
Zurückhaltung ist ein Stillestehen der Einsicht, infolge wovon wir
weder etwas verneinen noch bejahen.« Auf einer genauen Kenntnis
der kirchlichen Lehren ruht Abälards berühmtes Sic et non, ein Ein-
spruch gegen allzu schnelles Fertigsein in theologischen Angelegen-
heiten; nicht leichtsinnig, sondern im Besitz einer weiten Übersicht
spricht Bayle von der letztlich unlösbaren Verwicklung philosophischer
Probleme. Ein ähnlicher Standpunkt läßt sich innerhalb der Ästhetik
aus Beobachtungen und Erwägungen gewinnen, die wir nachher ge-
meinsam anstellen wollen; übrigens sei auf das Prinzipienkapitel meines
Buches verwiesen, das gewissermaßen einen Friedhof für voreilige