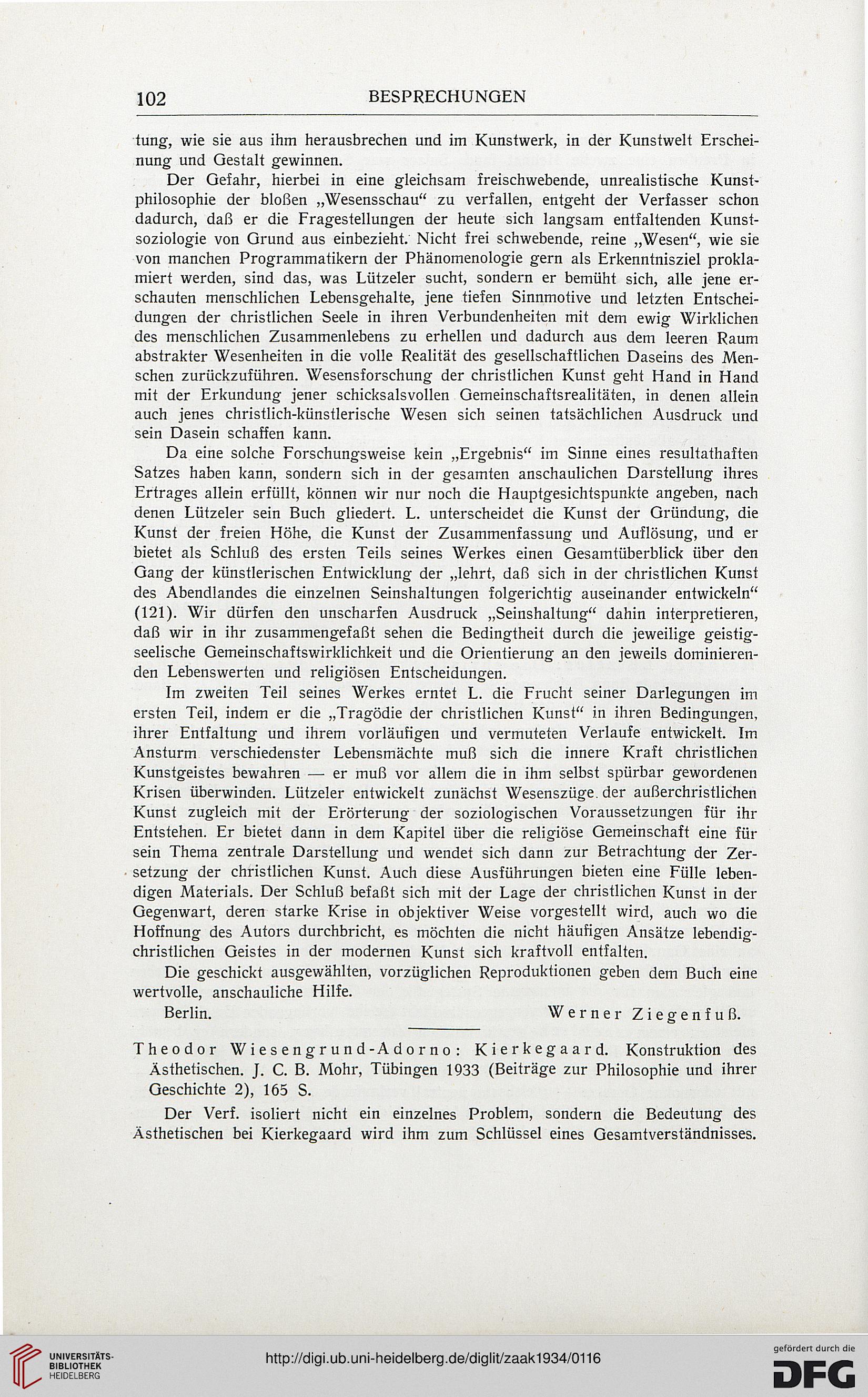102
BESPRECHUNGEN
tung, wie sie aus ihm herausbrechen und im Kunstwerk, in der Kunstwelt Erschei-
nung und Gestalt gewinnen.
Der Gefahr, hierbei in eine gleichsam freischwebende, unrealistische Kunst-
philosophie der bloßen „Wesensschau" zu verfallen, entgeht der Verfasser schon
dadurch, daß er die Fragestellungen der heute sich langsam entfaltenden Kunst-
soziologie von Grund aus einbezieht. Nicht frei schwebende, reine „Wesen", wie sie
von manchen Programmatikern der Phänomenologie gern als Erkenntnisziel prokla-
miert werden, sind das, was Lützeler sucht, sondern er bemüht sich, alle jene er-
schauten menschlichen Lebensgehalte, jene tiefen Sinnmotive und letzten Entschei-
dungen der christlichen Seele in ihren Verbundenheiten mit dem ewig Wirklichen
des menschlichen Zusammenlebens zu erhellen und dadurch aus dem leeren Raum
abstrakter Wesenheiten in die volle Realität des gesellschaftlichen Daseins des Men-
schen zurückzuführen. Wesensforschung der christlichen Kunst geht Hand in Hand
mit der Erkundung jener schicksalsvollen Gemeinschaftsrealitäten, in denen allein
auch jenes christlich-künstlerische Wesen sich seinen tatsächlichen Ausdruck und
sein Dasein scharfen kann.
Da eine solche Forschungsweise kein „Ergebnis" im Sinne eines resultathaften
Satzes haben kann, sondern sich in der gesamten anschaulichen Darstellung ihres
Ertrages allein erfüllt, können wir nur noch die Hauptgesichtspunkte angeben, nach
denen Lützeler sein Buch gliedert. L. unterscheidet die Kunst der Gründung, die
Kunst der freien Höhe, die Kunst der Zusammenfassung und Auflösung, und er
bietet als Schluß des ersten Teils seines Werkes einen Gesamtüberblick über den
Gang der künstlerischen Entwicklung der „lehrt, daß sich in der christlichen Kunst
des Abendlandes die einzelnen Seinshaltungen folgerichtig auseinander entwickeln"
(121). Wir dürfen den unscharfen Ausdruck „Seinshaltung" dahin interpretieren,
daß wir in ihr zusammengefaßt sehen die Bedingtheit durch die jeweilige geistig-
seelische Gemeinschaftswirklichkeit und die Orientierung an den jeweils dominieren-
den Lebenswerten und religiösen Entscheidungen.
Im zweiten Teil seines Werkes erntet L. die Frucht seiner Darlegungen im
ersten Teil, indem er die „Tragödie der christlichen Kunst" in ihren Bedingungen,
ihrer Entfaltung und ihrem vorläufigen und vermuteten Verlaufe entwickelt. Im
Ansturm verschiedenster Lebensmächte muß sich die innere Kraft christlichen
Kunstgeistes bewahren — er muß vor allem die in ihm selbst spürbar gewordenen
Krisen überwinden. Lützeler entwickelt zunächst Wesenszüge, der außerchristlichen
Kunst zugleich mit der Erörterung der soziologischen Voraussetzungen für ihr
Entstehen. Er bietet dann in dem Kapitel über die religiöse Gemeinschaft eine für
sein Thema zentrale Darstellung und wendet sich dann zur Betrachtung der Zer-
setzung der christlichen Kunst. Auch diese Ausführungen bieten eine Fülle leben-
digen Materials. Der Schluß befaßt sich mit der Lage der christlichen Kunst in der
Gegenwart, deren starke Krise in objektiver Weise vorgestellt wird, auch wo die
Hoffnung des Autors durchbricht, es möchten die nicht häufigen Ansätze lebendig-
christlichen Geistes in der modernen Kunst sich kraftvoll entfalten.
Die geschickt ausgewählten, vorzüglichen Reproduktionen geben dem Buch eine
wertvolle, anschauliche Hilfe.
Berlin. Werner Z i e g e n f u ß.
Theodor Wiesengrund-Adorno: Kierkegaard. Konstruktion des
Ästhetischen. J. C. B. Mohr, Tübingen 1933 (Beiträge zur Philosophie und ihrer
Geschichte 2), 165 S.
Der Verf. isoliert nicht ein einzelnes Problem, sondern die Bedeutung des
Ästhetischen bei Kierkegaard wird ihm zum Schlüssel eines Gesamtverständnisses.
BESPRECHUNGEN
tung, wie sie aus ihm herausbrechen und im Kunstwerk, in der Kunstwelt Erschei-
nung und Gestalt gewinnen.
Der Gefahr, hierbei in eine gleichsam freischwebende, unrealistische Kunst-
philosophie der bloßen „Wesensschau" zu verfallen, entgeht der Verfasser schon
dadurch, daß er die Fragestellungen der heute sich langsam entfaltenden Kunst-
soziologie von Grund aus einbezieht. Nicht frei schwebende, reine „Wesen", wie sie
von manchen Programmatikern der Phänomenologie gern als Erkenntnisziel prokla-
miert werden, sind das, was Lützeler sucht, sondern er bemüht sich, alle jene er-
schauten menschlichen Lebensgehalte, jene tiefen Sinnmotive und letzten Entschei-
dungen der christlichen Seele in ihren Verbundenheiten mit dem ewig Wirklichen
des menschlichen Zusammenlebens zu erhellen und dadurch aus dem leeren Raum
abstrakter Wesenheiten in die volle Realität des gesellschaftlichen Daseins des Men-
schen zurückzuführen. Wesensforschung der christlichen Kunst geht Hand in Hand
mit der Erkundung jener schicksalsvollen Gemeinschaftsrealitäten, in denen allein
auch jenes christlich-künstlerische Wesen sich seinen tatsächlichen Ausdruck und
sein Dasein scharfen kann.
Da eine solche Forschungsweise kein „Ergebnis" im Sinne eines resultathaften
Satzes haben kann, sondern sich in der gesamten anschaulichen Darstellung ihres
Ertrages allein erfüllt, können wir nur noch die Hauptgesichtspunkte angeben, nach
denen Lützeler sein Buch gliedert. L. unterscheidet die Kunst der Gründung, die
Kunst der freien Höhe, die Kunst der Zusammenfassung und Auflösung, und er
bietet als Schluß des ersten Teils seines Werkes einen Gesamtüberblick über den
Gang der künstlerischen Entwicklung der „lehrt, daß sich in der christlichen Kunst
des Abendlandes die einzelnen Seinshaltungen folgerichtig auseinander entwickeln"
(121). Wir dürfen den unscharfen Ausdruck „Seinshaltung" dahin interpretieren,
daß wir in ihr zusammengefaßt sehen die Bedingtheit durch die jeweilige geistig-
seelische Gemeinschaftswirklichkeit und die Orientierung an den jeweils dominieren-
den Lebenswerten und religiösen Entscheidungen.
Im zweiten Teil seines Werkes erntet L. die Frucht seiner Darlegungen im
ersten Teil, indem er die „Tragödie der christlichen Kunst" in ihren Bedingungen,
ihrer Entfaltung und ihrem vorläufigen und vermuteten Verlaufe entwickelt. Im
Ansturm verschiedenster Lebensmächte muß sich die innere Kraft christlichen
Kunstgeistes bewahren — er muß vor allem die in ihm selbst spürbar gewordenen
Krisen überwinden. Lützeler entwickelt zunächst Wesenszüge, der außerchristlichen
Kunst zugleich mit der Erörterung der soziologischen Voraussetzungen für ihr
Entstehen. Er bietet dann in dem Kapitel über die religiöse Gemeinschaft eine für
sein Thema zentrale Darstellung und wendet sich dann zur Betrachtung der Zer-
setzung der christlichen Kunst. Auch diese Ausführungen bieten eine Fülle leben-
digen Materials. Der Schluß befaßt sich mit der Lage der christlichen Kunst in der
Gegenwart, deren starke Krise in objektiver Weise vorgestellt wird, auch wo die
Hoffnung des Autors durchbricht, es möchten die nicht häufigen Ansätze lebendig-
christlichen Geistes in der modernen Kunst sich kraftvoll entfalten.
Die geschickt ausgewählten, vorzüglichen Reproduktionen geben dem Buch eine
wertvolle, anschauliche Hilfe.
Berlin. Werner Z i e g e n f u ß.
Theodor Wiesengrund-Adorno: Kierkegaard. Konstruktion des
Ästhetischen. J. C. B. Mohr, Tübingen 1933 (Beiträge zur Philosophie und ihrer
Geschichte 2), 165 S.
Der Verf. isoliert nicht ein einzelnes Problem, sondern die Bedeutung des
Ästhetischen bei Kierkegaard wird ihm zum Schlüssel eines Gesamtverständnisses.