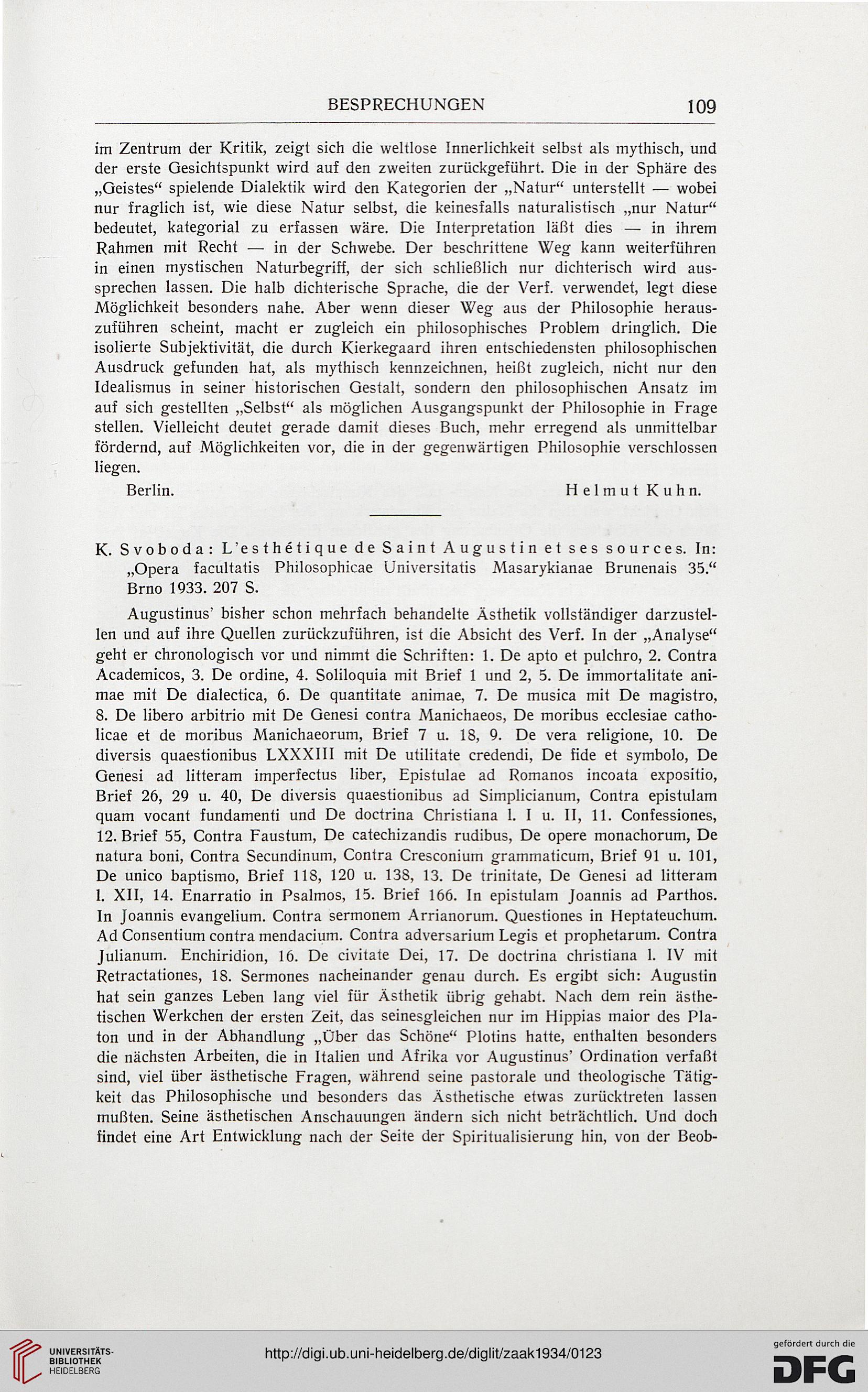BESPRECHUNGEN
109
im Zentrum der Kritik, zeigt sich die weltlose Innerlichkeit selbst als mythisch, und
der erste Gesichtspunkt wird auf den zweiten zurückgeführt. Die in der Sphäre des
„Geistes" spielende Dialektik wird den Kategorien der „Natur" unterstellt — wobei
nur fraglich ist, wie diese Natur selbst, die keinesfalls naturalistisch „nur Natur"
bedeutet, kategorial zu erfassen wäre. Die Interpretation läßt dies — in ihrem
Rahmen mit Recht — in der Schwebe. Der beschrittene Weg kann weiterführen
in einen mystischen Naturbegriff, der sich schließlich nur dichterisch wird aus-
sprechen lassen. Die halb dichterische Sprache, die der Verf. verwendet, legt diese
Möglichkeit besonders nahe. Aber wenn dieser Weg aus der Philosophie heraus-
zuführen scheint, macht er zugleich ein philosophisches Problem dringlich. Die
isolierte Subjektivität, die durch Kierkegaard ihren entschiedensten philosophischen
Ausdruck gefunden hat, als mythisch kennzeichnen, heißt zugleich, nicht nur den
Idealismus in seiner historischen Gestalt, sondern den philosophischen Ansatz im
auf sich gestellten „Selbst" als möglichen Ausgangspunkt der Philosophie in Frage
stellen. Vielleicht deutet gerade damit dieses Buch, mehr erregend als unmittelbar
fördernd, auf Möglichkeiten vor, die in der gegenwärtigen Philosophie verschlossen
liegen.
Berlin. Helmut Kuhn.
K. Svoboda: L'esthetique de Saint Augustin et ses sources. In:
„Opera facultatis Philosophicae Universitatis Masarykianae Brunenais 35."
Brno 1933. 207 S.
Augustinus' bisher schon mehrfach behandelte Ästhetik vollständiger darzustel-
len und auf ihre Quellen zurückzuführen, ist die Absicht des Verf. In der „Analyse"
geht er chronologisch vor und nimmt die Schriften: 1. De apto et pulchro, 2. Contra
Academicos, 3. De ordine, 4. Soliloquia mit Brief 1 und 2, 5. De immortalitate ani-
mae mit De dialectica, 6. De quantitate animae, 7. De musica mit De magistro,
8. De libero arbitrio mit De Genesi contra Manichaeos, De moribus ecclesiae catho-
Iicae et de moribus Manichaeorum, Brief 7 u. 18, 9. De vera religione, 10. De
diversis quaestionibus LXXXIII mit De utilitate credendi, De fide et symbolo, De
Genesi ad litteram imperfectus über, Epistulae ad Romanos incoata expositio,
Brief 26, 29 u. 40, De diversis quaestionibus ad Simplicianum, Contra epistulam
quam vocant fundamenti und De doctrina Christiana 1. I u. II, 11. Confessiones,
12. Brief 55, Contra Faustum, De catechizandis rudibus, De opere monachorum, De
natura boni, Contra Secundinum, Contra Cresconium grammaticum, Brief 91 u. 101,
De unico baptismo, Brief 118, 120 u. 138, 13. De trinitate, De Genesi ad litteram
1. XII, 14. Enarratio in Psalmos, 15. Brief 166. In epistulam Joannis ad Parthos.
In Joannis evangelium. Contra sermonem Arrianorum. Questiones in Heptateuchum.
Ad Consentium contra mendacium. Contra adversarium Legis et prophetarum. Contra
Julianum. Enchiridion, 16. De civitate Dei, 17. De doctrina christiana 1. IV mit
Retractationes, 18. Sermones nacheinander genau durch. Es ergibt sich: Augustin
hat sein ganzes Leben lang viel für Ästhetik übrig gehabt. Nach dem rein ästhe-
tischen Werkchen der ersten Zeit, das seinesgleichen nur im Hippias maior des Pia-
ton und in der Abhandlung „Ober das Schöne" Plotins hatte, enthalten besonders
die nächsten Arbeiten, die in Italien und Afrika vor Augustinus' Ordination verfaßt
sind, viel über ästhetische Fragen, während seine pastorale und theologische Tätig-
keit das Philosophische und besonders das Ästhetische etwas zurücktreten lassen
mußten. Seine ästhetischen Anschauungen ändern sich nicht beträchtlich. Und doch
findet eine Art Entwicklung nach der Seite der Spiritualisierung hin, von der Beob-
109
im Zentrum der Kritik, zeigt sich die weltlose Innerlichkeit selbst als mythisch, und
der erste Gesichtspunkt wird auf den zweiten zurückgeführt. Die in der Sphäre des
„Geistes" spielende Dialektik wird den Kategorien der „Natur" unterstellt — wobei
nur fraglich ist, wie diese Natur selbst, die keinesfalls naturalistisch „nur Natur"
bedeutet, kategorial zu erfassen wäre. Die Interpretation läßt dies — in ihrem
Rahmen mit Recht — in der Schwebe. Der beschrittene Weg kann weiterführen
in einen mystischen Naturbegriff, der sich schließlich nur dichterisch wird aus-
sprechen lassen. Die halb dichterische Sprache, die der Verf. verwendet, legt diese
Möglichkeit besonders nahe. Aber wenn dieser Weg aus der Philosophie heraus-
zuführen scheint, macht er zugleich ein philosophisches Problem dringlich. Die
isolierte Subjektivität, die durch Kierkegaard ihren entschiedensten philosophischen
Ausdruck gefunden hat, als mythisch kennzeichnen, heißt zugleich, nicht nur den
Idealismus in seiner historischen Gestalt, sondern den philosophischen Ansatz im
auf sich gestellten „Selbst" als möglichen Ausgangspunkt der Philosophie in Frage
stellen. Vielleicht deutet gerade damit dieses Buch, mehr erregend als unmittelbar
fördernd, auf Möglichkeiten vor, die in der gegenwärtigen Philosophie verschlossen
liegen.
Berlin. Helmut Kuhn.
K. Svoboda: L'esthetique de Saint Augustin et ses sources. In:
„Opera facultatis Philosophicae Universitatis Masarykianae Brunenais 35."
Brno 1933. 207 S.
Augustinus' bisher schon mehrfach behandelte Ästhetik vollständiger darzustel-
len und auf ihre Quellen zurückzuführen, ist die Absicht des Verf. In der „Analyse"
geht er chronologisch vor und nimmt die Schriften: 1. De apto et pulchro, 2. Contra
Academicos, 3. De ordine, 4. Soliloquia mit Brief 1 und 2, 5. De immortalitate ani-
mae mit De dialectica, 6. De quantitate animae, 7. De musica mit De magistro,
8. De libero arbitrio mit De Genesi contra Manichaeos, De moribus ecclesiae catho-
Iicae et de moribus Manichaeorum, Brief 7 u. 18, 9. De vera religione, 10. De
diversis quaestionibus LXXXIII mit De utilitate credendi, De fide et symbolo, De
Genesi ad litteram imperfectus über, Epistulae ad Romanos incoata expositio,
Brief 26, 29 u. 40, De diversis quaestionibus ad Simplicianum, Contra epistulam
quam vocant fundamenti und De doctrina Christiana 1. I u. II, 11. Confessiones,
12. Brief 55, Contra Faustum, De catechizandis rudibus, De opere monachorum, De
natura boni, Contra Secundinum, Contra Cresconium grammaticum, Brief 91 u. 101,
De unico baptismo, Brief 118, 120 u. 138, 13. De trinitate, De Genesi ad litteram
1. XII, 14. Enarratio in Psalmos, 15. Brief 166. In epistulam Joannis ad Parthos.
In Joannis evangelium. Contra sermonem Arrianorum. Questiones in Heptateuchum.
Ad Consentium contra mendacium. Contra adversarium Legis et prophetarum. Contra
Julianum. Enchiridion, 16. De civitate Dei, 17. De doctrina christiana 1. IV mit
Retractationes, 18. Sermones nacheinander genau durch. Es ergibt sich: Augustin
hat sein ganzes Leben lang viel für Ästhetik übrig gehabt. Nach dem rein ästhe-
tischen Werkchen der ersten Zeit, das seinesgleichen nur im Hippias maior des Pia-
ton und in der Abhandlung „Ober das Schöne" Plotins hatte, enthalten besonders
die nächsten Arbeiten, die in Italien und Afrika vor Augustinus' Ordination verfaßt
sind, viel über ästhetische Fragen, während seine pastorale und theologische Tätig-
keit das Philosophische und besonders das Ästhetische etwas zurücktreten lassen
mußten. Seine ästhetischen Anschauungen ändern sich nicht beträchtlich. Und doch
findet eine Art Entwicklung nach der Seite der Spiritualisierung hin, von der Beob-