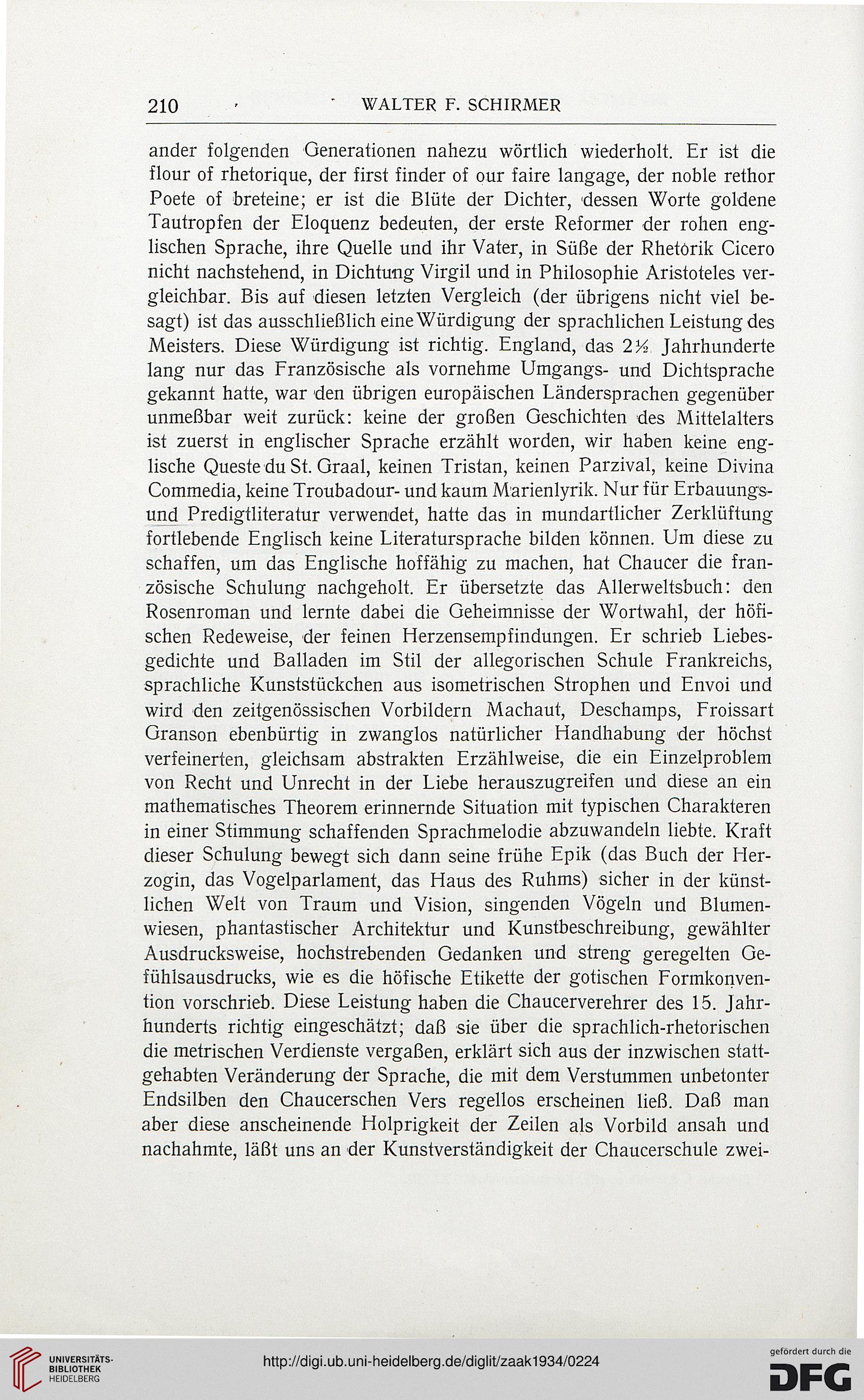210
WALTER F. SCHIRMER
ander folgenden Generationen nahezu wörtlich wiederholt. Er ist die
flour of rhetorique, der first finder of our faire langage, der noble rethor
Poete of breteine; er ist die Blüte der Dichter, 'dessen Worte goldene
Tautropfen der Eloquenz bedeuten, der erste Reformer der rohen eng-
lischen Sprache, ihre Quelle und ihr Vater, in Süße der Rhetorik Cicero
nicht nachstehend, in Dichtung Virgil und in Philosophie Aristoteles ver-
gleichbar. Bis auf diesen letzten Vergleich (der übrigens nicht viel be-
sagt) ist das ausschließlich eine Würdigung der sprachlichen Leistung des
Meisters. Diese Würdigung ist richtig. England, das 2% Jahrhunderte
lang nur das Französische als vornehme Umgangs- und Dichtsprache
gekannt hatte, war den übrigen europäischen Ländersprachen gegenüber
unmeßbar weit zurück: keine der großen Geschichten des Mittelalters
ist zuerst in englischer Sprache erzählt worden, wir haben keine eng-
lische Queste du St. Graal, keinen Tristan, keinen Parzival, keine Divina
Commedia, keine Troubadour- und kaum Marienlyrik. Nur für Erbauungs-
und Predigtliteratur verwendet, hatte das in mundartlicher Zerklüftung
fortlebende Englisch keine Literatursprache bilden können. Um diese zu
schaffen, um das Englische hoffähig zu machen, hat Chaucer die fran-
zösische Schulung nachgeholt. Er übersetzte das Allerweltsbuch: den
Rosenroman und lernte dabei die Geheimnisse der Wortwahl, der höfi-
schen Redeweise, der feinen Herzensempfindungen. Er schrieb Liebes-
gedichte und Balladen im Stil der allegorischen Schule Frankreichs,
sprachliche Kunststückchen aus isometrischen Strophen und Envoi und
wird den zeitgenössischen Vorbildern Machaut, Deschamps, Froissart
Granson ebenbürtig in zwanglos natürlicher Handhabung der höchst
verfeinerten, gleichsam abstrakten Erzählweise, die ein Einzelproblem
von Recht und Unrecht in der Liebe herauszugreifen und diese an ein
mathematisches Theorem erinnernde Situation mit typischen Charakteren
in einer Stimmung schaffenden Sprachmelodie abzuwandeln liebte. Kraft
dieser Schulung bewegt sich dann seine frühe Epik (das Buch der Her-
zogin, das Vogelparlament, das Haus des Ruhms) sicher in der künst-
lichen Welt von Traum und Vision, singenden Vögeln und Blumen-
wiesen, phantastischer Architektur und Kunstbeschreibung, gewählter
Ausdrucksweise, hochstrebenden Gedanken und streng geregelten Ge-
fühlsausdrucks, wie es die höfische Etikette der gotischen Formkonven-
tion vorschrieb. Diese Leistung haben die Chaucerverehrer des 15. Jahr-
hunderts richtig eingeschätzt; daß sie über die sprachlich-rhetorischen
die metrischen Verdienste vergaßen, erklärt sich aus der inzwischen statt-
gehabten Veränderung der Sprache, die mit dem Verstummen unbetonter
Endsilben den Chaucerschen Vers regellos erscheinen ließ. Daß man
aber diese anscheinende Holprigkeit der Zeilen als Vorbild ansah und
nachahmte, läßt uns an der Kunstverständigkeit der Chaucerschule zwei-
WALTER F. SCHIRMER
ander folgenden Generationen nahezu wörtlich wiederholt. Er ist die
flour of rhetorique, der first finder of our faire langage, der noble rethor
Poete of breteine; er ist die Blüte der Dichter, 'dessen Worte goldene
Tautropfen der Eloquenz bedeuten, der erste Reformer der rohen eng-
lischen Sprache, ihre Quelle und ihr Vater, in Süße der Rhetorik Cicero
nicht nachstehend, in Dichtung Virgil und in Philosophie Aristoteles ver-
gleichbar. Bis auf diesen letzten Vergleich (der übrigens nicht viel be-
sagt) ist das ausschließlich eine Würdigung der sprachlichen Leistung des
Meisters. Diese Würdigung ist richtig. England, das 2% Jahrhunderte
lang nur das Französische als vornehme Umgangs- und Dichtsprache
gekannt hatte, war den übrigen europäischen Ländersprachen gegenüber
unmeßbar weit zurück: keine der großen Geschichten des Mittelalters
ist zuerst in englischer Sprache erzählt worden, wir haben keine eng-
lische Queste du St. Graal, keinen Tristan, keinen Parzival, keine Divina
Commedia, keine Troubadour- und kaum Marienlyrik. Nur für Erbauungs-
und Predigtliteratur verwendet, hatte das in mundartlicher Zerklüftung
fortlebende Englisch keine Literatursprache bilden können. Um diese zu
schaffen, um das Englische hoffähig zu machen, hat Chaucer die fran-
zösische Schulung nachgeholt. Er übersetzte das Allerweltsbuch: den
Rosenroman und lernte dabei die Geheimnisse der Wortwahl, der höfi-
schen Redeweise, der feinen Herzensempfindungen. Er schrieb Liebes-
gedichte und Balladen im Stil der allegorischen Schule Frankreichs,
sprachliche Kunststückchen aus isometrischen Strophen und Envoi und
wird den zeitgenössischen Vorbildern Machaut, Deschamps, Froissart
Granson ebenbürtig in zwanglos natürlicher Handhabung der höchst
verfeinerten, gleichsam abstrakten Erzählweise, die ein Einzelproblem
von Recht und Unrecht in der Liebe herauszugreifen und diese an ein
mathematisches Theorem erinnernde Situation mit typischen Charakteren
in einer Stimmung schaffenden Sprachmelodie abzuwandeln liebte. Kraft
dieser Schulung bewegt sich dann seine frühe Epik (das Buch der Her-
zogin, das Vogelparlament, das Haus des Ruhms) sicher in der künst-
lichen Welt von Traum und Vision, singenden Vögeln und Blumen-
wiesen, phantastischer Architektur und Kunstbeschreibung, gewählter
Ausdrucksweise, hochstrebenden Gedanken und streng geregelten Ge-
fühlsausdrucks, wie es die höfische Etikette der gotischen Formkonven-
tion vorschrieb. Diese Leistung haben die Chaucerverehrer des 15. Jahr-
hunderts richtig eingeschätzt; daß sie über die sprachlich-rhetorischen
die metrischen Verdienste vergaßen, erklärt sich aus der inzwischen statt-
gehabten Veränderung der Sprache, die mit dem Verstummen unbetonter
Endsilben den Chaucerschen Vers regellos erscheinen ließ. Daß man
aber diese anscheinende Holprigkeit der Zeilen als Vorbild ansah und
nachahmte, läßt uns an der Kunstverständigkeit der Chaucerschule zwei-