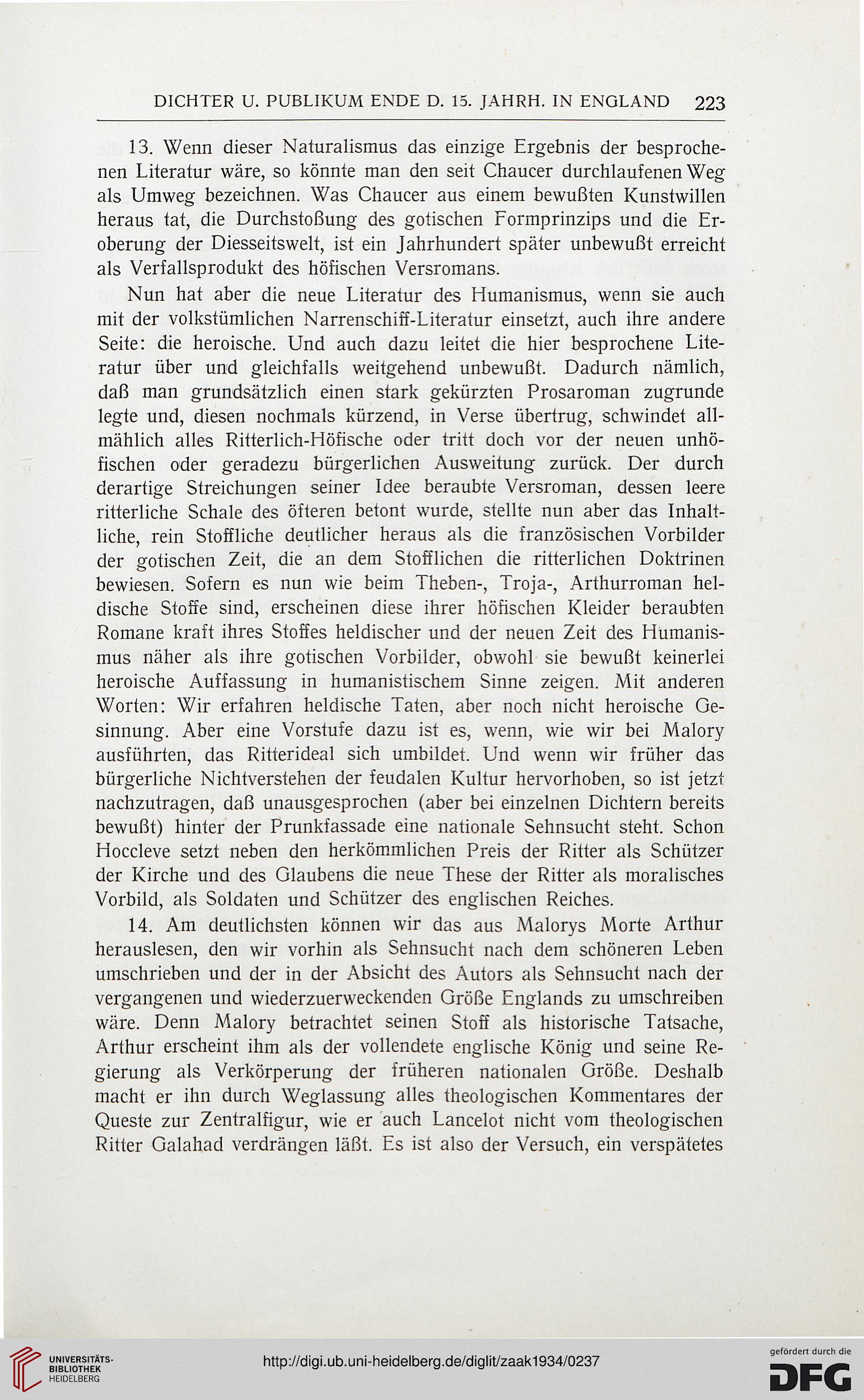DICHTER U. PUBLIKUM ENDE D. 15. JAHRH. IN ENGLAND 223
13. Wenn dieser Naturalismus das einzige Ergebnis der besproche-
nen Literatur wäre, so könnte man den seit Chaucer durchlaufenen Weg
als Umweg bezeichnen. Was Chaucer aus einem bewußten Kunstwillen
heraus tat, die Durchstoßung des gotischen Formprinzips und die Er-
oberung der Diesseitswelt, ist ein Jahrhundert später unbewußt erreicht
als Verfallsprodukt des höfischen Versromans.
Nun hat aber die neue Literatur des Humanismus, wenn sie auch
mit der volkstümlichen Narrenschiff-Literatur einsetzt, auch ihre andere
Seite: die heroische. Und auch dazu leitet die hier besprochene Lite-
ratur über und gleichfalls weitgehend unbewußt. Dadurch nämlich,
daß man grundsätzlich einen stark gekürzten Prosaroman zugrunde
legte und, diesen nochmals kürzend, in Verse übertrug, schwindet all-
mählich alles Ritterlich-Höfische oder tritt doch vor der neuen unhö-
fischen oder geradezu bürgerlichen Ausweitung zurück. Der durch
derartige Streichungen seiner Idee beraubte Versroman, dessen leere
ritterliche Schale des öfteren betont wurde, stellte nun aber das Inhalt-
liche, rein Stoffliche deutlicher heraus als die französischen Vorbilder
der gotischen Zeit, die an dem Stofflichen die ritterlichen Doktrinen
bewiesen. Sofern es nun wie beim Theben-, Troja-, Arthurroman hel-
dische Stoffe sind, erscheinen diese ihrer höfischen Kleider beraubten
Romane kraft ihres Stoffes heldischer und der neuen Zeit des Humanis-
mus näher als ihre gotischen Vorbilder, obwohl sie bewußt keinerlei
heroische Auffassung in humanistischem Sinne zeigen. Mit anderen
Worten: Wir erfahren heldische Taten, aber noch nicht heroische Oe-
sinnung. Aber eine Vorstufe dazu ist es, wenn, wie wir bei Malory
ausführten, das Ritterideal sich umbildet. Und wenn wir früher das
bürgerliche Nichtverstehen der feudalen Kultur hervorhoben, so ist jetzt
nachzutragen, daß unausgesprochen (aber bei einzelnen Dichtern bereits
bewußt) hinter der Prunkfassade eine nationale Sehnsucht steht. Schon
Hoccleve setzt neben den herkömmlichen Preis der Ritter als Schützer
der Kirche und des Glaubens die neue These der Ritter als moralisches
Vorbild, als Soldaten und Schützer des englischen Reiches.
14. Am deutlichsten können wir das aus Malorys Morte Arthur
herauslesen, den wir vorhin als Sehnsucht nach dem schöneren Leben
umschrieben und der in der Absicht des Autors als Sehnsucht nach der
vergangenen und wiederzuerweckenden Größe Englands zu umschreiben
wäre. Denn Malory betrachtet seinen Stoff als historische Tatsache,
Arthur erscheint ihm als der vollendete englische König und seine Re-
gierung als Verkörperung der früheren nationalen Größe. Deshalb
macht er ihn durch Weglassung alles theologischen Kommentares der
Queste zur Zentralfigur, wie er auch Lancelot nicht vom theologischen
Ritter Galahad verdrängen läßt. Es ist also der Versuch, ein verspätetes
13. Wenn dieser Naturalismus das einzige Ergebnis der besproche-
nen Literatur wäre, so könnte man den seit Chaucer durchlaufenen Weg
als Umweg bezeichnen. Was Chaucer aus einem bewußten Kunstwillen
heraus tat, die Durchstoßung des gotischen Formprinzips und die Er-
oberung der Diesseitswelt, ist ein Jahrhundert später unbewußt erreicht
als Verfallsprodukt des höfischen Versromans.
Nun hat aber die neue Literatur des Humanismus, wenn sie auch
mit der volkstümlichen Narrenschiff-Literatur einsetzt, auch ihre andere
Seite: die heroische. Und auch dazu leitet die hier besprochene Lite-
ratur über und gleichfalls weitgehend unbewußt. Dadurch nämlich,
daß man grundsätzlich einen stark gekürzten Prosaroman zugrunde
legte und, diesen nochmals kürzend, in Verse übertrug, schwindet all-
mählich alles Ritterlich-Höfische oder tritt doch vor der neuen unhö-
fischen oder geradezu bürgerlichen Ausweitung zurück. Der durch
derartige Streichungen seiner Idee beraubte Versroman, dessen leere
ritterliche Schale des öfteren betont wurde, stellte nun aber das Inhalt-
liche, rein Stoffliche deutlicher heraus als die französischen Vorbilder
der gotischen Zeit, die an dem Stofflichen die ritterlichen Doktrinen
bewiesen. Sofern es nun wie beim Theben-, Troja-, Arthurroman hel-
dische Stoffe sind, erscheinen diese ihrer höfischen Kleider beraubten
Romane kraft ihres Stoffes heldischer und der neuen Zeit des Humanis-
mus näher als ihre gotischen Vorbilder, obwohl sie bewußt keinerlei
heroische Auffassung in humanistischem Sinne zeigen. Mit anderen
Worten: Wir erfahren heldische Taten, aber noch nicht heroische Oe-
sinnung. Aber eine Vorstufe dazu ist es, wenn, wie wir bei Malory
ausführten, das Ritterideal sich umbildet. Und wenn wir früher das
bürgerliche Nichtverstehen der feudalen Kultur hervorhoben, so ist jetzt
nachzutragen, daß unausgesprochen (aber bei einzelnen Dichtern bereits
bewußt) hinter der Prunkfassade eine nationale Sehnsucht steht. Schon
Hoccleve setzt neben den herkömmlichen Preis der Ritter als Schützer
der Kirche und des Glaubens die neue These der Ritter als moralisches
Vorbild, als Soldaten und Schützer des englischen Reiches.
14. Am deutlichsten können wir das aus Malorys Morte Arthur
herauslesen, den wir vorhin als Sehnsucht nach dem schöneren Leben
umschrieben und der in der Absicht des Autors als Sehnsucht nach der
vergangenen und wiederzuerweckenden Größe Englands zu umschreiben
wäre. Denn Malory betrachtet seinen Stoff als historische Tatsache,
Arthur erscheint ihm als der vollendete englische König und seine Re-
gierung als Verkörperung der früheren nationalen Größe. Deshalb
macht er ihn durch Weglassung alles theologischen Kommentares der
Queste zur Zentralfigur, wie er auch Lancelot nicht vom theologischen
Ritter Galahad verdrängen läßt. Es ist also der Versuch, ein verspätetes