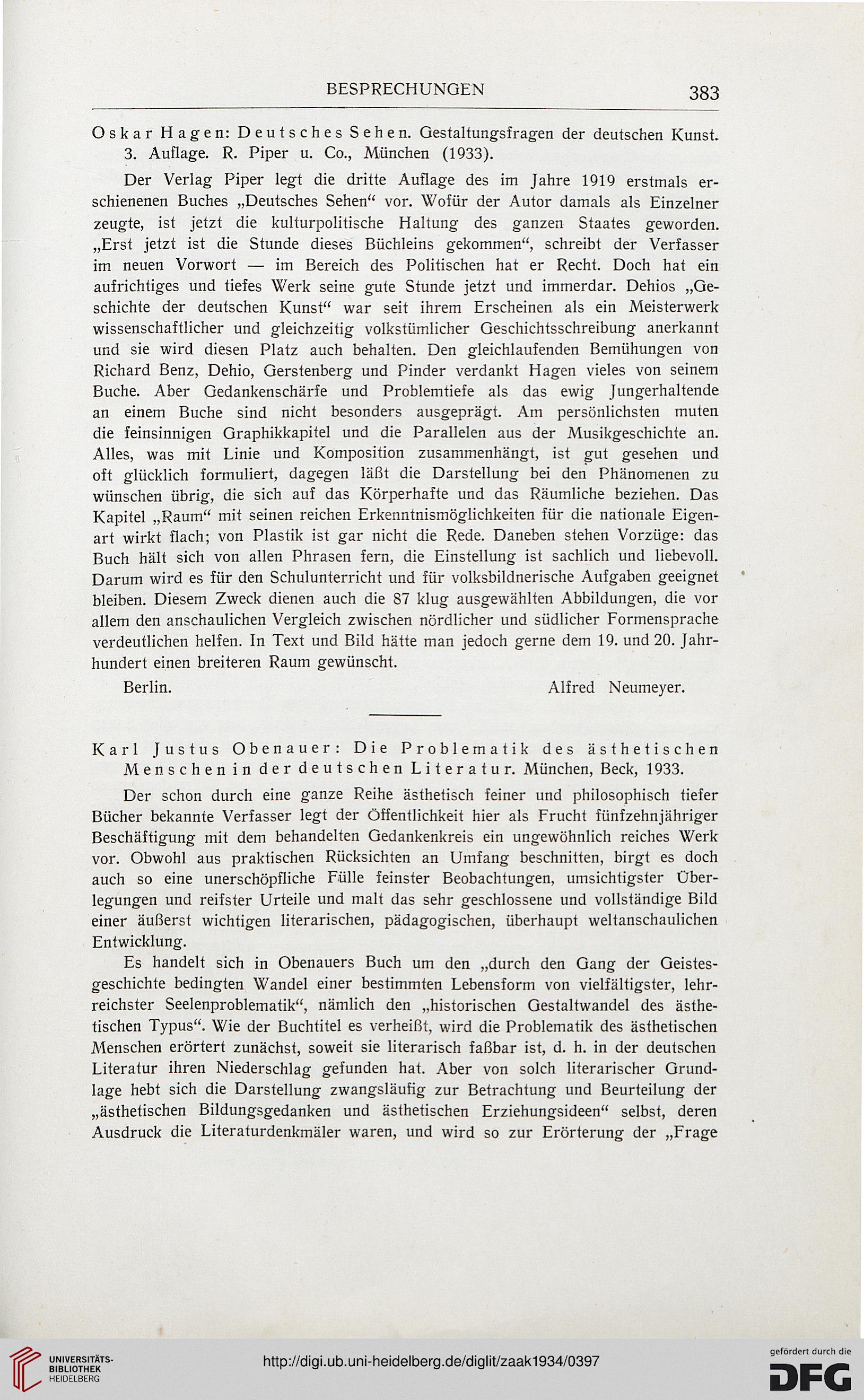BESPRECHUNGEN
383
Oskar Hagen: Deutsches Sehen. Gestaltungsfragen der deutschen Kunst.
3. Auflage. R. Piper u. Co., München (1933).
Der Verlag Piper legt die dritte Auflage des im Jahre 1919 erstmals er-
schienenen Buches „Deutsches Sehen" vor. Wofür der Autor damals als Einzelner
zeugte, ist jetzt die kulturpolitische Haltung des ganzen Staates geworden.
„Erst jetzt ist die Stunde dieses Büchleins gekommen", schreibt der Verfasser
im neuen Vorwort — im Bereich des Politischen hat er Recht. Doch hat ein
aufrichtiges und tiefes Werk seine gute Stunde jetzt und immerdar. Dehios „Ge-
schichte der deutschen Kunst" war seit ihrem Erscheinen als ein Meisterwerk
wissenschaftlicher und gleichzeitig volkstümlicher Geschichtsschreibung anerkannt
und sie wird diesen Platz auch behalten. Den gleichlaufenden Bemühungen von
Richard Benz, Dehio, Gerstenberg und Pinder verdankt Hagen vieles von seinem
Buche. Aber Gedankenschärfe und Problemtiefe als das ewig Jungerhaltende
an einem Buche sind nicht besonders ausgeprägt. Am persönlichsten muten
die feinsinnigen Graphikkapitel und die Parallelen aus der Musikgeschichte an.
Alles, was mit Linie und Komposition zusammenhängt, ist gut gesehen und
oft glücklich formuliert, dagegen läßt die Darstellung bei den Phänomenen zu
wünschen übrig, die sich auf das Körperhafte und das Räumliche beziehen. Das
Kapitel „Raum" mit seinen reichen Erkenntnismöglichkeiten für die nationale Eigen-
art wirkt flach; von Plastik ist gar nicht die Rede. Daneben stehen Vorzüge: das
Buch hält sich von allen Phrasen fern, die Einstellung ist sachlich und liebevoll.
Darum wird es für den Schulunterricht und für volksbildnerische Aufgaben geeignet
bleiben. Diesem Zweck dienen auch die 87 klug ausgewählten Abbildungen, die vor
allem den anschaulichen Vergleich zwischen nördlicher und südlicher Formensprache
verdeutlichen helfen. In Text und Bild hätte man jedoch gerne dem 19. und 20. Jahr-
hundert einen breiteren Raum gewünscht.
Berlin. Alfred Neumeyer.
Karl Justus Obenauer: Die Problematik des ästhetischen
Menschen in der deutschen Literatur. München, Beck, 1933.
Der schon durch eine ganze Reihe ästhetisch feiner und philosophisch tiefer
Bücher bekannte Verfasser legt der Öffentlichkeit hier als Frucht fünfzehnjähriger
Beschäftigung mit dem behandelten Gedankenkreis ein ungewöhnlich reiches Werk
vor. Obwohl aus praktischen Rücksichten an Umfang beschnitten, birgt es doch
auch so eine unerschöpfliche Fülle feinster Beobachtungen, umsichtigster Über-
legungen und reifster Urteile und malt das sehr geschlossene und vollständige Bild
einer äußerst wichtigen literarischen, pädagogischen, überhaupt weltanschaulichen
Entwicklung.
Es handelt sich in Obenauers Buch um den „durch den Gang der Geistes-
geschichte bedingten Wandel einer bestimmten Lebensform von vielfältigster, lehr-
reichster Seelenproblematik", nämlich den „historischen Gestaltwandel des ästhe-
tischen Typus". Wie der Buchtitel es verheißt, wird die Problematik des ästhetischen
Menschen erörtert zunächst, soweit sie literarisch faßbar ist, d. h. in der deutschen
Literatur ihren Niederschlag gefunden hat. Aber von solch literarischer Grund-
lage hebt sich die Darstellung zwangsläufig zur Betrachtung und Beurteilung der
„ästhetischen Bildungsgedanken und ästhetischen Erziehungsideen" selbst, deren
Ausdruck die Literaturdenkmäler waren, und wird so zur Erörterung der „Frage
383
Oskar Hagen: Deutsches Sehen. Gestaltungsfragen der deutschen Kunst.
3. Auflage. R. Piper u. Co., München (1933).
Der Verlag Piper legt die dritte Auflage des im Jahre 1919 erstmals er-
schienenen Buches „Deutsches Sehen" vor. Wofür der Autor damals als Einzelner
zeugte, ist jetzt die kulturpolitische Haltung des ganzen Staates geworden.
„Erst jetzt ist die Stunde dieses Büchleins gekommen", schreibt der Verfasser
im neuen Vorwort — im Bereich des Politischen hat er Recht. Doch hat ein
aufrichtiges und tiefes Werk seine gute Stunde jetzt und immerdar. Dehios „Ge-
schichte der deutschen Kunst" war seit ihrem Erscheinen als ein Meisterwerk
wissenschaftlicher und gleichzeitig volkstümlicher Geschichtsschreibung anerkannt
und sie wird diesen Platz auch behalten. Den gleichlaufenden Bemühungen von
Richard Benz, Dehio, Gerstenberg und Pinder verdankt Hagen vieles von seinem
Buche. Aber Gedankenschärfe und Problemtiefe als das ewig Jungerhaltende
an einem Buche sind nicht besonders ausgeprägt. Am persönlichsten muten
die feinsinnigen Graphikkapitel und die Parallelen aus der Musikgeschichte an.
Alles, was mit Linie und Komposition zusammenhängt, ist gut gesehen und
oft glücklich formuliert, dagegen läßt die Darstellung bei den Phänomenen zu
wünschen übrig, die sich auf das Körperhafte und das Räumliche beziehen. Das
Kapitel „Raum" mit seinen reichen Erkenntnismöglichkeiten für die nationale Eigen-
art wirkt flach; von Plastik ist gar nicht die Rede. Daneben stehen Vorzüge: das
Buch hält sich von allen Phrasen fern, die Einstellung ist sachlich und liebevoll.
Darum wird es für den Schulunterricht und für volksbildnerische Aufgaben geeignet
bleiben. Diesem Zweck dienen auch die 87 klug ausgewählten Abbildungen, die vor
allem den anschaulichen Vergleich zwischen nördlicher und südlicher Formensprache
verdeutlichen helfen. In Text und Bild hätte man jedoch gerne dem 19. und 20. Jahr-
hundert einen breiteren Raum gewünscht.
Berlin. Alfred Neumeyer.
Karl Justus Obenauer: Die Problematik des ästhetischen
Menschen in der deutschen Literatur. München, Beck, 1933.
Der schon durch eine ganze Reihe ästhetisch feiner und philosophisch tiefer
Bücher bekannte Verfasser legt der Öffentlichkeit hier als Frucht fünfzehnjähriger
Beschäftigung mit dem behandelten Gedankenkreis ein ungewöhnlich reiches Werk
vor. Obwohl aus praktischen Rücksichten an Umfang beschnitten, birgt es doch
auch so eine unerschöpfliche Fülle feinster Beobachtungen, umsichtigster Über-
legungen und reifster Urteile und malt das sehr geschlossene und vollständige Bild
einer äußerst wichtigen literarischen, pädagogischen, überhaupt weltanschaulichen
Entwicklung.
Es handelt sich in Obenauers Buch um den „durch den Gang der Geistes-
geschichte bedingten Wandel einer bestimmten Lebensform von vielfältigster, lehr-
reichster Seelenproblematik", nämlich den „historischen Gestaltwandel des ästhe-
tischen Typus". Wie der Buchtitel es verheißt, wird die Problematik des ästhetischen
Menschen erörtert zunächst, soweit sie literarisch faßbar ist, d. h. in der deutschen
Literatur ihren Niederschlag gefunden hat. Aber von solch literarischer Grund-
lage hebt sich die Darstellung zwangsläufig zur Betrachtung und Beurteilung der
„ästhetischen Bildungsgedanken und ästhetischen Erziehungsideen" selbst, deren
Ausdruck die Literaturdenkmäler waren, und wird so zur Erörterung der „Frage