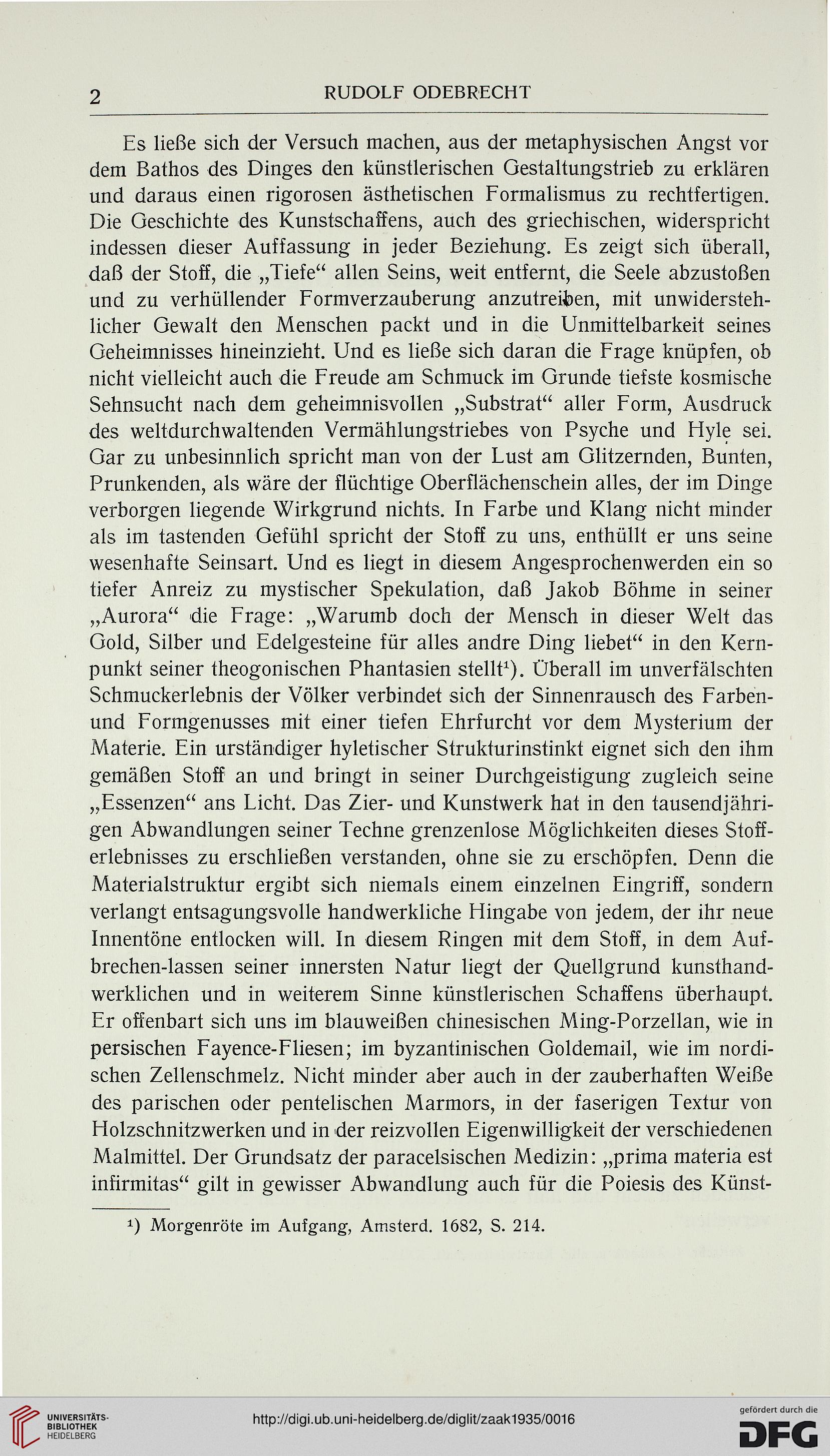2
RUDOLF ODEBRECHT
Es ließe sich der Versuch machen, aus der metaphysischen Angst vor
dem Bathos des Dinges den künstlerischen Gestaltungstrieb zu erklären
und daraus einen rigorosen ästhetischen Formalismus zu rechtfertigen.
Die Geschichte des Kunstschaffens, auch des griechischen, widerspricht
indessen dieser Auffassung in jeder Beziehung. Es zeigt sich überall,
daß der Stoff, die „Tiefe" allen Seins, weit entfernt, die Seele abzustoßen
und zu verhüllender Formverzauberung anzutreiben, mit unwidersteh-
licher Gewalt den Menschen packt und in die Unmittelbarkeit seines
Geheimnisses hineinzieht. Und es ließe sich daran die Frage knüpfen, ob
nicht vielleicht auch die Freude am Schmuck im Grunde tiefste kosmische
Sehnsucht nach dem geheimnisvollen „Substrat" aller Form, Ausdruck
des weltdurchwaltenden Vermählungstriebes von Psyche und Hyle sei.
Gar zu unbesinnlich spricht man von der Lust am Glitzernden, Bunten,
Prunkenden, als wäre der flüchtige Oberflächenschein alles, der im Dinge
verborgen liegende Wirkgrund nichts. In Farbe und Klang nicht minder
als im tastenden Gefühl spricht der Stoff zu uns, enthüllt er uns seine
wesenhafte Seinsart. Und es liegt in diesem Angesprochenwerden ein so
tiefer Anreiz zu mystischer Spekulation, daß Jakob Böhme in seiner
„Aurora" die Frage: „Warumb doch der Mensch in dieser Welt das
Gold, Silber und Edelgesteine für alles andre Ding liebet" in den Kern-
punkt seiner theogonischen Phantasien stellt1). Überall im unverfälschten
Schmuckerlebnis der Völker verbindet sich der Sinnenrausch des Farben-
und Formgenusses mit einer tiefen Ehrfurcht vor dem Mysterium der
Materie. Ein urständiger hyletischer Strukturinstinkt eignet sich den ihm
gemäßen Stoff an und bringt in seiner Durchgeistigung zugleich seine
„Essenzen" ans Licht. Das Zier- und Kunstwerk hat in den tausendjähri-
gen Abwandlungen seiner Techne grenzenlose Möglichkeiten dieses Stoff-
erlebnisses zu erschließen verstanden, ohne sie zu erschöpfen. Denn die
Materialstruktur ergibt sich niemals einem einzelnen Eingriff, sondern
verlangt entsagungsvolle handwerkliche Hingabe von jedem, der ihr neue
Innentöne entlocken will. In diesem Ringen mit dem Stoff, in dem Auf-
brechen-lassen seiner innersten Natur liegt der Quellgrund kunsthand-
werklichen und in weiterem Sinne künstlerischen Schaffens überhaupt.
Er offenbart sich uns im blauweißen chinesischen Ming-Porzellan, wie in
persischen Fayence-Fliesen; im byzantinischen Goldemail, wie im nordi-
schen Zellenschmelz. Nicht minder aber auch in der zauberhaften Weiße
des parischen oder pentelischen Marmors, in der faserigen Textur von
Holzschnitzwerken und in der reizvollen Eigenwilligkeit der verschiedenen
Malmittel. Der Grundsatz der paracelsischen Medizin: „prima materia est
infirmitas" gilt in gewisser Abwandlung auch für die Poiesis des Künst-
1) Morgenröte im Aufgang, Amsterd. 1682, S. 214.
RUDOLF ODEBRECHT
Es ließe sich der Versuch machen, aus der metaphysischen Angst vor
dem Bathos des Dinges den künstlerischen Gestaltungstrieb zu erklären
und daraus einen rigorosen ästhetischen Formalismus zu rechtfertigen.
Die Geschichte des Kunstschaffens, auch des griechischen, widerspricht
indessen dieser Auffassung in jeder Beziehung. Es zeigt sich überall,
daß der Stoff, die „Tiefe" allen Seins, weit entfernt, die Seele abzustoßen
und zu verhüllender Formverzauberung anzutreiben, mit unwidersteh-
licher Gewalt den Menschen packt und in die Unmittelbarkeit seines
Geheimnisses hineinzieht. Und es ließe sich daran die Frage knüpfen, ob
nicht vielleicht auch die Freude am Schmuck im Grunde tiefste kosmische
Sehnsucht nach dem geheimnisvollen „Substrat" aller Form, Ausdruck
des weltdurchwaltenden Vermählungstriebes von Psyche und Hyle sei.
Gar zu unbesinnlich spricht man von der Lust am Glitzernden, Bunten,
Prunkenden, als wäre der flüchtige Oberflächenschein alles, der im Dinge
verborgen liegende Wirkgrund nichts. In Farbe und Klang nicht minder
als im tastenden Gefühl spricht der Stoff zu uns, enthüllt er uns seine
wesenhafte Seinsart. Und es liegt in diesem Angesprochenwerden ein so
tiefer Anreiz zu mystischer Spekulation, daß Jakob Böhme in seiner
„Aurora" die Frage: „Warumb doch der Mensch in dieser Welt das
Gold, Silber und Edelgesteine für alles andre Ding liebet" in den Kern-
punkt seiner theogonischen Phantasien stellt1). Überall im unverfälschten
Schmuckerlebnis der Völker verbindet sich der Sinnenrausch des Farben-
und Formgenusses mit einer tiefen Ehrfurcht vor dem Mysterium der
Materie. Ein urständiger hyletischer Strukturinstinkt eignet sich den ihm
gemäßen Stoff an und bringt in seiner Durchgeistigung zugleich seine
„Essenzen" ans Licht. Das Zier- und Kunstwerk hat in den tausendjähri-
gen Abwandlungen seiner Techne grenzenlose Möglichkeiten dieses Stoff-
erlebnisses zu erschließen verstanden, ohne sie zu erschöpfen. Denn die
Materialstruktur ergibt sich niemals einem einzelnen Eingriff, sondern
verlangt entsagungsvolle handwerkliche Hingabe von jedem, der ihr neue
Innentöne entlocken will. In diesem Ringen mit dem Stoff, in dem Auf-
brechen-lassen seiner innersten Natur liegt der Quellgrund kunsthand-
werklichen und in weiterem Sinne künstlerischen Schaffens überhaupt.
Er offenbart sich uns im blauweißen chinesischen Ming-Porzellan, wie in
persischen Fayence-Fliesen; im byzantinischen Goldemail, wie im nordi-
schen Zellenschmelz. Nicht minder aber auch in der zauberhaften Weiße
des parischen oder pentelischen Marmors, in der faserigen Textur von
Holzschnitzwerken und in der reizvollen Eigenwilligkeit der verschiedenen
Malmittel. Der Grundsatz der paracelsischen Medizin: „prima materia est
infirmitas" gilt in gewisser Abwandlung auch für die Poiesis des Künst-
1) Morgenröte im Aufgang, Amsterd. 1682, S. 214.