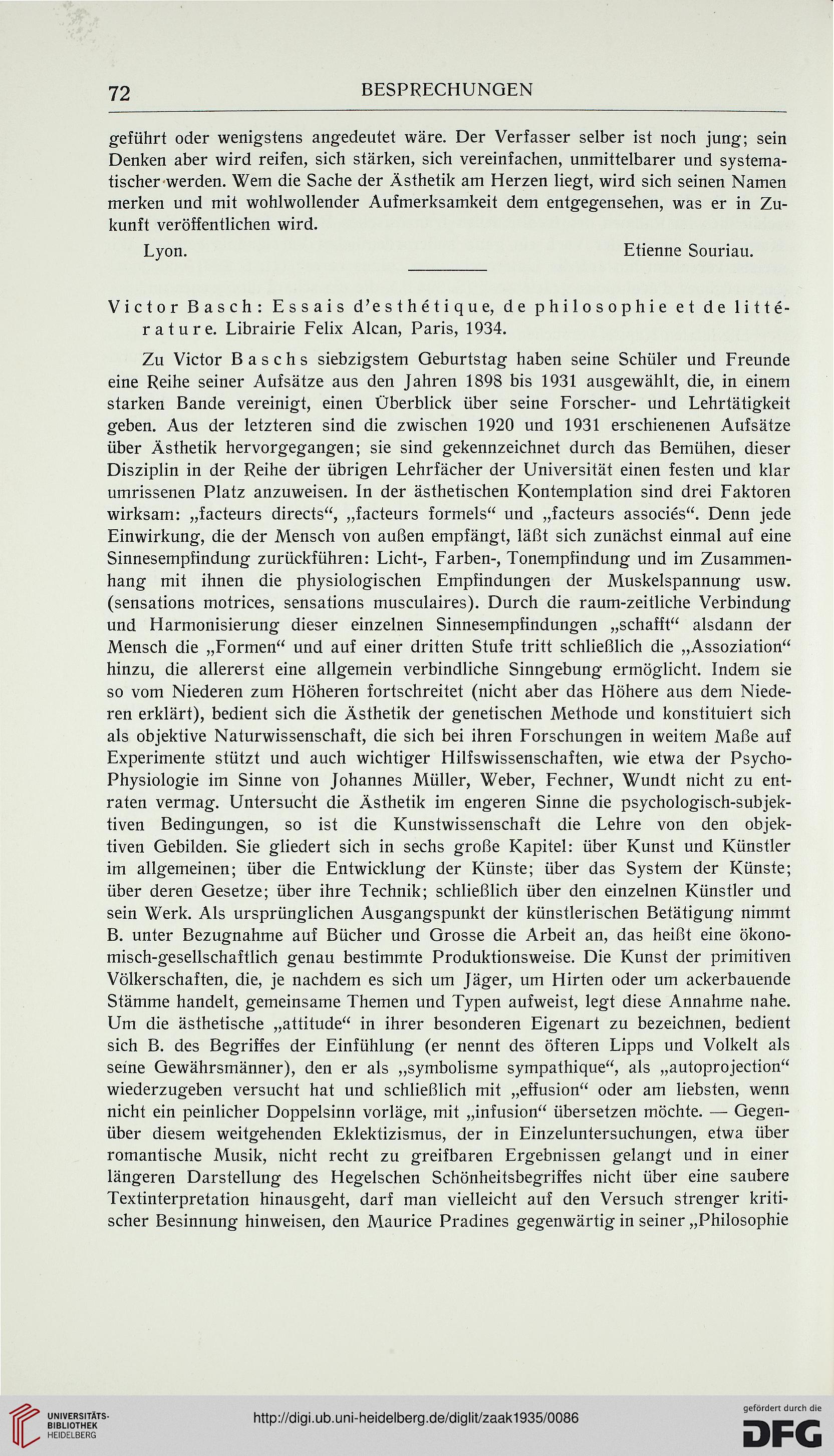72
BESPRECHUNGEN
geführt oder wenigstens angedeutet wäre. Der Verfasser selber ist noch jung; sein
Denken aber wird reifen, sich stärken, sich vereinfachen, unmittelbarer und systema-
tischer werden. Wem die Sache der Ästhetik am Herzen liegt, wird sich seinen Namen
merken und mit wohlwollender Aufmerksamkeit dem entgegensehen, was er in Zu-
kunft veröffentlichen wird.
Lyon. Etienne Souriau.
Victor Bäsch: Essais d'esthetique, de philosophie et de litte-
r a t u r e. Librairie Felix Alcan, Paris, 1934.
Zu Victor Bäschs siebzigstem Geburtstag haben seine Schüler und Freunde
eine Reihe seiner Aufsätze aus den Jahren 1898 bis 1931 ausgewählt, die, in einem
starken Bande vereinigt, einen Überblick über seine Forscher- und Lehrtätigkeit
geben. Aus der letzteren sind die zwischen 1920 und 1931 erschienenen Aufsätze
über Ästhetik hervorgegangen; sie sind gekennzeichnet durch das Bemühen, dieser
Disziplin in der Reihe der übrigen Lehrfächer der Universität einen festen und klar
umrissenen Platz anzuweisen. In der ästhetischen Kontemplation sind drei Faktoren
wirksam: „facteurs directs", „facteurs formels" und „facteurs associes". Denn jede
Einwirkung, die der Mensch von außen empfängt, läßt sich zunächst einmal auf eine
Sinnesempfindung zurückführen: Licht-, Farben-, Tonempfindung und im Zusammen-
hang mit ihnen die physiologischen Empfindungen der Muskelspannung usw.
(sensations motrices, sensations musculaires). Durch die raum-zeitliche Verbindung
und Harmonisierung dieser einzelnen Sinnesempfindungen „schafft" alsdann der
Mensch die „Formen" und auf einer dritten Stufe tritt schließlich die „Assoziation"
hinzu, die allererst eine allgemein verbindliche Sinngebung ermöglicht. Indem sie
so vom Niederen zum Höheren fortschreitet (nicht aber das Höhere aus dem Niede-
ren erklärt), bedient sich die Ästhetik der genetischen Methode und konstituiert sich
als objektive Naturwissenschaft, die sich bei ihren Forschungen in weitem Maße auf
Experimente stützt und auch wichtiger Hilfswissenschaften, wie etwa der Psycho-
Physiologie im Sinne von Johannes Müller, Weber, Fechner, Wundt nicht zu ent-
raten vermag. Untersucht die Ästhetik im engeren Sinne die psychologisch-subjek-
tiven Bedingungen, so ist die Kunstwissenschaft die Lehre von den objek-
tiven Gebilden. Sie gliedert sich in sechs große Kapitel: über Kunst und Künstler
im allgemeinen; über die Entwicklung der Künste; über das System der Künste;
über deren Gesetze; über ihre Technik; schließlich über den einzelnen Künstler und
sein Werk. Als ursprünglichen Ausgangspunkt der künstlerischen Betätigung nimmt
B. unter Bezugnahme auf Bücher und Grosse die Arbeit an, das heißt eine ökono-
misch-gesellschaftlich genau bestimmte Produktionsweise. Die Kunst der primitiven
Völkerschaften, die, je nachdem es sich um Jäger, um Hirten oder um ackerbauende
Stämme handelt, gemeinsame Themen und Typen aufweist, legt diese Annahme nahe.
Um die ästhetische „attitude" in ihrer besonderen Eigenart zu bezeichnen, bedient
sich B. des Begriffes der Einfühlung (er nennt des öfteren Lipps und Volkelt als
seine Gewährsmänner), den er als „symbolisme sympathique", als „autoprojection"
wiederzugeben versucht hat und schließlich mit „effusion" oder am liebsten, wenn
nicht ein peinlicher Doppelsinn vorläge, mit „infusion" übersetzen möchte. — Gegen-
über diesem weitgehenden Eklektizismus, der in Einzeluntersuchungen, etwa über
romantische Musik, nicht recht zu greifbaren Ergebnissen gelangt und in einer
längeren Darstellung des Hegeischen Schönheitsbegriffes nicht über eine saubere
Textinterpretation hinausgeht, darf man vielleicht auf den Versuch strenger kriti-
scher Besinnung hinweisen, den Maurice Pradines gegenwärtig in seiner „Philosophie
BESPRECHUNGEN
geführt oder wenigstens angedeutet wäre. Der Verfasser selber ist noch jung; sein
Denken aber wird reifen, sich stärken, sich vereinfachen, unmittelbarer und systema-
tischer werden. Wem die Sache der Ästhetik am Herzen liegt, wird sich seinen Namen
merken und mit wohlwollender Aufmerksamkeit dem entgegensehen, was er in Zu-
kunft veröffentlichen wird.
Lyon. Etienne Souriau.
Victor Bäsch: Essais d'esthetique, de philosophie et de litte-
r a t u r e. Librairie Felix Alcan, Paris, 1934.
Zu Victor Bäschs siebzigstem Geburtstag haben seine Schüler und Freunde
eine Reihe seiner Aufsätze aus den Jahren 1898 bis 1931 ausgewählt, die, in einem
starken Bande vereinigt, einen Überblick über seine Forscher- und Lehrtätigkeit
geben. Aus der letzteren sind die zwischen 1920 und 1931 erschienenen Aufsätze
über Ästhetik hervorgegangen; sie sind gekennzeichnet durch das Bemühen, dieser
Disziplin in der Reihe der übrigen Lehrfächer der Universität einen festen und klar
umrissenen Platz anzuweisen. In der ästhetischen Kontemplation sind drei Faktoren
wirksam: „facteurs directs", „facteurs formels" und „facteurs associes". Denn jede
Einwirkung, die der Mensch von außen empfängt, läßt sich zunächst einmal auf eine
Sinnesempfindung zurückführen: Licht-, Farben-, Tonempfindung und im Zusammen-
hang mit ihnen die physiologischen Empfindungen der Muskelspannung usw.
(sensations motrices, sensations musculaires). Durch die raum-zeitliche Verbindung
und Harmonisierung dieser einzelnen Sinnesempfindungen „schafft" alsdann der
Mensch die „Formen" und auf einer dritten Stufe tritt schließlich die „Assoziation"
hinzu, die allererst eine allgemein verbindliche Sinngebung ermöglicht. Indem sie
so vom Niederen zum Höheren fortschreitet (nicht aber das Höhere aus dem Niede-
ren erklärt), bedient sich die Ästhetik der genetischen Methode und konstituiert sich
als objektive Naturwissenschaft, die sich bei ihren Forschungen in weitem Maße auf
Experimente stützt und auch wichtiger Hilfswissenschaften, wie etwa der Psycho-
Physiologie im Sinne von Johannes Müller, Weber, Fechner, Wundt nicht zu ent-
raten vermag. Untersucht die Ästhetik im engeren Sinne die psychologisch-subjek-
tiven Bedingungen, so ist die Kunstwissenschaft die Lehre von den objek-
tiven Gebilden. Sie gliedert sich in sechs große Kapitel: über Kunst und Künstler
im allgemeinen; über die Entwicklung der Künste; über das System der Künste;
über deren Gesetze; über ihre Technik; schließlich über den einzelnen Künstler und
sein Werk. Als ursprünglichen Ausgangspunkt der künstlerischen Betätigung nimmt
B. unter Bezugnahme auf Bücher und Grosse die Arbeit an, das heißt eine ökono-
misch-gesellschaftlich genau bestimmte Produktionsweise. Die Kunst der primitiven
Völkerschaften, die, je nachdem es sich um Jäger, um Hirten oder um ackerbauende
Stämme handelt, gemeinsame Themen und Typen aufweist, legt diese Annahme nahe.
Um die ästhetische „attitude" in ihrer besonderen Eigenart zu bezeichnen, bedient
sich B. des Begriffes der Einfühlung (er nennt des öfteren Lipps und Volkelt als
seine Gewährsmänner), den er als „symbolisme sympathique", als „autoprojection"
wiederzugeben versucht hat und schließlich mit „effusion" oder am liebsten, wenn
nicht ein peinlicher Doppelsinn vorläge, mit „infusion" übersetzen möchte. — Gegen-
über diesem weitgehenden Eklektizismus, der in Einzeluntersuchungen, etwa über
romantische Musik, nicht recht zu greifbaren Ergebnissen gelangt und in einer
längeren Darstellung des Hegeischen Schönheitsbegriffes nicht über eine saubere
Textinterpretation hinausgeht, darf man vielleicht auf den Versuch strenger kriti-
scher Besinnung hinweisen, den Maurice Pradines gegenwärtig in seiner „Philosophie