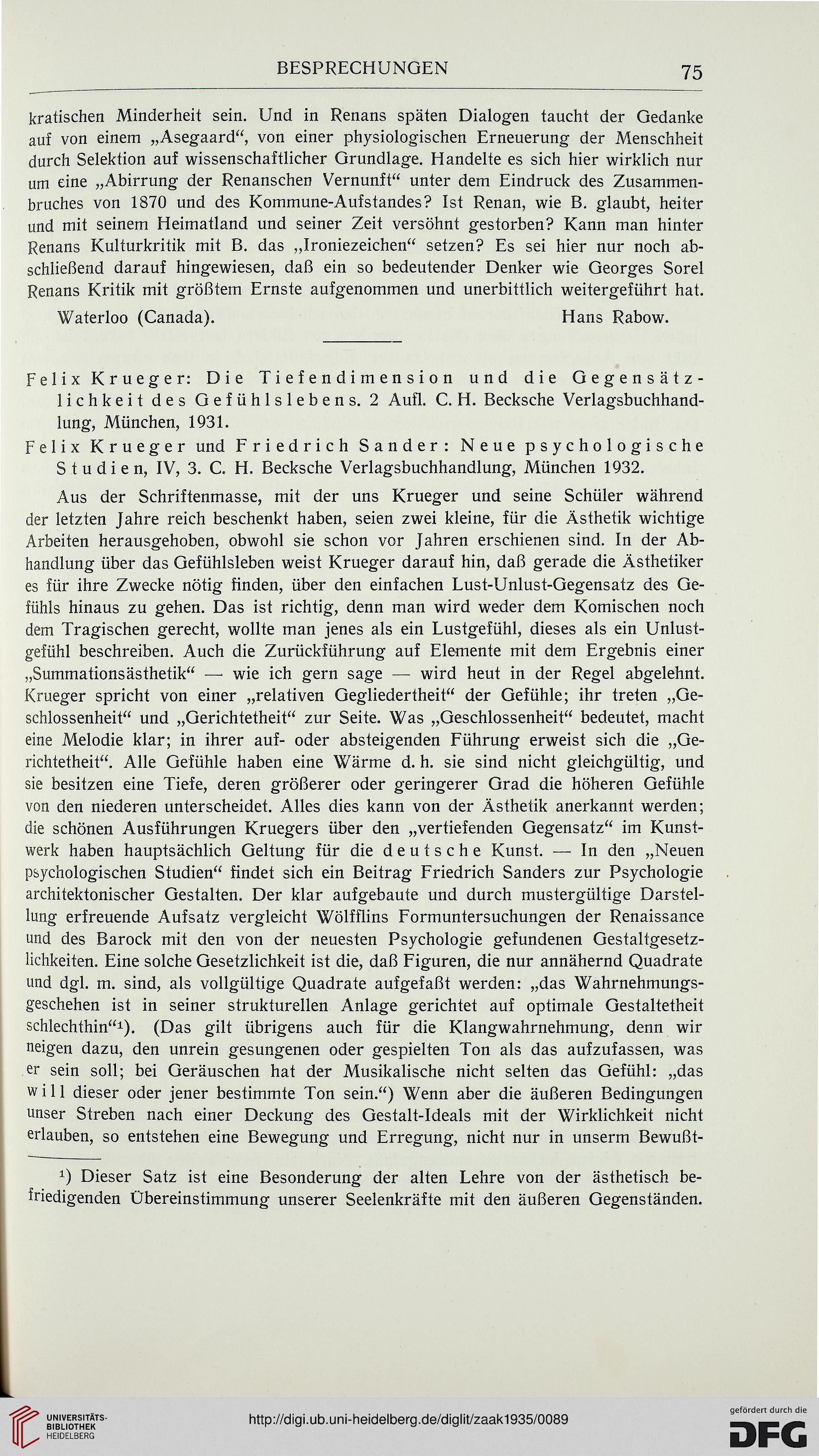BESPRECHUNGEN
75
kratischen Minderheit sein. Und in Renans späten Dialogen taucht der Gedanke
auf von einem „Asegaard", von einer physiologischen Erneuerung der Menschheit
durch Selektion auf wissenschaftlicher Grundlage. Handelte es sich hier wirklich nur
um eine „Abirrung der Renanschen Vernunft" unter dem Eindruck des Zusammen-
bruches von 1870 und des Kommune-Auf Standes? Ist Renan, wie B. glaubt, heiter
und mit seinem Heimatland und seiner Zeit versöhnt gestorben? Kann man hinter
Renans Kulturkritik mit B. das „Ironiezeichen" setzen? Es sei hier nur noch ab-
schließend darauf hingewiesen, daß ein so bedeutender Denker wie Georges Sorel
Renans Kritik mit größtem Ernste aufgenommen und unerbittlich weitergeführt hat.
Waterloo (Canada). Hans Rabow.
Felix Krueger: Die T i e f e n d i m e n s i o n und die Gegensätz-
lichkeit des Gefühlslebens. 2 Aufl. C. H. Becksche Verlagsbuchhand-
lung, München, 1931.
Felix Krueger und Friedrich Sander: Neue psychologische
Studien, IV, 3. C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, München 1932.
Aus der Schriftenmasse, mit der uns Krueger und seine Schüler während
der letzten Jahre reich beschenkt haben, seien zwei kleine, für die Ästhetik wichtige
Arbeiten herausgehoben, obwohl sie schon vor Jahren erschienen sind. In der Ab-
handlung über das Gefühlsleben weist Krueger darauf hin, daß gerade die Ästhetiker
es für ihre Zwecke nötig finden, über den einfachen Lust-Unlust-Gegensatz des Ge-
fühls hinaus zu gehen. Das ist richtig, denn man wird weder dem Komischen noch
dem Tragischen gerecht, wollte man jenes als ein Lustgefühl, dieses als ein Unlust-
gefühl beschreiben. Auch die Zurückführung auf Elemente mit dem Ergebnis einer
„Summationsästhetik" — wie ich gern sage — wird heut in der Regel abgelehnt.
Krueger spricht von einer „relativen Gegliedertheit" der Gefühle; ihr treten „Ge-
schlossenheit" und „Gerichtetheit" zur Seite. Was „Geschlossenheit" bedeutet, macht
eine Melodie klar; in ihrer auf- oder absteigenden Führung erweist sich die „Ge-
richtetheit". Alle Gefühle haben eine Wärme d. h. sie sind nicht gleichgültig, und
sie besitzen eine Tiefe, deren größerer oder geringerer Grad die höheren Gefühle
von den niederen unterscheidet. Alles dies kann von der Ästhetik anerkannt werden;
die schönen Ausführungen Kruegers über den „vertiefenden Gegensatz" im Kunst-
werk haben hauptsächlich Geltung für die deutsche Kunst. — In den „Neuen
psychologischen Studien" findet sich ein Beitrag Friedrich Sanders zur Psychologie
architektonischer Gestalten. Der klar aufgebaute und durch mustergültige Darstel-
lung erfreuende Aufsatz vergleicht Wölfflins Formuntersuchungen der Renaissance
und des Barock mit den von der neuesten Psychologie gefundenen Gestaltgesetz-
lichkeiten. Eine solche Gesetzlichkeit ist die, daß Figuren, die nur annähernd Quadrate
und dgl. m. sind, als vollgültige Quadrate aufgefaßt werden: „das Wahrnehmungs-
geschehen ist in seiner strukturellen Anlage gerichtet auf optimale Gestaltetheit
schlechthin"1). (Das gilt übrigens auch für die Klangwahrnehmung, denn wir
neigen dazu, den unrein gesungenen oder gespielten Ton als das aufzufassen, was
er sein soll; bei Geräuschen hat der Musikalische nicht selten das Gefühl: „das
will dieser oder jener bestimmte Ton sein.") Wenn aber die äußeren Bedingungen
unser Streben nach einer Deckung des Gestalt-Ideals mit der Wirklichkeit nicht
erlauben, so entstehen eine Bewegung und Erregung, nicht nur in unserm Bewußt-
*) Dieser Satz ist eine Besonderung der alten Lehre von der ästhetisch be-
friedigenden Übereinstimmung unserer Seelenkräfte mit den äußeren Gegenständen.
75
kratischen Minderheit sein. Und in Renans späten Dialogen taucht der Gedanke
auf von einem „Asegaard", von einer physiologischen Erneuerung der Menschheit
durch Selektion auf wissenschaftlicher Grundlage. Handelte es sich hier wirklich nur
um eine „Abirrung der Renanschen Vernunft" unter dem Eindruck des Zusammen-
bruches von 1870 und des Kommune-Auf Standes? Ist Renan, wie B. glaubt, heiter
und mit seinem Heimatland und seiner Zeit versöhnt gestorben? Kann man hinter
Renans Kulturkritik mit B. das „Ironiezeichen" setzen? Es sei hier nur noch ab-
schließend darauf hingewiesen, daß ein so bedeutender Denker wie Georges Sorel
Renans Kritik mit größtem Ernste aufgenommen und unerbittlich weitergeführt hat.
Waterloo (Canada). Hans Rabow.
Felix Krueger: Die T i e f e n d i m e n s i o n und die Gegensätz-
lichkeit des Gefühlslebens. 2 Aufl. C. H. Becksche Verlagsbuchhand-
lung, München, 1931.
Felix Krueger und Friedrich Sander: Neue psychologische
Studien, IV, 3. C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, München 1932.
Aus der Schriftenmasse, mit der uns Krueger und seine Schüler während
der letzten Jahre reich beschenkt haben, seien zwei kleine, für die Ästhetik wichtige
Arbeiten herausgehoben, obwohl sie schon vor Jahren erschienen sind. In der Ab-
handlung über das Gefühlsleben weist Krueger darauf hin, daß gerade die Ästhetiker
es für ihre Zwecke nötig finden, über den einfachen Lust-Unlust-Gegensatz des Ge-
fühls hinaus zu gehen. Das ist richtig, denn man wird weder dem Komischen noch
dem Tragischen gerecht, wollte man jenes als ein Lustgefühl, dieses als ein Unlust-
gefühl beschreiben. Auch die Zurückführung auf Elemente mit dem Ergebnis einer
„Summationsästhetik" — wie ich gern sage — wird heut in der Regel abgelehnt.
Krueger spricht von einer „relativen Gegliedertheit" der Gefühle; ihr treten „Ge-
schlossenheit" und „Gerichtetheit" zur Seite. Was „Geschlossenheit" bedeutet, macht
eine Melodie klar; in ihrer auf- oder absteigenden Führung erweist sich die „Ge-
richtetheit". Alle Gefühle haben eine Wärme d. h. sie sind nicht gleichgültig, und
sie besitzen eine Tiefe, deren größerer oder geringerer Grad die höheren Gefühle
von den niederen unterscheidet. Alles dies kann von der Ästhetik anerkannt werden;
die schönen Ausführungen Kruegers über den „vertiefenden Gegensatz" im Kunst-
werk haben hauptsächlich Geltung für die deutsche Kunst. — In den „Neuen
psychologischen Studien" findet sich ein Beitrag Friedrich Sanders zur Psychologie
architektonischer Gestalten. Der klar aufgebaute und durch mustergültige Darstel-
lung erfreuende Aufsatz vergleicht Wölfflins Formuntersuchungen der Renaissance
und des Barock mit den von der neuesten Psychologie gefundenen Gestaltgesetz-
lichkeiten. Eine solche Gesetzlichkeit ist die, daß Figuren, die nur annähernd Quadrate
und dgl. m. sind, als vollgültige Quadrate aufgefaßt werden: „das Wahrnehmungs-
geschehen ist in seiner strukturellen Anlage gerichtet auf optimale Gestaltetheit
schlechthin"1). (Das gilt übrigens auch für die Klangwahrnehmung, denn wir
neigen dazu, den unrein gesungenen oder gespielten Ton als das aufzufassen, was
er sein soll; bei Geräuschen hat der Musikalische nicht selten das Gefühl: „das
will dieser oder jener bestimmte Ton sein.") Wenn aber die äußeren Bedingungen
unser Streben nach einer Deckung des Gestalt-Ideals mit der Wirklichkeit nicht
erlauben, so entstehen eine Bewegung und Erregung, nicht nur in unserm Bewußt-
*) Dieser Satz ist eine Besonderung der alten Lehre von der ästhetisch be-
friedigenden Übereinstimmung unserer Seelenkräfte mit den äußeren Gegenständen.