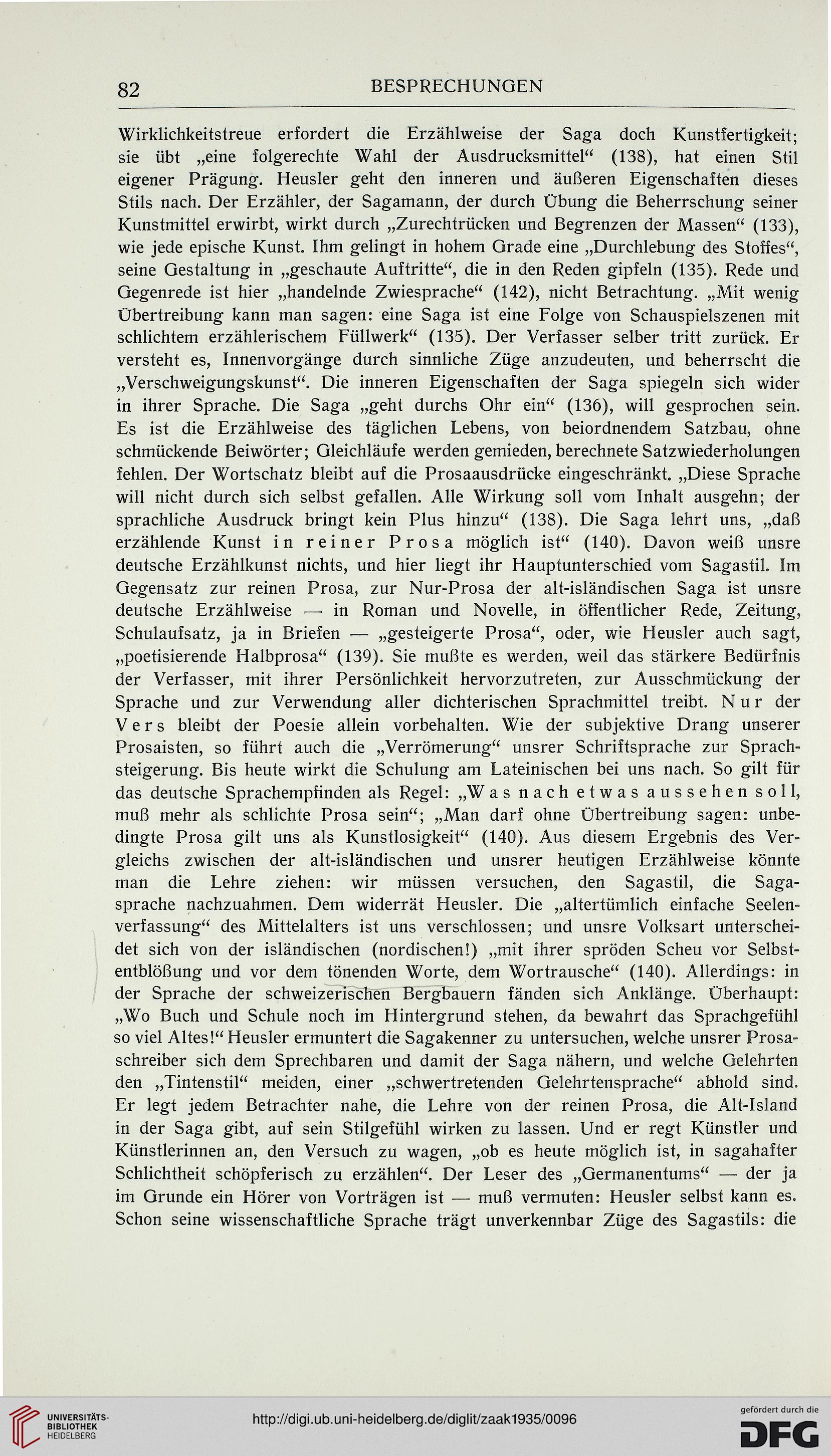82
BESPRECHUNGEN
Wirklichkeitstreue erfordert die Erzählweise der Saga doch Kunstfertigkeit;
sie übt „eine folgerechte Wahl der Ausdrucksmittel" (138), hat einen Stil
eigener Prägung. Heusler geht den inneren und äußeren Eigenschaften dieses
Stils nach. Der Erzähler, der Sagamann, der durch Übung die Beherrschung seiner
Kunstmittel erwirbt, wirkt durch „Zurechtrücken und Begrenzen der Massen" (133),
wie jede epische Kunst. Ihm gelingt in hohem Grade eine „Durchlebung des Stoffes",
seine Gestaltung in „geschaute Auftritte", die in den Reden gipfeln (135). Rede und
Gegenrede ist hier „handelnde Zwiesprache" (142), nicht Betrachtung. „Mit wenig
Übertreibung kann man sagen: eine Saga ist eine Folge von Schauspielszenen mit
schlichtem erzählerischem Füllwerk" (135). Der Verfasser selber tritt zurück. Er
versteht es, Innenvorgänge durch sinnliche Züge anzudeuten, und beherrscht die
„Verschweigungskunst". Die inneren Eigenschaften der Saga spiegeln sich wider
in ihrer Sprache. Die Saga „geht durchs Ohr ein" (136), will gesprochen sein.
Es ist die Erzählweise des täglichen Lebens, von beiordnendem Satzbau, ohne
schmückende Beiwörter; Gleichläufe werden gemieden, berechnete Satzwiederholungen
fehlen. Der Wortschatz bleibt auf die Prosaausdrücke eingeschränkt. „Diese Sprache
will nicht durch sich selbst gefallen. Alle Wirkung soll vom Inhalt ausgehn; der
sprachliche Ausdruck bringt kein Plus hinzu" (138). Die Saga lehrt uns, „daß
erzählende Kunst in reiner Prosa möglich ist" (140). Davon weiß unsre
deutsche Erzählkunst nichts, und hier liegt ihr Hauptunterschied vom Sagastil. Im
Gegensatz zur reinen Prosa, zur Nur-Prosa der alt-isländischen Saga ist unsre
deutsche Erzählweise — in Roman und Novelle, in öffentlicher Rede, Zeitung,
Schulaufsatz, ja in Briefen — „gesteigerte Prosa", oder, wie Heusler auch sagt,
„poetisierende Halbprosa" (139). Sie mußte es werden, weil das stärkere Bedürfnis
der Verfasser, mit ihrer Persönlichkeit hervorzutreten, zur Ausschmückung der
Sprache und zur Verwendung aller dichterischen Sprachmittel treibt. Nur der
Vers bleibt der Poesie allein vorbehalten. Wie der subjektive Drang unserer
Prosaisten, so führt auch die „Verrömerung" unsrer Schriftsprache zur Sprach-
steigerung. Bis heute wirkt die Schulung am Lateinischen bei uns nach. So gilt für
das deutsche Sprachempfinden als Regel: „W as nach etwas aussehen soll,
muß mehr als schlichte Prosa sein"; „Man darf ohne Übertreibung sagen: unbe-
dingte Prosa gilt uns als Kunstlosigkeit" (140). Aus diesem Ergebnis des Ver-
gleichs zwischen der alt-isländischen und unsrer heutigen Erzählweise könnte
man die Lehre ziehen: wir müssen versuchen, den Sagastil, die Saga-
sprache nachzuahmen. Dem widerrät Heusler. Die „altertümlich einfache Seelen-
verfassung" des Mittelalters ist uns verschlossen; und unsre Volksart unterschei-
det sich von der isländischen (nordischen!) „mit ihrer spröden Scheu vor Selbst-
entblößung und vor dem tönenden Worte, dem Wortrausche" (140). Allerdings: in
der Sprache der schweizerischen Bergbauern fänden sich Anklänge. Überhaupt:
„Wo Buch und Schule noch im Hintergrund stehen, da bewahrt das Sprachgefühl
so viel Altes!" Heusler ermuntert die Sagakenner zu untersuchen, welche unsrer Prosa-
schreiber sich dem Sprechbaren und damit der Saga nähern, und welche Gelehrten
den „Tintenstil" meiden, einer „schwertretenden Gelehrtensprache" abhold sind.
Er legt jedem Betrachter nahe, die Lehre von der reinen Prosa, die Alt-Island
in der Saga gibt, auf sein Stilgefühl wirken zu lassen. Und er regt Künstler und
Künstlerinnen an, den Versuch zu wagen, „ob es heute möglich ist, in sagahafter
Schlichtheit schöpferisch zu erzählen". Der Leser des „Germanentums" — der ja
im Grunde ein Hörer von Vorträgen ist — muß vermuten: Heusler selbst kann es.
Schon seine wissenschaftliche Sprache trägt unverkennbar Züge des Sagastils: die
BESPRECHUNGEN
Wirklichkeitstreue erfordert die Erzählweise der Saga doch Kunstfertigkeit;
sie übt „eine folgerechte Wahl der Ausdrucksmittel" (138), hat einen Stil
eigener Prägung. Heusler geht den inneren und äußeren Eigenschaften dieses
Stils nach. Der Erzähler, der Sagamann, der durch Übung die Beherrschung seiner
Kunstmittel erwirbt, wirkt durch „Zurechtrücken und Begrenzen der Massen" (133),
wie jede epische Kunst. Ihm gelingt in hohem Grade eine „Durchlebung des Stoffes",
seine Gestaltung in „geschaute Auftritte", die in den Reden gipfeln (135). Rede und
Gegenrede ist hier „handelnde Zwiesprache" (142), nicht Betrachtung. „Mit wenig
Übertreibung kann man sagen: eine Saga ist eine Folge von Schauspielszenen mit
schlichtem erzählerischem Füllwerk" (135). Der Verfasser selber tritt zurück. Er
versteht es, Innenvorgänge durch sinnliche Züge anzudeuten, und beherrscht die
„Verschweigungskunst". Die inneren Eigenschaften der Saga spiegeln sich wider
in ihrer Sprache. Die Saga „geht durchs Ohr ein" (136), will gesprochen sein.
Es ist die Erzählweise des täglichen Lebens, von beiordnendem Satzbau, ohne
schmückende Beiwörter; Gleichläufe werden gemieden, berechnete Satzwiederholungen
fehlen. Der Wortschatz bleibt auf die Prosaausdrücke eingeschränkt. „Diese Sprache
will nicht durch sich selbst gefallen. Alle Wirkung soll vom Inhalt ausgehn; der
sprachliche Ausdruck bringt kein Plus hinzu" (138). Die Saga lehrt uns, „daß
erzählende Kunst in reiner Prosa möglich ist" (140). Davon weiß unsre
deutsche Erzählkunst nichts, und hier liegt ihr Hauptunterschied vom Sagastil. Im
Gegensatz zur reinen Prosa, zur Nur-Prosa der alt-isländischen Saga ist unsre
deutsche Erzählweise — in Roman und Novelle, in öffentlicher Rede, Zeitung,
Schulaufsatz, ja in Briefen — „gesteigerte Prosa", oder, wie Heusler auch sagt,
„poetisierende Halbprosa" (139). Sie mußte es werden, weil das stärkere Bedürfnis
der Verfasser, mit ihrer Persönlichkeit hervorzutreten, zur Ausschmückung der
Sprache und zur Verwendung aller dichterischen Sprachmittel treibt. Nur der
Vers bleibt der Poesie allein vorbehalten. Wie der subjektive Drang unserer
Prosaisten, so führt auch die „Verrömerung" unsrer Schriftsprache zur Sprach-
steigerung. Bis heute wirkt die Schulung am Lateinischen bei uns nach. So gilt für
das deutsche Sprachempfinden als Regel: „W as nach etwas aussehen soll,
muß mehr als schlichte Prosa sein"; „Man darf ohne Übertreibung sagen: unbe-
dingte Prosa gilt uns als Kunstlosigkeit" (140). Aus diesem Ergebnis des Ver-
gleichs zwischen der alt-isländischen und unsrer heutigen Erzählweise könnte
man die Lehre ziehen: wir müssen versuchen, den Sagastil, die Saga-
sprache nachzuahmen. Dem widerrät Heusler. Die „altertümlich einfache Seelen-
verfassung" des Mittelalters ist uns verschlossen; und unsre Volksart unterschei-
det sich von der isländischen (nordischen!) „mit ihrer spröden Scheu vor Selbst-
entblößung und vor dem tönenden Worte, dem Wortrausche" (140). Allerdings: in
der Sprache der schweizerischen Bergbauern fänden sich Anklänge. Überhaupt:
„Wo Buch und Schule noch im Hintergrund stehen, da bewahrt das Sprachgefühl
so viel Altes!" Heusler ermuntert die Sagakenner zu untersuchen, welche unsrer Prosa-
schreiber sich dem Sprechbaren und damit der Saga nähern, und welche Gelehrten
den „Tintenstil" meiden, einer „schwertretenden Gelehrtensprache" abhold sind.
Er legt jedem Betrachter nahe, die Lehre von der reinen Prosa, die Alt-Island
in der Saga gibt, auf sein Stilgefühl wirken zu lassen. Und er regt Künstler und
Künstlerinnen an, den Versuch zu wagen, „ob es heute möglich ist, in sagahafter
Schlichtheit schöpferisch zu erzählen". Der Leser des „Germanentums" — der ja
im Grunde ein Hörer von Vorträgen ist — muß vermuten: Heusler selbst kann es.
Schon seine wissenschaftliche Sprache trägt unverkennbar Züge des Sagastils: die