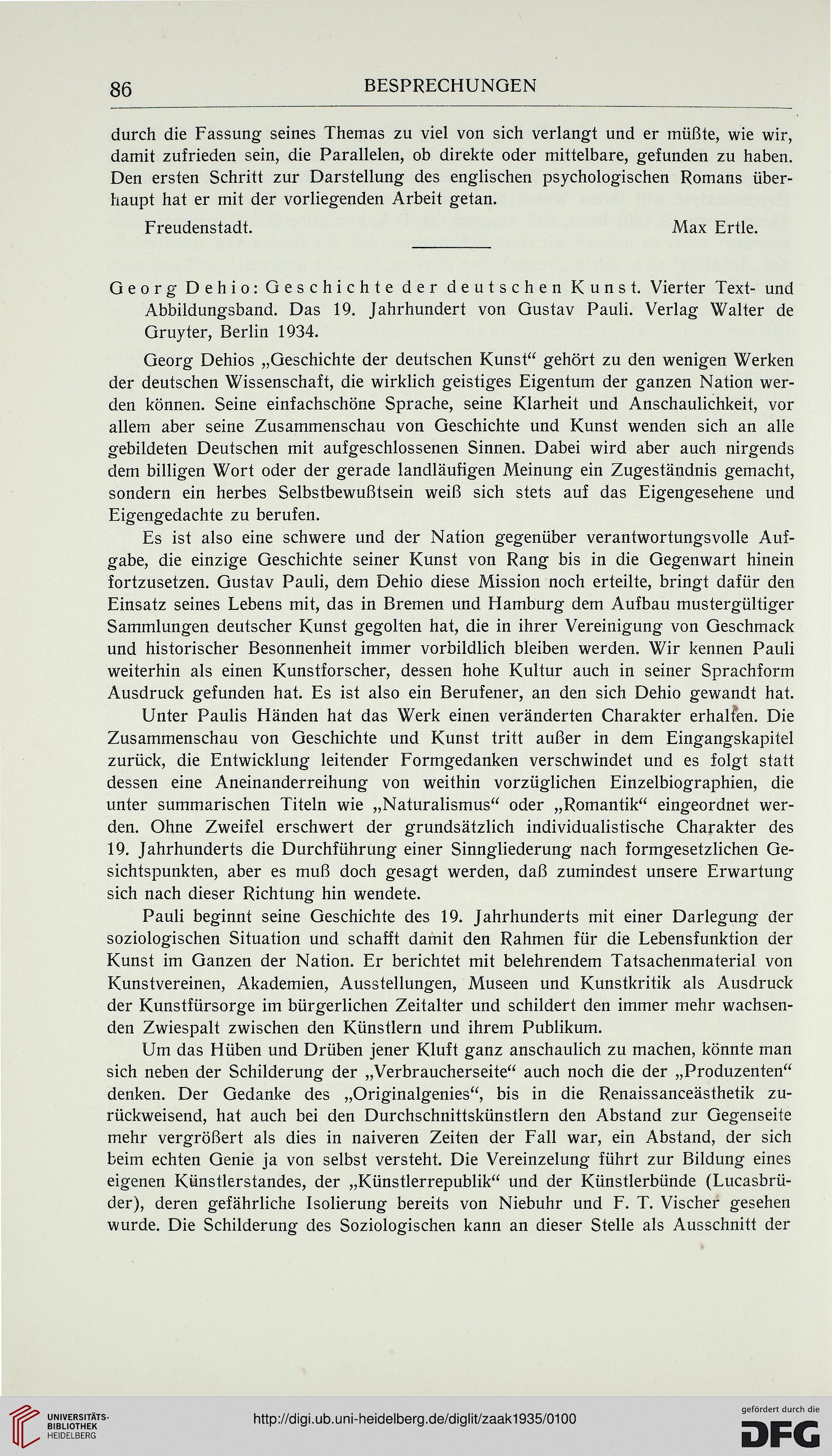86
BESPRECHUNGEN
durch die Fassung seines Themas zu viel von sich verlangt und er müßte, wie wir,
damit zufrieden sein, die Parallelen, ob direkte oder mittelbare, gefunden zu haben.
Den ersten Schritt zur Darstellung des englischen psychologischen Romans über-
haupt hat er mit der vorliegenden Arbeit getan.
Freudenstadt. Max Ertle.
Georg Dehio: Geschichte der deutschen Kunst. Vierter Text- und
Abbildungsband. Das 19. Jahrhundert von Gustav Pauli. Verlag Walter de
Gruyter, Berlin 1934.
Georg Dehios „Geschichte der deutschen Kunst" gehört zu den wenigen Werken
der deutschen Wissenschaft, die wirklich geistiges Eigentum der ganzen Nation wer-
den können. Seine einfachschöne Sprache, seine Klarheit und Anschaulichkeit, vor
allem aber seine Zusammenschau von Geschichte und Kunst wenden sich an alle
gebildeten Deutschen mit aufgeschlossenen Sinnen. Dabei wird aber auch nirgends
dem billigen Wort oder der gerade landläufigen Meinung ein Zugeständnis gemacht,
sondern ein herbes Selbstbewußtsein weiß sich stets auf das Eigengesehene und
Eigengedachte zu berufen.
Es ist also eine schwere und der Nation gegenüber verantwortungsvolle Auf-
gabe, die einzige Geschichte seiner Kunst von Rang bis in die Gegenwart hinein
fortzusetzen. Gustav Pauli, dem Dehio diese Mission noch erteilte, bringt dafür den
Einsatz seines Lebens mit, das in Bremen und Hamburg dem Aufbau mustergültiger
Sammlungen deutscher Kunst gegolten hat, die in ihrer Vereinigung von Geschmack
und historischer Besonnenheit immer vorbildlich bleiben werden. Wir kennen Pauli
weiterhin als einen Kunstforscher, dessen hohe Kultur auch in seiner Sprachform
Ausdruck gefunden hat. Es ist also ein Berufener, an den sich Dehio gewandt hat.
Unter Paulis Händen hat das Werk einen veränderten Charakter erhalfen. Die
Zusammenschau von Geschichte und Kunst tritt außer in dem Eingangskapitel
zurück, die Entwicklung leitender Formgedanken verschwindet und es folgt statt
dessen eine Aneinanderreihung von weithin vorzüglichen Einzelbiographien, die
unter summarischen Titeln wie „Naturalismus" oder „Romantik" eingeordnet wer-
den. Ohne Zweifel erschwert der grundsätzlich individualistische Charakter des
19. Jahrhunderts die Durchführung einer Sinngliederung nach formgesetzlichen Ge-
sichtspunkten, aber es muß doch gesagt werden, daß zumindest unsere Erwartung
sich nach dieser Richtung hin wendete.
Pauli beginnt seine Geschichte des 19. Jahrhunderts mit einer Darlegung der
soziologischen Situation und schafft damit den Rahmen für die Lebensfunktion der
Kunst im Ganzen der Nation. Er berichtet mit belehrendem Tatsachenmaterial von
Kunstvereinen, Akademien, Ausstellungen, Museen und Kunstkritik als Ausdruck
der Kunstfürsorge im bürgerlichen Zeitalter und schildert den immer mehr wachsen-
den Zwiespalt zwischen den Künstlern und ihrem Publikum.
Um das Hüben und Drüben jener Kluft ganz anschaulich zu machen, könnte man
sich neben der Schilderung der „Verbraucherseite" auch noch die der „Produzenten"
denken. Der Gedanke des „Originalgenies", bis in die Renaissanceästhetik zu-
rückweisend, hat auch bei den Durchschnittskünstlern den Abstand zur Gegenseite
mehr vergrößert als dies in naiveren Zeiten der Fall war, ein Abstand, der sich
beim echten Genie ja von selbst versteht. Die Vereinzelung führt zur Bildung eines
eigenen Künstlerstandes, der „Künstlerrepublik" und der Künstlerbünde (Lucasbrü-
der), deren gefährliche Isolierung bereits von Niebuhr und F. T. Vischer gesehen
wurde. Die Schilderung des Soziologischen kann an dieser Stelle als Ausschnitt der
BESPRECHUNGEN
durch die Fassung seines Themas zu viel von sich verlangt und er müßte, wie wir,
damit zufrieden sein, die Parallelen, ob direkte oder mittelbare, gefunden zu haben.
Den ersten Schritt zur Darstellung des englischen psychologischen Romans über-
haupt hat er mit der vorliegenden Arbeit getan.
Freudenstadt. Max Ertle.
Georg Dehio: Geschichte der deutschen Kunst. Vierter Text- und
Abbildungsband. Das 19. Jahrhundert von Gustav Pauli. Verlag Walter de
Gruyter, Berlin 1934.
Georg Dehios „Geschichte der deutschen Kunst" gehört zu den wenigen Werken
der deutschen Wissenschaft, die wirklich geistiges Eigentum der ganzen Nation wer-
den können. Seine einfachschöne Sprache, seine Klarheit und Anschaulichkeit, vor
allem aber seine Zusammenschau von Geschichte und Kunst wenden sich an alle
gebildeten Deutschen mit aufgeschlossenen Sinnen. Dabei wird aber auch nirgends
dem billigen Wort oder der gerade landläufigen Meinung ein Zugeständnis gemacht,
sondern ein herbes Selbstbewußtsein weiß sich stets auf das Eigengesehene und
Eigengedachte zu berufen.
Es ist also eine schwere und der Nation gegenüber verantwortungsvolle Auf-
gabe, die einzige Geschichte seiner Kunst von Rang bis in die Gegenwart hinein
fortzusetzen. Gustav Pauli, dem Dehio diese Mission noch erteilte, bringt dafür den
Einsatz seines Lebens mit, das in Bremen und Hamburg dem Aufbau mustergültiger
Sammlungen deutscher Kunst gegolten hat, die in ihrer Vereinigung von Geschmack
und historischer Besonnenheit immer vorbildlich bleiben werden. Wir kennen Pauli
weiterhin als einen Kunstforscher, dessen hohe Kultur auch in seiner Sprachform
Ausdruck gefunden hat. Es ist also ein Berufener, an den sich Dehio gewandt hat.
Unter Paulis Händen hat das Werk einen veränderten Charakter erhalfen. Die
Zusammenschau von Geschichte und Kunst tritt außer in dem Eingangskapitel
zurück, die Entwicklung leitender Formgedanken verschwindet und es folgt statt
dessen eine Aneinanderreihung von weithin vorzüglichen Einzelbiographien, die
unter summarischen Titeln wie „Naturalismus" oder „Romantik" eingeordnet wer-
den. Ohne Zweifel erschwert der grundsätzlich individualistische Charakter des
19. Jahrhunderts die Durchführung einer Sinngliederung nach formgesetzlichen Ge-
sichtspunkten, aber es muß doch gesagt werden, daß zumindest unsere Erwartung
sich nach dieser Richtung hin wendete.
Pauli beginnt seine Geschichte des 19. Jahrhunderts mit einer Darlegung der
soziologischen Situation und schafft damit den Rahmen für die Lebensfunktion der
Kunst im Ganzen der Nation. Er berichtet mit belehrendem Tatsachenmaterial von
Kunstvereinen, Akademien, Ausstellungen, Museen und Kunstkritik als Ausdruck
der Kunstfürsorge im bürgerlichen Zeitalter und schildert den immer mehr wachsen-
den Zwiespalt zwischen den Künstlern und ihrem Publikum.
Um das Hüben und Drüben jener Kluft ganz anschaulich zu machen, könnte man
sich neben der Schilderung der „Verbraucherseite" auch noch die der „Produzenten"
denken. Der Gedanke des „Originalgenies", bis in die Renaissanceästhetik zu-
rückweisend, hat auch bei den Durchschnittskünstlern den Abstand zur Gegenseite
mehr vergrößert als dies in naiveren Zeiten der Fall war, ein Abstand, der sich
beim echten Genie ja von selbst versteht. Die Vereinzelung führt zur Bildung eines
eigenen Künstlerstandes, der „Künstlerrepublik" und der Künstlerbünde (Lucasbrü-
der), deren gefährliche Isolierung bereits von Niebuhr und F. T. Vischer gesehen
wurde. Die Schilderung des Soziologischen kann an dieser Stelle als Ausschnitt der