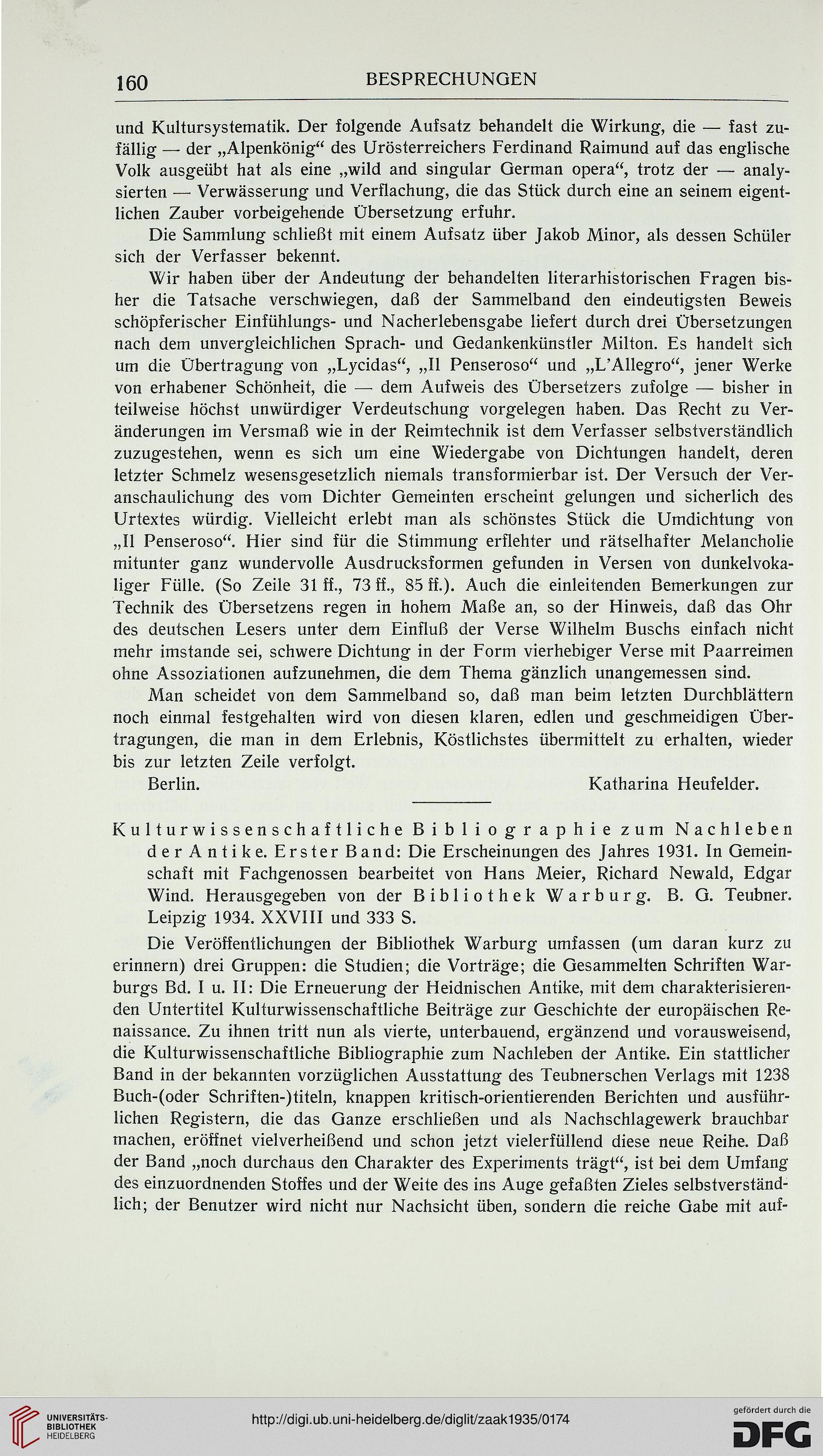160
BESPRECHUNGEN
und Kultursystematik. Der folgende Aufsatz behandelt die Wirkung, die — fast zu-
fällig — der „Alpenkönig" des UrÖsterreichers Ferdinand Raimund auf das englische
Volk ausgeübt hat als eine „wild and singular German opera", trotz der — analy-
sierten — Verwässerung und Verflachung, die das Stück durch eine an seinem eigent-
lichen Zauber vorbeigehende Übersetzung erfuhr.
Die Sammlung schließt mit einem Aufsatz über Jakob Minor, als dessen Schüler
sich der Verfasser bekennt.
Wir haben über der Andeutung der behandelten literarhistorischen Fragen bis-
her die Tatsache verschwiegen, daß der Sammelband den eindeutigsten Beweis
schöpferischer Einfühlungs- und Nacherlebensgabe liefert durch drei Übersetzungen
nach dem unvergleichlichen Sprach- und Gedankenkünstler Milton. Es handelt sich
um die Übertragung von „Lycidas", „II Penseroso" und „L'Allegro", jener Werke
von erhabener Schönheit, die — dem Aufweis des Übersetzers zufolge — bisher in
teilweise höchst unwürdiger Verdeutschung vorgelegen haben. Das Recht zu Ver-
änderungen im Versmaß wie in der Reimtechnik ist dem Verfasser selbstverständlich
zuzugestehen, wenn es sich um eine Wiedergabe von Dichtungen handelt, deren
letzter Schmelz wesensgesetzlich niemals transformierbar ist. Der Versuch der Ver-
anschaulichung des vom Dichter Gemeinten erscheint gelungen und sicherlich des
Urtextes würdig. Vielleicht erlebt man als schönstes Stück die Umdichtung von
„II Penseroso". Hier sind für die Stimmung erflehter und rätselhafter Melancholie
mitunter ganz wundervolle Ausdrucksformen gefunden in Versen von dunkelvoka-
liger Fülle. (So Zeile 31 ff., 73 ff., 85 ff.). Auch die einleitenden Bemerkungen zur
Technik des Übersetzens regen in hohem Maße an, so der Hinweis, daß das Ohr
des deutschen Lesers unter dem Einfluß der Verse Wilhelm Büschs einfach nicht
mehr imstande sei, schwere Dichtung in der Form vierhebiger Verse mit Paarreimen
ohne Assoziationen aufzunehmen, die dem Thema gänzlich unangemessen sind.
Man scheidet von dem Sammelband so, daß man beim letzten Durchblättern
noch einmal festgehalten wird von diesen klaren, edlen und geschmeidigen Über-
tragungen, die man in dem Erlebnis, Köstlichstes übermittelt zu erhalten, wieder
bis zur letzten Zeile verfolgt.
Berlin. Katharina Heufelder.
Kulturwissenschaftliche Bibliographie zum Nachleben
der Antike. Erster Band: Die Erscheinungen des Jahres 1931. In Gemein-
schaft mit Fachgenossen bearbeitet von Hans Meier, Richard Newald, Edgar
Wind. Herausgegeben von der Bibliothek Warburg. B. G. Teubner.
Leipzig 1934. XXVIII und 333 S.
Die Veröffentlichungen der Bibliothek Warburg umfassen (um daran kurz zu
erinnern) drei Gruppen: die Studien; die Vorträge; die Gesammelten Schriften War-
burgs Bd. I u. II: Die Erneuerung der Heidnischen Antike, mit dem charakterisieren-
den Untertitel Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Geschichte der europäischen Re-
naissance. Zu ihnen tritt nun als vierte, unterbauend, ergänzend und vorausweisend,
die Kulturwissenschaftliche Bibliographie zum Nachleben der Antike. Ein stattlicher
Band in der bekannten vorzüglichen Ausstattung des Teubnerschen Verlags mit 1238
Buch-(oder Schriften-)titeln, knappen kritisch-orientierenden Berichten und ausführ-
lichen Registern, die das Ganze erschließen und als Nachschlagewerk brauchbar
machen, eröffnet vielverheißend und schon jetzt vielerfüllend diese neue Reihe. Daß
der Band „noch durchaus den Charakter des Experiments trägt", ist bei dem Umfang
des einzuordnenden Stoffes und der Weite des ins Auge gefaßten Zieles selbstverständ-
lich; der Benutzer wird nicht nur Nachsicht üben, sondern die reiche Gabe mit auf-
BESPRECHUNGEN
und Kultursystematik. Der folgende Aufsatz behandelt die Wirkung, die — fast zu-
fällig — der „Alpenkönig" des UrÖsterreichers Ferdinand Raimund auf das englische
Volk ausgeübt hat als eine „wild and singular German opera", trotz der — analy-
sierten — Verwässerung und Verflachung, die das Stück durch eine an seinem eigent-
lichen Zauber vorbeigehende Übersetzung erfuhr.
Die Sammlung schließt mit einem Aufsatz über Jakob Minor, als dessen Schüler
sich der Verfasser bekennt.
Wir haben über der Andeutung der behandelten literarhistorischen Fragen bis-
her die Tatsache verschwiegen, daß der Sammelband den eindeutigsten Beweis
schöpferischer Einfühlungs- und Nacherlebensgabe liefert durch drei Übersetzungen
nach dem unvergleichlichen Sprach- und Gedankenkünstler Milton. Es handelt sich
um die Übertragung von „Lycidas", „II Penseroso" und „L'Allegro", jener Werke
von erhabener Schönheit, die — dem Aufweis des Übersetzers zufolge — bisher in
teilweise höchst unwürdiger Verdeutschung vorgelegen haben. Das Recht zu Ver-
änderungen im Versmaß wie in der Reimtechnik ist dem Verfasser selbstverständlich
zuzugestehen, wenn es sich um eine Wiedergabe von Dichtungen handelt, deren
letzter Schmelz wesensgesetzlich niemals transformierbar ist. Der Versuch der Ver-
anschaulichung des vom Dichter Gemeinten erscheint gelungen und sicherlich des
Urtextes würdig. Vielleicht erlebt man als schönstes Stück die Umdichtung von
„II Penseroso". Hier sind für die Stimmung erflehter und rätselhafter Melancholie
mitunter ganz wundervolle Ausdrucksformen gefunden in Versen von dunkelvoka-
liger Fülle. (So Zeile 31 ff., 73 ff., 85 ff.). Auch die einleitenden Bemerkungen zur
Technik des Übersetzens regen in hohem Maße an, so der Hinweis, daß das Ohr
des deutschen Lesers unter dem Einfluß der Verse Wilhelm Büschs einfach nicht
mehr imstande sei, schwere Dichtung in der Form vierhebiger Verse mit Paarreimen
ohne Assoziationen aufzunehmen, die dem Thema gänzlich unangemessen sind.
Man scheidet von dem Sammelband so, daß man beim letzten Durchblättern
noch einmal festgehalten wird von diesen klaren, edlen und geschmeidigen Über-
tragungen, die man in dem Erlebnis, Köstlichstes übermittelt zu erhalten, wieder
bis zur letzten Zeile verfolgt.
Berlin. Katharina Heufelder.
Kulturwissenschaftliche Bibliographie zum Nachleben
der Antike. Erster Band: Die Erscheinungen des Jahres 1931. In Gemein-
schaft mit Fachgenossen bearbeitet von Hans Meier, Richard Newald, Edgar
Wind. Herausgegeben von der Bibliothek Warburg. B. G. Teubner.
Leipzig 1934. XXVIII und 333 S.
Die Veröffentlichungen der Bibliothek Warburg umfassen (um daran kurz zu
erinnern) drei Gruppen: die Studien; die Vorträge; die Gesammelten Schriften War-
burgs Bd. I u. II: Die Erneuerung der Heidnischen Antike, mit dem charakterisieren-
den Untertitel Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Geschichte der europäischen Re-
naissance. Zu ihnen tritt nun als vierte, unterbauend, ergänzend und vorausweisend,
die Kulturwissenschaftliche Bibliographie zum Nachleben der Antike. Ein stattlicher
Band in der bekannten vorzüglichen Ausstattung des Teubnerschen Verlags mit 1238
Buch-(oder Schriften-)titeln, knappen kritisch-orientierenden Berichten und ausführ-
lichen Registern, die das Ganze erschließen und als Nachschlagewerk brauchbar
machen, eröffnet vielverheißend und schon jetzt vielerfüllend diese neue Reihe. Daß
der Band „noch durchaus den Charakter des Experiments trägt", ist bei dem Umfang
des einzuordnenden Stoffes und der Weite des ins Auge gefaßten Zieles selbstverständ-
lich; der Benutzer wird nicht nur Nachsicht üben, sondern die reiche Gabe mit auf-