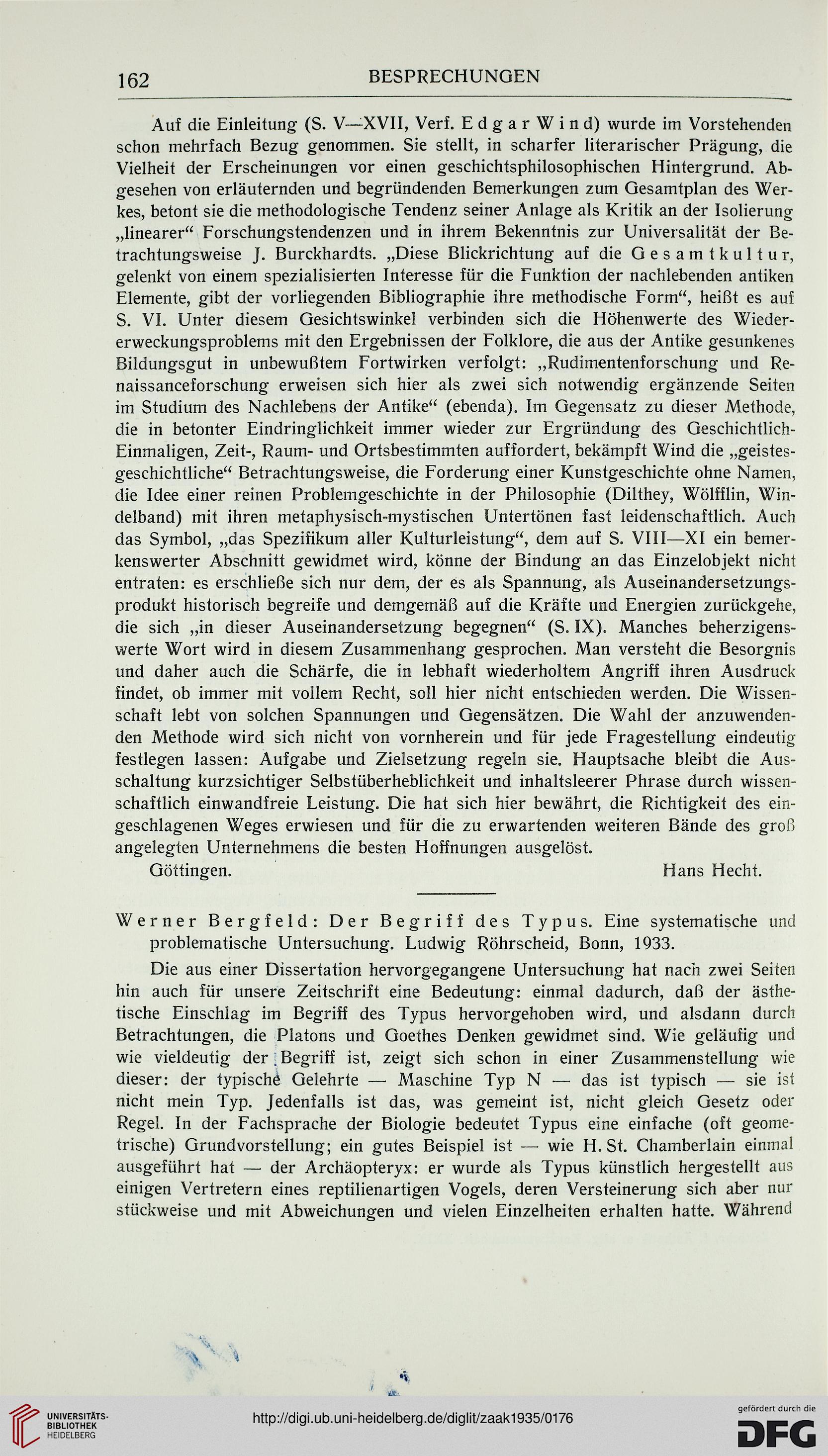162
BESPRECHUNGEN
Auf die Einleitung (S. V—XVII, Verf. EdgarWind) wurde im Vorstehenden
schon mehrfach Bezug genommen. Sie stellt, in scharfer literarischer Prägung, die
Vielheit der Erscheinungen vor einen geschichtsphilosophischen Hintergrund. Ab-
gesehen von erläuternden und begründenden Bemerkungen zum Gesamtplan des Wer-
kes, betont sie die methodologische Tendenz seiner Anlage als Kritik an der Isolierung
„linearer" Forschungstendenzen und in ihrem Bekenntnis zur Universalität der Be-
trachtungsweise J. Burckhardts. „Diese Blickrichtung auf die Gesamtkultur,
gelenkt von einem spezialisierten Interesse für die Funktion der nachlebenden antiken
Elemente, gibt der vorliegenden Bibliographie ihre methodische Form", heißt es auf
S. VI. Unter diesem Gesichtswinkel verbinden sich die Höhenwerte des Wieder-
erweckungsproblems mit den Ergebnissen der Folklore, die aus der Antike gesunkenes
Bildungsgut in unbewußtem Fortwirken verfolgt: „Rudimentenforschung und Re-
naissanceforschung erweisen sich hier als zwei sich notwendig ergänzende Seiten
im Studium des Nachlebens der Antike" (ebenda). Im Gegensatz zu dieser Methode,
die in betonter Eindringlichkeit immer wieder zur Ergründung des Geschichtlich-
Einmaligen, Zeit-, Raum- und Ortsbestimmten auffordert, bekämpft Wind die „geistes-
geschichtliche" Betrachtungsweise, die Forderung einer Kunstgeschichte ohne Namen,
die Idee einer reinen Problemgeschichte in der Philosophie (Dilthey, Wölfflin, Win-
delband) mit ihren metaphysisch-mystischen Untertönen fast leidenschaftlich. Auch
das Symbol, „das Spezifikum aller Kulturleistung", dem auf S. VIII—XI ein bemer-
kenswerter Abschnitt gewidmet wird, könne der Bindung an das Einzelobjekt nicht
entraten: es erschließe sich nur dem, der es als Spannung, als Auseinandersetzungs-
produkt historisch begreife und demgemäß auf die Kräfte und Energien zurückgehe,
die sich „in dieser Auseinandersetzung begegnen" (S. IX). Manches beherzigens-
werte Wort wird in diesem Zusammenhang gesprochen. Man versteht die Besorgnis
und daher auch die Schärfe, die in lebhaft wiederholtem Angriff ihren Ausdruck
findet, ob immer mit vollem Recht, soll hier nicht entschieden werden. Die Wissen-
schaft lebt von solchen Spannungen und Gegensätzen. Die Wahl der anzuwenden-
den Methode wird sich nicht von vornherein und für jede Fragestellung eindeutig
festlegen lassen: Aufgabe und Zielsetzung regeln sie. Hauptsache bleibt die Aus-
schaltung kurzsichtiger Selbstüberheblichkeit und inhaltsleerer Phrase durch wissen-
schaftlich einwandfreie Leistung. Die hat sich hier bewährt, die Richtigkeit des ein-
geschlagenen Weges erwiesen und für die zu erwartenden weiteren Bände des groß
angelegten Unternehmens die besten Hoffnungen ausgelöst.
Göttingen. Hans Hecht.
Werner Bergfeld: Der Begriff des Typus. Eine systematische und
problematische Untersuchung. Ludwig Röhrscheid, Bonn, 1933.
Die aus einer Dissertation hervorgegangene Untersuchung hat nach zwei Seiten
hin auch für unsere Zeitschrift eine Bedeutung: einmal dadurch, daß der ästhe-
tische Einschlag im Begriff des Typus hervorgehoben wird, und alsdann durch
Betrachtungen, die Piatons und Goethes Denken gewidmet sind. Wie geläufig und
wie vieldeutig der. Begriff ist, zeigt sich schon in einer Zusammenstellung wie
dieser: der typische" Gelehrte — Maschine Typ N — das ist typisch — sie ist
nicht mein Typ. Jedenfalls ist das, was gemeint ist, nicht gleich Gesetz oder
Regel. In der Fachsprache der Biologie bedeutet Typus eine einfache (oft geome-
trische) Grundvorstellung; ein gutes Beispiel ist — wie H. St. Chamberlain einmal
ausgeführt hat — der Archäopteryx: er wurde als Typus künstlich hergestellt aus
einigen Vertretern eines reptilienartigen Vogels, deren Versteinerung sich aber nur
stückweise und mit Abweichungen und vielen Einzelheiten erhalten hatte. Während
BESPRECHUNGEN
Auf die Einleitung (S. V—XVII, Verf. EdgarWind) wurde im Vorstehenden
schon mehrfach Bezug genommen. Sie stellt, in scharfer literarischer Prägung, die
Vielheit der Erscheinungen vor einen geschichtsphilosophischen Hintergrund. Ab-
gesehen von erläuternden und begründenden Bemerkungen zum Gesamtplan des Wer-
kes, betont sie die methodologische Tendenz seiner Anlage als Kritik an der Isolierung
„linearer" Forschungstendenzen und in ihrem Bekenntnis zur Universalität der Be-
trachtungsweise J. Burckhardts. „Diese Blickrichtung auf die Gesamtkultur,
gelenkt von einem spezialisierten Interesse für die Funktion der nachlebenden antiken
Elemente, gibt der vorliegenden Bibliographie ihre methodische Form", heißt es auf
S. VI. Unter diesem Gesichtswinkel verbinden sich die Höhenwerte des Wieder-
erweckungsproblems mit den Ergebnissen der Folklore, die aus der Antike gesunkenes
Bildungsgut in unbewußtem Fortwirken verfolgt: „Rudimentenforschung und Re-
naissanceforschung erweisen sich hier als zwei sich notwendig ergänzende Seiten
im Studium des Nachlebens der Antike" (ebenda). Im Gegensatz zu dieser Methode,
die in betonter Eindringlichkeit immer wieder zur Ergründung des Geschichtlich-
Einmaligen, Zeit-, Raum- und Ortsbestimmten auffordert, bekämpft Wind die „geistes-
geschichtliche" Betrachtungsweise, die Forderung einer Kunstgeschichte ohne Namen,
die Idee einer reinen Problemgeschichte in der Philosophie (Dilthey, Wölfflin, Win-
delband) mit ihren metaphysisch-mystischen Untertönen fast leidenschaftlich. Auch
das Symbol, „das Spezifikum aller Kulturleistung", dem auf S. VIII—XI ein bemer-
kenswerter Abschnitt gewidmet wird, könne der Bindung an das Einzelobjekt nicht
entraten: es erschließe sich nur dem, der es als Spannung, als Auseinandersetzungs-
produkt historisch begreife und demgemäß auf die Kräfte und Energien zurückgehe,
die sich „in dieser Auseinandersetzung begegnen" (S. IX). Manches beherzigens-
werte Wort wird in diesem Zusammenhang gesprochen. Man versteht die Besorgnis
und daher auch die Schärfe, die in lebhaft wiederholtem Angriff ihren Ausdruck
findet, ob immer mit vollem Recht, soll hier nicht entschieden werden. Die Wissen-
schaft lebt von solchen Spannungen und Gegensätzen. Die Wahl der anzuwenden-
den Methode wird sich nicht von vornherein und für jede Fragestellung eindeutig
festlegen lassen: Aufgabe und Zielsetzung regeln sie. Hauptsache bleibt die Aus-
schaltung kurzsichtiger Selbstüberheblichkeit und inhaltsleerer Phrase durch wissen-
schaftlich einwandfreie Leistung. Die hat sich hier bewährt, die Richtigkeit des ein-
geschlagenen Weges erwiesen und für die zu erwartenden weiteren Bände des groß
angelegten Unternehmens die besten Hoffnungen ausgelöst.
Göttingen. Hans Hecht.
Werner Bergfeld: Der Begriff des Typus. Eine systematische und
problematische Untersuchung. Ludwig Röhrscheid, Bonn, 1933.
Die aus einer Dissertation hervorgegangene Untersuchung hat nach zwei Seiten
hin auch für unsere Zeitschrift eine Bedeutung: einmal dadurch, daß der ästhe-
tische Einschlag im Begriff des Typus hervorgehoben wird, und alsdann durch
Betrachtungen, die Piatons und Goethes Denken gewidmet sind. Wie geläufig und
wie vieldeutig der. Begriff ist, zeigt sich schon in einer Zusammenstellung wie
dieser: der typische" Gelehrte — Maschine Typ N — das ist typisch — sie ist
nicht mein Typ. Jedenfalls ist das, was gemeint ist, nicht gleich Gesetz oder
Regel. In der Fachsprache der Biologie bedeutet Typus eine einfache (oft geome-
trische) Grundvorstellung; ein gutes Beispiel ist — wie H. St. Chamberlain einmal
ausgeführt hat — der Archäopteryx: er wurde als Typus künstlich hergestellt aus
einigen Vertretern eines reptilienartigen Vogels, deren Versteinerung sich aber nur
stückweise und mit Abweichungen und vielen Einzelheiten erhalten hatte. Während