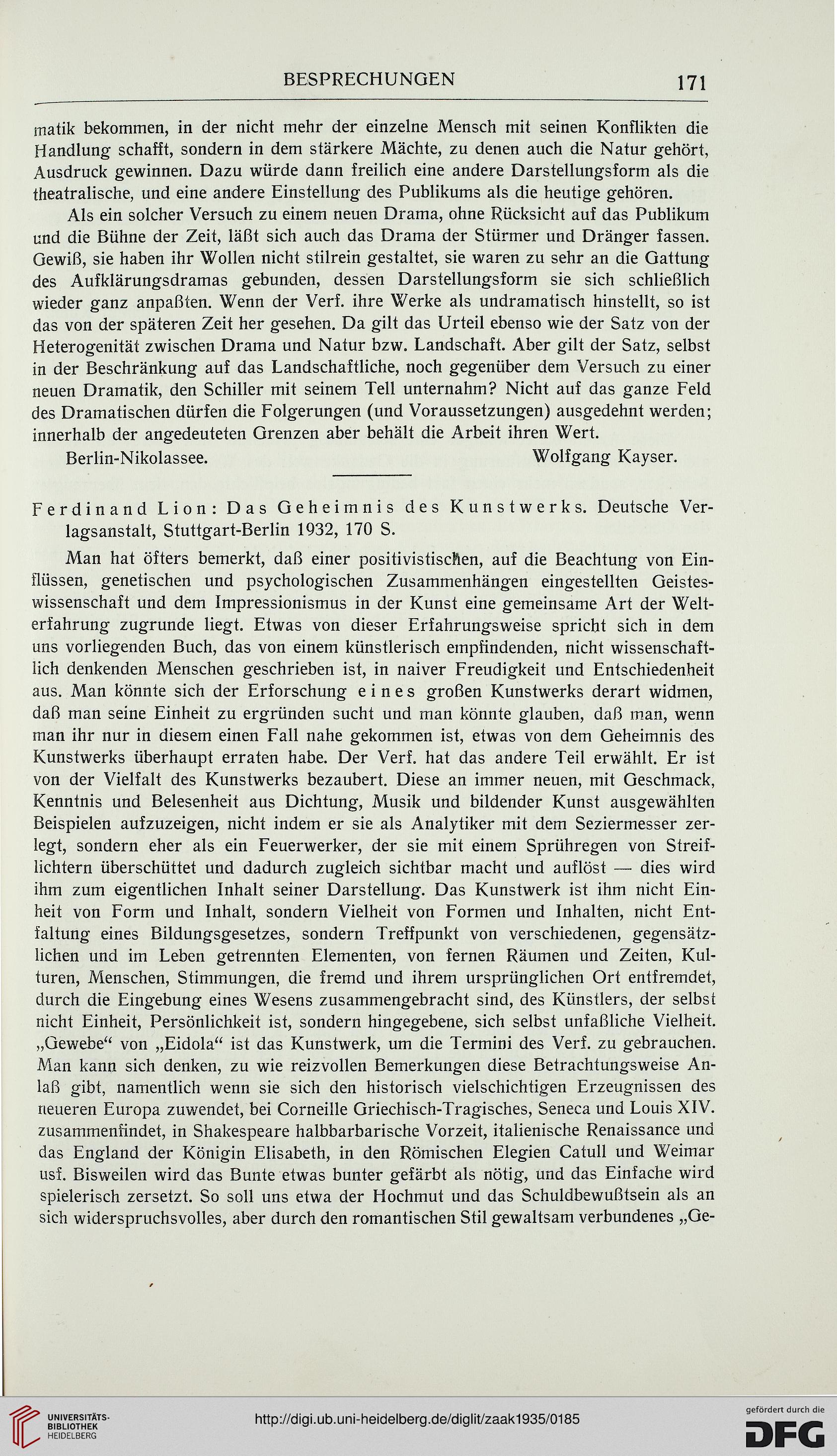BESPRECHUNGEN
171
matik bekommen, in der nicht mehr der einzelne Mensch mit seinen Konflikten die
Handlung schafft, sondern in dem stärkere Mächte, zu denen auch die Natur gehört,
Ausdruck gewinnen. Dazu würde dann freilich eine andere Darstellungsform als die
theatralische, und eine andere Einstellung des Publikums als die heutige gehören.
Als ein solcher Versuch zu einem neuen Drama, ohne Rücksicht auf das Publikum
und die Bühne der Zeit, läßt sich auch das Drama der Stürmer und Dränger fassen.
Gewiß, sie haben ihr Wollen nicht stilrein gestaltet, sie waren zu sehr an die Gattung
des Aufklärungsdramas gebunden, dessen Darstellungsform sie sich schließlich
wieder ganz anpaßten. Wenn der Verf. ihre Werke als undramatisch hinstellt, so ist
das von der späteren Zeit her gesehen. Da gilt das Urteil ebenso wie der Satz von der
Heterogenität zwischen Drama und Natur bzw. Landschaft. Aber gilt der Satz, selbst
in der Beschränkung auf das Landschaftliche, noch gegenüber dem Versuch zu einer
neuen Dramatik, den Schiller mit seinem Teil unternahm? Nicht auf das ganze Feld
des Dramatischen dürfen die Folgerungen (und Voraussetzungen) ausgedehnt werden;
innerhalb der angedeuteten Grenzen aber behält die Arbeit ihren Wert.
Berlin-Nikolassee. Wolfgang Kayser.
Ferdinand Lion: Das Geheimnis des Kunstwerks. Deutsche Ver-
lagsanstalt, Stuttgart-Berlin 1932, 170 S.
Man hat öfters bemerkt, daß einer positivistischen, auf die Beachtung von Ein-
flüssen, genetischen und psychologischen Zusammenhängen eingestellten Geistes-
wissenschaft und dem Impressionismus in der Kunst eine gemeinsame Art der Welt-
erfahrung zugrunde liegt. Etwas von dieser Erfahrungsweise spricht sich in dem
uns vorliegenden Buch, das von einem künstlerisch empfindenden, nicht wissenschaft-
lich denkenden Menschen geschrieben ist, in naiver Freudigkeit und Entschiedenheit
aus. Man könnte sich der Erforschung eines großen Kunstwerks derart widmen,
daß man seine Einheit zu ergründen sucht und man könnte glauben, daß man, wenn
man ihr nur in diesem einen Fall nahe gekommen ist, etwas von dem Geheimnis des
Kunstwerks überhaupt erraten habe. Der Verf. hat das andere Teil erwählt. Er ist
von der Vielfalt des Kunstwerks bezaubert. Diese an immer neuen, mit Geschmack,
Kenntnis und Belesenheit aus Dichtung, Musik und bildender Kunst ausgewählten
Beispielen aufzuzeigen, nicht indem er sie als Analytiker mit dem Seziermesser zer-
legt, sondern eher als ein Feuerwerker, der sie mit einem Sprühregen von Streif-
lichtern überschüttet und dadurch zugleich sichtbar macht und auflöst —■ dies wird
ihm zum eigentlichen Inhalt seiner Darstellung. Das Kunstwerk ist ihm nicht Ein-
heit von Form und Inhalt, sondern Vielheit von Formen und Inhalten, nicht Ent-
faltung eines Bildungsgesetzes, sondern Treffpunkt von verschiedenen, gegensätz-
lichen und im Leben getrennten Elementen, von fernen Räumen und Zeiten, Kul-
turen, Menschen, Stimmungen, die fremd und ihrem ursprünglichen Ort entfremdet,
durch die Eingebung eines Wesens zusammengebracht sind, des Künstlers, der selbst
nicht Einheit, Persönlichkeit ist, sondern hingegebene, sich selbst unfaßliche Vielheit.
„Gewebe" von „Eidola" ist das Kunstwerk, um die Termini des Verf. zu gebrauchen.
Man kann sich denken, zu wie reizvollen Bemerkungen diese Betrachtungsweise An-
laß gibt, namentlich wenn sie sich den historisch vielschichtigen Erzeugnissen des
neueren Europa zuwendet, bei Corneille Griechisch-Tragisches, Seneca und Louis XIV.
zusammenfindet, in Shakespeare halbbarbarische Vorzeit, italienische Renaissance und
das England der Königin Elisabeth, in den Römischen Elegien Catull und Weimar
usf. Bisweilen wird das Bunte etwas bunter gefärbt als nötig, und das Einfache wird
spielerisch zersetzt. So soll uns etwa der Hochmut und das Schuldbewußtsein als an
sich widerspruchsvolles, aber durch den romantischen Stil gewaltsam verbundenes „Ge-
171
matik bekommen, in der nicht mehr der einzelne Mensch mit seinen Konflikten die
Handlung schafft, sondern in dem stärkere Mächte, zu denen auch die Natur gehört,
Ausdruck gewinnen. Dazu würde dann freilich eine andere Darstellungsform als die
theatralische, und eine andere Einstellung des Publikums als die heutige gehören.
Als ein solcher Versuch zu einem neuen Drama, ohne Rücksicht auf das Publikum
und die Bühne der Zeit, läßt sich auch das Drama der Stürmer und Dränger fassen.
Gewiß, sie haben ihr Wollen nicht stilrein gestaltet, sie waren zu sehr an die Gattung
des Aufklärungsdramas gebunden, dessen Darstellungsform sie sich schließlich
wieder ganz anpaßten. Wenn der Verf. ihre Werke als undramatisch hinstellt, so ist
das von der späteren Zeit her gesehen. Da gilt das Urteil ebenso wie der Satz von der
Heterogenität zwischen Drama und Natur bzw. Landschaft. Aber gilt der Satz, selbst
in der Beschränkung auf das Landschaftliche, noch gegenüber dem Versuch zu einer
neuen Dramatik, den Schiller mit seinem Teil unternahm? Nicht auf das ganze Feld
des Dramatischen dürfen die Folgerungen (und Voraussetzungen) ausgedehnt werden;
innerhalb der angedeuteten Grenzen aber behält die Arbeit ihren Wert.
Berlin-Nikolassee. Wolfgang Kayser.
Ferdinand Lion: Das Geheimnis des Kunstwerks. Deutsche Ver-
lagsanstalt, Stuttgart-Berlin 1932, 170 S.
Man hat öfters bemerkt, daß einer positivistischen, auf die Beachtung von Ein-
flüssen, genetischen und psychologischen Zusammenhängen eingestellten Geistes-
wissenschaft und dem Impressionismus in der Kunst eine gemeinsame Art der Welt-
erfahrung zugrunde liegt. Etwas von dieser Erfahrungsweise spricht sich in dem
uns vorliegenden Buch, das von einem künstlerisch empfindenden, nicht wissenschaft-
lich denkenden Menschen geschrieben ist, in naiver Freudigkeit und Entschiedenheit
aus. Man könnte sich der Erforschung eines großen Kunstwerks derart widmen,
daß man seine Einheit zu ergründen sucht und man könnte glauben, daß man, wenn
man ihr nur in diesem einen Fall nahe gekommen ist, etwas von dem Geheimnis des
Kunstwerks überhaupt erraten habe. Der Verf. hat das andere Teil erwählt. Er ist
von der Vielfalt des Kunstwerks bezaubert. Diese an immer neuen, mit Geschmack,
Kenntnis und Belesenheit aus Dichtung, Musik und bildender Kunst ausgewählten
Beispielen aufzuzeigen, nicht indem er sie als Analytiker mit dem Seziermesser zer-
legt, sondern eher als ein Feuerwerker, der sie mit einem Sprühregen von Streif-
lichtern überschüttet und dadurch zugleich sichtbar macht und auflöst —■ dies wird
ihm zum eigentlichen Inhalt seiner Darstellung. Das Kunstwerk ist ihm nicht Ein-
heit von Form und Inhalt, sondern Vielheit von Formen und Inhalten, nicht Ent-
faltung eines Bildungsgesetzes, sondern Treffpunkt von verschiedenen, gegensätz-
lichen und im Leben getrennten Elementen, von fernen Räumen und Zeiten, Kul-
turen, Menschen, Stimmungen, die fremd und ihrem ursprünglichen Ort entfremdet,
durch die Eingebung eines Wesens zusammengebracht sind, des Künstlers, der selbst
nicht Einheit, Persönlichkeit ist, sondern hingegebene, sich selbst unfaßliche Vielheit.
„Gewebe" von „Eidola" ist das Kunstwerk, um die Termini des Verf. zu gebrauchen.
Man kann sich denken, zu wie reizvollen Bemerkungen diese Betrachtungsweise An-
laß gibt, namentlich wenn sie sich den historisch vielschichtigen Erzeugnissen des
neueren Europa zuwendet, bei Corneille Griechisch-Tragisches, Seneca und Louis XIV.
zusammenfindet, in Shakespeare halbbarbarische Vorzeit, italienische Renaissance und
das England der Königin Elisabeth, in den Römischen Elegien Catull und Weimar
usf. Bisweilen wird das Bunte etwas bunter gefärbt als nötig, und das Einfache wird
spielerisch zersetzt. So soll uns etwa der Hochmut und das Schuldbewußtsein als an
sich widerspruchsvolles, aber durch den romantischen Stil gewaltsam verbundenes „Ge-