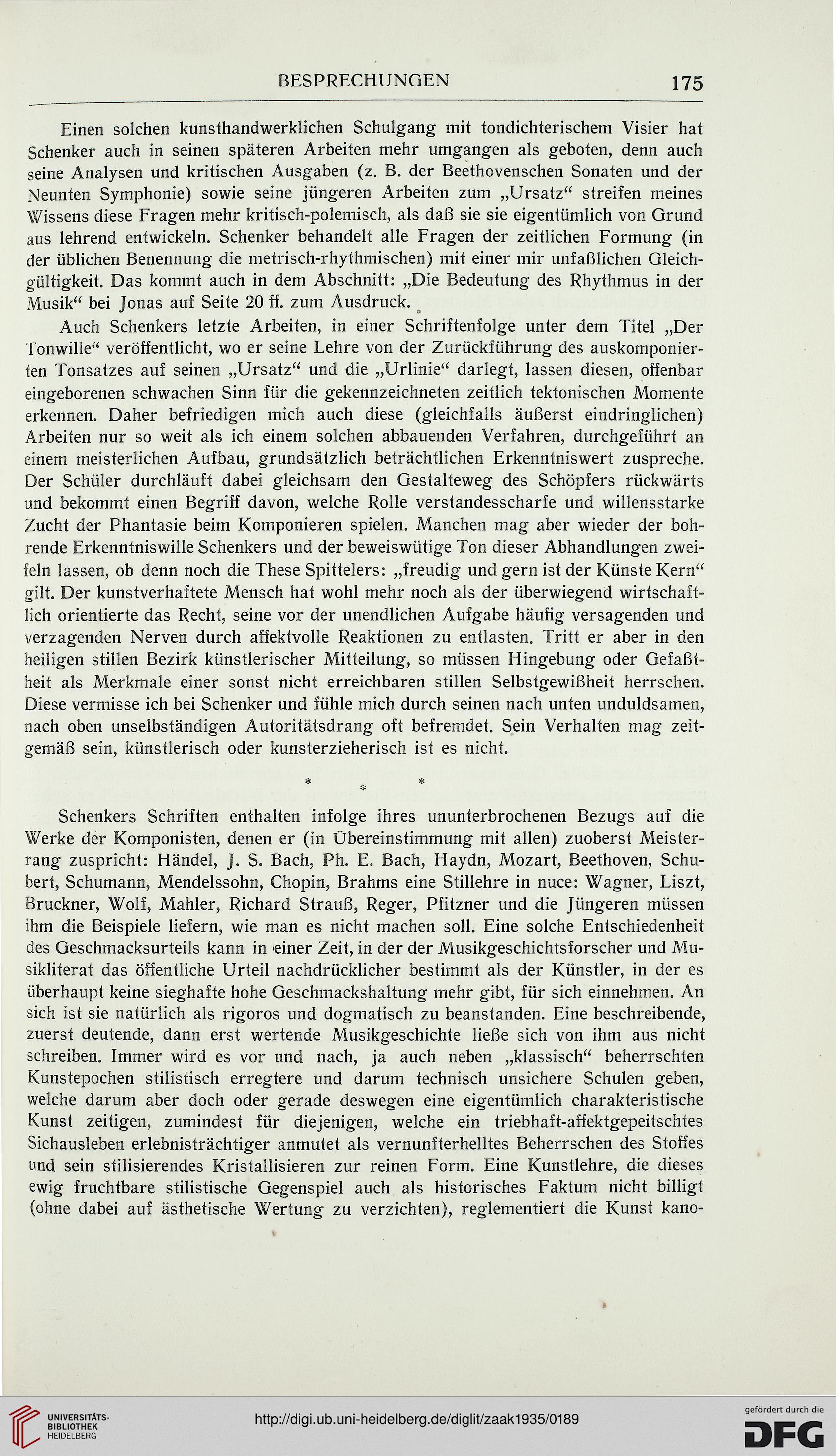BESPRECHUNGEN
175
Einen solchen kunsthandwerklichen Schulgang mit tondichterischem Visier hat
Schenker auch in seinen späteren Arbeiten mehr umgangen als geboten, denn auch
seine Analysen und kritischen Ausgaben (z. B. der Beethovenschen Sonaten und der
Neunten Symphonie) sowie seine jüngeren Arbeiten zum „Ursatz" streifen meines
Wissens diese Fragen mehr kritisch-polemisch, als daß sie sie eigentümlich von Grund
aus lehrend entwickeln. Schenker behandelt alle Fragen der zeitlichen Formung (in
der üblichen Benennung die metrisch-rhythmischen) mit einer mir unfaßlichen Gleich-
gültigkeit. Das kommt auch in dem Abschnitt: „Die Bedeutung des Rhythmus in der
Musik" bei Jonas auf Seite 20 ff. zum Ausdruck. m
Auch Schenkers letzte Arbeiten, in einer Schriftenfolge unter dem Titel „Der
Tonwille" veröffentlicht, wo er seine Lehre von der Zurückführung des auskomponier-
ten Tonsatzes auf seinen „Ursatz" und die „Urlinie" darlegt, lassen diesen, offenbar
eingeborenen schwachen Sinn für die gekennzeichneten zeitlich tektonischen Momente
erkennen. Daher befriedigen mich auch diese (gleichfalls äußerst eindringlichen)
Arbeiten nur so weit als ich einem solchen abbauenden Verfahren, durchgeführt an
einem meisterlichen Aufbau, grundsätzlich beträchtlichen Erkenntniswert zuspreche.
Der Schüler durchläuft dabei gleichsam den Gestalteweg des Schöpfers rückwärts
und bekommt einen Begriff davon, welche Rolle verstandesscharfe und willensstarke
Zucht der Phantasie beim Komponieren spielen. Manchen mag aber wieder der boh-
rende Erkenntniswille Schenkers und der beweiswütige Ton dieser Abhandlungen zwei-
feln lassen, ob denn noch die These Spittelers: „freudig und gern ist der Künste Kern"
gilt. Der kunstverhaftete Mensch hat wohl mehr noch als der überwiegend wirtschaft-
lich orientierte das Recht, seine vor der unendlichen Aufgabe häufig versagenden und
verzagenden Nerven durch affektvolle Reaktionen zu entlasten. Tritt er aber in den
heiligen stillen Bezirk künstlerischer Mitteilung, so müssen Hingebung oder Gefaßt-
heit als Merkmale einer sonst nicht erreichbaren stillen Selbstgewißheit herrschen.
Diese vermisse ich bei Schenker und fühle mich durch seinen nach unten unduldsamen,
nach oben unselbständigen Autoritätsdrang oft befremdet. Sein Verhalten mag zeit-
gemäß sein, künstlerisch oder kunsterzieherisch ist es nicht.
* *
Schenkers Schriften enthalten infolge ihres ununterbrochenen Bezugs auf die
Werke der Komponisten, denen er (in Übereinstimmung mit allen) zuoberst Meister-
rang zuspricht: Händel, J. S. Bach, Ph. E. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schu-
bert, Schumann, Mendelssohn, Chopin, Brahms eine Stillehre in nuce: Wagner, Liszt,
Bruckner, Wolf, Mahler, Richard Strauß, Reger, Pfitzner und die Jüngeren müssen
ihm die Beispiele liefern, wie man es nicht machen soll. Eine solche Entschiedenheit
des Geschmacksurteils kann in einer Zeit, in der der Musikgeschichtsforscher und Mu-
sikliterat das öffentliche Urteil nachdrücklicher bestimmt als der Künstler, in der es
überhaupt keine sieghafte hohe Geschmackshaltung mehr gibt, für sich einnehmen. An
sich ist sie natürlich als rigoros und dogmatisch zu beanstanden. Eine beschreibende,
zuerst deutende, dann erst wertende Musikgeschichte ließe sich von ihm aus nicht
schreiben. Immer wird es vor und nach, ja auch neben „klassisch" beherrschten
Kunstepochen stilistisch erregtere und darum technisch unsichere Schulen geben,
welche darum aber doch oder gerade deswegen eine eigentümlich charakteristische
Kunst zeitigen, zumindest für diejenigen, welche ein triebhaft-affektgepeitschtes
Sichausleben erlebnisträchtiger anmutet als vernunfterhelltes Beherrschen des Stoffes
und sein stilisierendes Kristallisieren zur reinen Form. Eine Kunstlehre, die dieses
ewig fruchtbare stilistische Gegenspiel auch als historisches Faktum nicht billigt
(ohne dabei auf ästhetische Wertung zu verzichten), reglementiert die Kunst kano-
175
Einen solchen kunsthandwerklichen Schulgang mit tondichterischem Visier hat
Schenker auch in seinen späteren Arbeiten mehr umgangen als geboten, denn auch
seine Analysen und kritischen Ausgaben (z. B. der Beethovenschen Sonaten und der
Neunten Symphonie) sowie seine jüngeren Arbeiten zum „Ursatz" streifen meines
Wissens diese Fragen mehr kritisch-polemisch, als daß sie sie eigentümlich von Grund
aus lehrend entwickeln. Schenker behandelt alle Fragen der zeitlichen Formung (in
der üblichen Benennung die metrisch-rhythmischen) mit einer mir unfaßlichen Gleich-
gültigkeit. Das kommt auch in dem Abschnitt: „Die Bedeutung des Rhythmus in der
Musik" bei Jonas auf Seite 20 ff. zum Ausdruck. m
Auch Schenkers letzte Arbeiten, in einer Schriftenfolge unter dem Titel „Der
Tonwille" veröffentlicht, wo er seine Lehre von der Zurückführung des auskomponier-
ten Tonsatzes auf seinen „Ursatz" und die „Urlinie" darlegt, lassen diesen, offenbar
eingeborenen schwachen Sinn für die gekennzeichneten zeitlich tektonischen Momente
erkennen. Daher befriedigen mich auch diese (gleichfalls äußerst eindringlichen)
Arbeiten nur so weit als ich einem solchen abbauenden Verfahren, durchgeführt an
einem meisterlichen Aufbau, grundsätzlich beträchtlichen Erkenntniswert zuspreche.
Der Schüler durchläuft dabei gleichsam den Gestalteweg des Schöpfers rückwärts
und bekommt einen Begriff davon, welche Rolle verstandesscharfe und willensstarke
Zucht der Phantasie beim Komponieren spielen. Manchen mag aber wieder der boh-
rende Erkenntniswille Schenkers und der beweiswütige Ton dieser Abhandlungen zwei-
feln lassen, ob denn noch die These Spittelers: „freudig und gern ist der Künste Kern"
gilt. Der kunstverhaftete Mensch hat wohl mehr noch als der überwiegend wirtschaft-
lich orientierte das Recht, seine vor der unendlichen Aufgabe häufig versagenden und
verzagenden Nerven durch affektvolle Reaktionen zu entlasten. Tritt er aber in den
heiligen stillen Bezirk künstlerischer Mitteilung, so müssen Hingebung oder Gefaßt-
heit als Merkmale einer sonst nicht erreichbaren stillen Selbstgewißheit herrschen.
Diese vermisse ich bei Schenker und fühle mich durch seinen nach unten unduldsamen,
nach oben unselbständigen Autoritätsdrang oft befremdet. Sein Verhalten mag zeit-
gemäß sein, künstlerisch oder kunsterzieherisch ist es nicht.
* *
Schenkers Schriften enthalten infolge ihres ununterbrochenen Bezugs auf die
Werke der Komponisten, denen er (in Übereinstimmung mit allen) zuoberst Meister-
rang zuspricht: Händel, J. S. Bach, Ph. E. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schu-
bert, Schumann, Mendelssohn, Chopin, Brahms eine Stillehre in nuce: Wagner, Liszt,
Bruckner, Wolf, Mahler, Richard Strauß, Reger, Pfitzner und die Jüngeren müssen
ihm die Beispiele liefern, wie man es nicht machen soll. Eine solche Entschiedenheit
des Geschmacksurteils kann in einer Zeit, in der der Musikgeschichtsforscher und Mu-
sikliterat das öffentliche Urteil nachdrücklicher bestimmt als der Künstler, in der es
überhaupt keine sieghafte hohe Geschmackshaltung mehr gibt, für sich einnehmen. An
sich ist sie natürlich als rigoros und dogmatisch zu beanstanden. Eine beschreibende,
zuerst deutende, dann erst wertende Musikgeschichte ließe sich von ihm aus nicht
schreiben. Immer wird es vor und nach, ja auch neben „klassisch" beherrschten
Kunstepochen stilistisch erregtere und darum technisch unsichere Schulen geben,
welche darum aber doch oder gerade deswegen eine eigentümlich charakteristische
Kunst zeitigen, zumindest für diejenigen, welche ein triebhaft-affektgepeitschtes
Sichausleben erlebnisträchtiger anmutet als vernunfterhelltes Beherrschen des Stoffes
und sein stilisierendes Kristallisieren zur reinen Form. Eine Kunstlehre, die dieses
ewig fruchtbare stilistische Gegenspiel auch als historisches Faktum nicht billigt
(ohne dabei auf ästhetische Wertung zu verzichten), reglementiert die Kunst kano-