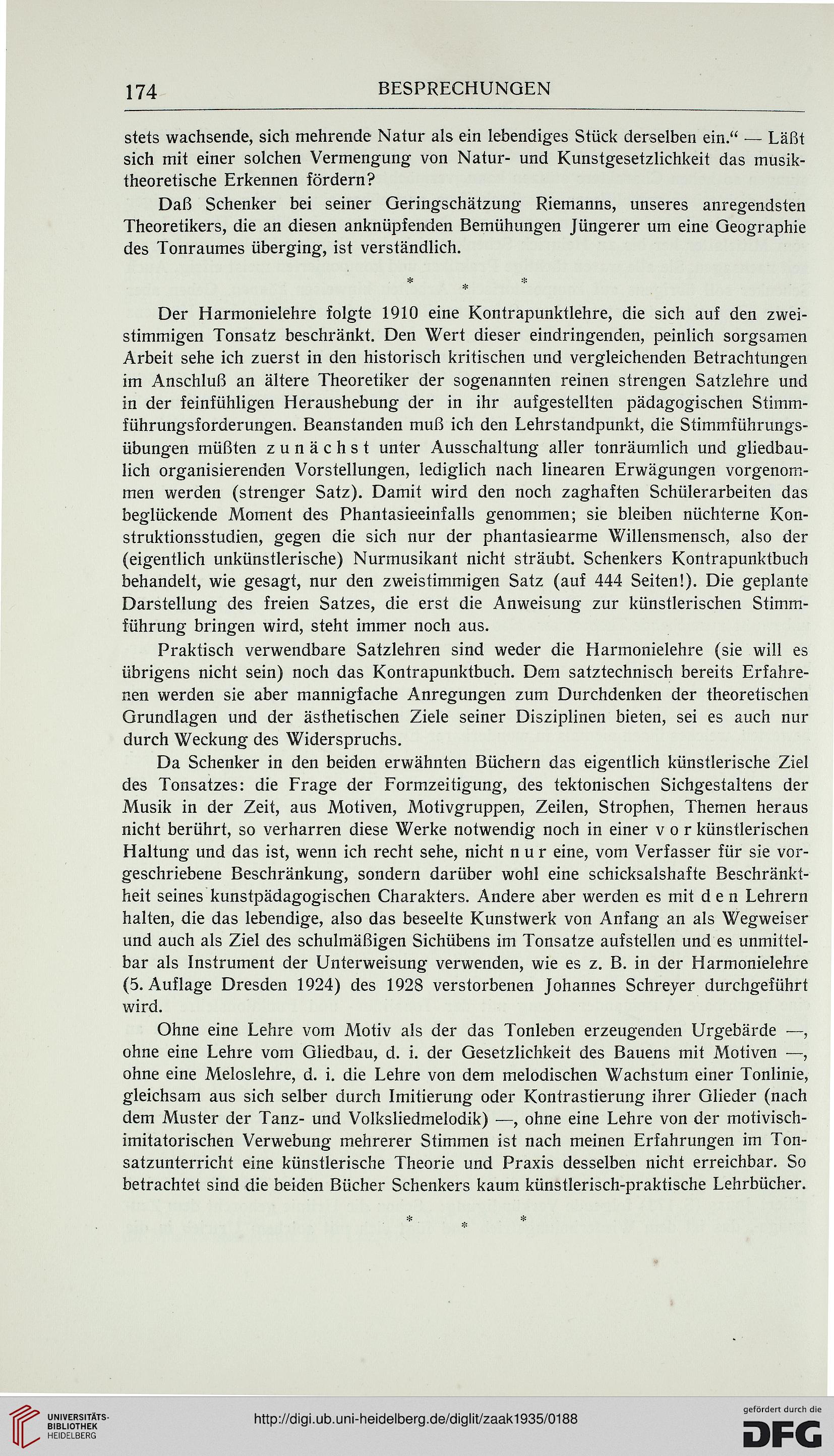174
BESPRECHUNGEN
stets wachsende, sich mehrende Natur als ein lebendiges Stück derselben ein.u — Läßt
sich mit einer solchen Vermengung von Natur- und Kunstgesetzlichkeit das musik-
theoretische Erkennen fördern?
Daß Schenker bei seiner Geringschätzung Riemanns, unseres anregendsten
Theoretikers, die an diesen anknüpfenden Bemühungen Jüngerer um eine Geographie
des Tonraumes überging, ist verständlich.
* *
Der Harmonielehre folgte 1910 eine Kontrapunktlehre, die sich auf den zwei-
stimmigen Tonsatz beschränkt. Den Wert dieser eindringenden, peinlich sorgsamen
Arbeit sehe ich zuerst in den historisch kritischen und vergleichenden Betrachtungen
im Anschluß an ältere Theoretiker der sogenannten reinen strengen Satzlehre und
in der feinfühligen Heraushebung der in ihr aufgestellten pädagogischen Stimm-
führungsforderungen. Beanstanden muß ich den Lehrstandpunkt, die Stimmführungs-
übungen müßten zunächst unter Ausschaltung aller tonräumlich und gliedbau-
lich organisierenden Vorstellungen, lediglich nach linearen Erwägungen vorgenom-
men werden (strenger Satz). Damit wird den noch zaghaften Schülerarbeiten das
beglückende Moment des Phantasieeinfalls genommen; sie bleiben nüchterne Kon-
struktionsstudien, gegen die sich nur der phantasiearme Willensmensch, also der
(eigentlich unkünstlerische) Nurmusikant nicht sträubt. Schenkers Kontrapunktbuch
behandelt, wie gesagt, nur den zweistimmigen Satz (auf 444 Seiten!). Die geplante
Darstellung des freien Satzes, die erst die Anweisung zur künstlerischen Stimm-
führung bringen wird, steht immer noch aus.
Praktisch verwendbare Satzlehren sind weder die Harmonielehre (sie will es
übrigens nicht sein) noch das Kontrapunktbuch. Dem satztechnisch bereits Erfahre-
nen werden sie aber mannigfache Anregungen zum Durchdenken der theoretischen
Grundlagen und der ästhetischen Ziele seiner Disziplinen bieten, sei es auch nur
durch Weckung des Widerspruchs.
Da Schenker in den beiden erwähnten Büchern das eigentlich künstlerische Ziel
des Tonsatzes: die Frage der Formzeitigung, des tektonischen Sichgestaltens der
Musik in der Zeit, aus Motiven, Motivgruppen, Zeilen, Strophen, Themen heraus
nicht berührt, so verharren diese Werke notwendig noch in einer vor künstlerischen
Haltung und das ist, wenn ich recht sehe, nicht nur eine, vom Verfasser für sie vor-
geschriebene Beschränkung, sondern darüber wohl eine schicksalshafte Beschränkt-
heit seines kunstpädagogischen Charakters. Andere aber werden es mit den Lehrern
halten, die das lebendige, also das beseelte Kunstwerk von Anfang an als Wegweiser
und auch als Ziel des schulmäßigen Sichübens im Tonsatze aufstellen und es unmittel-
bar als Instrument der Unterweisung verwenden, wie es z. B. in der Harmonielehre
(5. Auflage Dresden 1924) des 1928 verstorbenen Johannes Schreyer durchgeführt
wird.
Ohne eine Lehre vom Motiv als der das Tonleben erzeugenden Urgebärde —,
ohne eine Lehre vom Gliedbau, d. i. der Gesetzlichkeit des Bauens mit Motiven —,
ohne eine Meloslehre, d. i. die Lehre von dem melodischen Wachstum einer Tonlinie,
gleichsam aus sich selber durch Imitierung oder Kontrastierung ihrer Glieder (nach
dem Muster der Tanz- und Volksliedmelodik) —, ohne eine Lehre von der motivisch-
imitatorischen Verwebung mehrerer Stimmen ist nach meinen Erfahrungen im Ton-
satzunterricht eine künstlerische Theorie und Praxis desselben nicht erreichbar. So
betrachtet sind die beiden Bücher Schenkers kaum künstlerisch-praktische Lehrbücher.
BESPRECHUNGEN
stets wachsende, sich mehrende Natur als ein lebendiges Stück derselben ein.u — Läßt
sich mit einer solchen Vermengung von Natur- und Kunstgesetzlichkeit das musik-
theoretische Erkennen fördern?
Daß Schenker bei seiner Geringschätzung Riemanns, unseres anregendsten
Theoretikers, die an diesen anknüpfenden Bemühungen Jüngerer um eine Geographie
des Tonraumes überging, ist verständlich.
* *
Der Harmonielehre folgte 1910 eine Kontrapunktlehre, die sich auf den zwei-
stimmigen Tonsatz beschränkt. Den Wert dieser eindringenden, peinlich sorgsamen
Arbeit sehe ich zuerst in den historisch kritischen und vergleichenden Betrachtungen
im Anschluß an ältere Theoretiker der sogenannten reinen strengen Satzlehre und
in der feinfühligen Heraushebung der in ihr aufgestellten pädagogischen Stimm-
führungsforderungen. Beanstanden muß ich den Lehrstandpunkt, die Stimmführungs-
übungen müßten zunächst unter Ausschaltung aller tonräumlich und gliedbau-
lich organisierenden Vorstellungen, lediglich nach linearen Erwägungen vorgenom-
men werden (strenger Satz). Damit wird den noch zaghaften Schülerarbeiten das
beglückende Moment des Phantasieeinfalls genommen; sie bleiben nüchterne Kon-
struktionsstudien, gegen die sich nur der phantasiearme Willensmensch, also der
(eigentlich unkünstlerische) Nurmusikant nicht sträubt. Schenkers Kontrapunktbuch
behandelt, wie gesagt, nur den zweistimmigen Satz (auf 444 Seiten!). Die geplante
Darstellung des freien Satzes, die erst die Anweisung zur künstlerischen Stimm-
führung bringen wird, steht immer noch aus.
Praktisch verwendbare Satzlehren sind weder die Harmonielehre (sie will es
übrigens nicht sein) noch das Kontrapunktbuch. Dem satztechnisch bereits Erfahre-
nen werden sie aber mannigfache Anregungen zum Durchdenken der theoretischen
Grundlagen und der ästhetischen Ziele seiner Disziplinen bieten, sei es auch nur
durch Weckung des Widerspruchs.
Da Schenker in den beiden erwähnten Büchern das eigentlich künstlerische Ziel
des Tonsatzes: die Frage der Formzeitigung, des tektonischen Sichgestaltens der
Musik in der Zeit, aus Motiven, Motivgruppen, Zeilen, Strophen, Themen heraus
nicht berührt, so verharren diese Werke notwendig noch in einer vor künstlerischen
Haltung und das ist, wenn ich recht sehe, nicht nur eine, vom Verfasser für sie vor-
geschriebene Beschränkung, sondern darüber wohl eine schicksalshafte Beschränkt-
heit seines kunstpädagogischen Charakters. Andere aber werden es mit den Lehrern
halten, die das lebendige, also das beseelte Kunstwerk von Anfang an als Wegweiser
und auch als Ziel des schulmäßigen Sichübens im Tonsatze aufstellen und es unmittel-
bar als Instrument der Unterweisung verwenden, wie es z. B. in der Harmonielehre
(5. Auflage Dresden 1924) des 1928 verstorbenen Johannes Schreyer durchgeführt
wird.
Ohne eine Lehre vom Motiv als der das Tonleben erzeugenden Urgebärde —,
ohne eine Lehre vom Gliedbau, d. i. der Gesetzlichkeit des Bauens mit Motiven —,
ohne eine Meloslehre, d. i. die Lehre von dem melodischen Wachstum einer Tonlinie,
gleichsam aus sich selber durch Imitierung oder Kontrastierung ihrer Glieder (nach
dem Muster der Tanz- und Volksliedmelodik) —, ohne eine Lehre von der motivisch-
imitatorischen Verwebung mehrerer Stimmen ist nach meinen Erfahrungen im Ton-
satzunterricht eine künstlerische Theorie und Praxis desselben nicht erreichbar. So
betrachtet sind die beiden Bücher Schenkers kaum künstlerisch-praktische Lehrbücher.