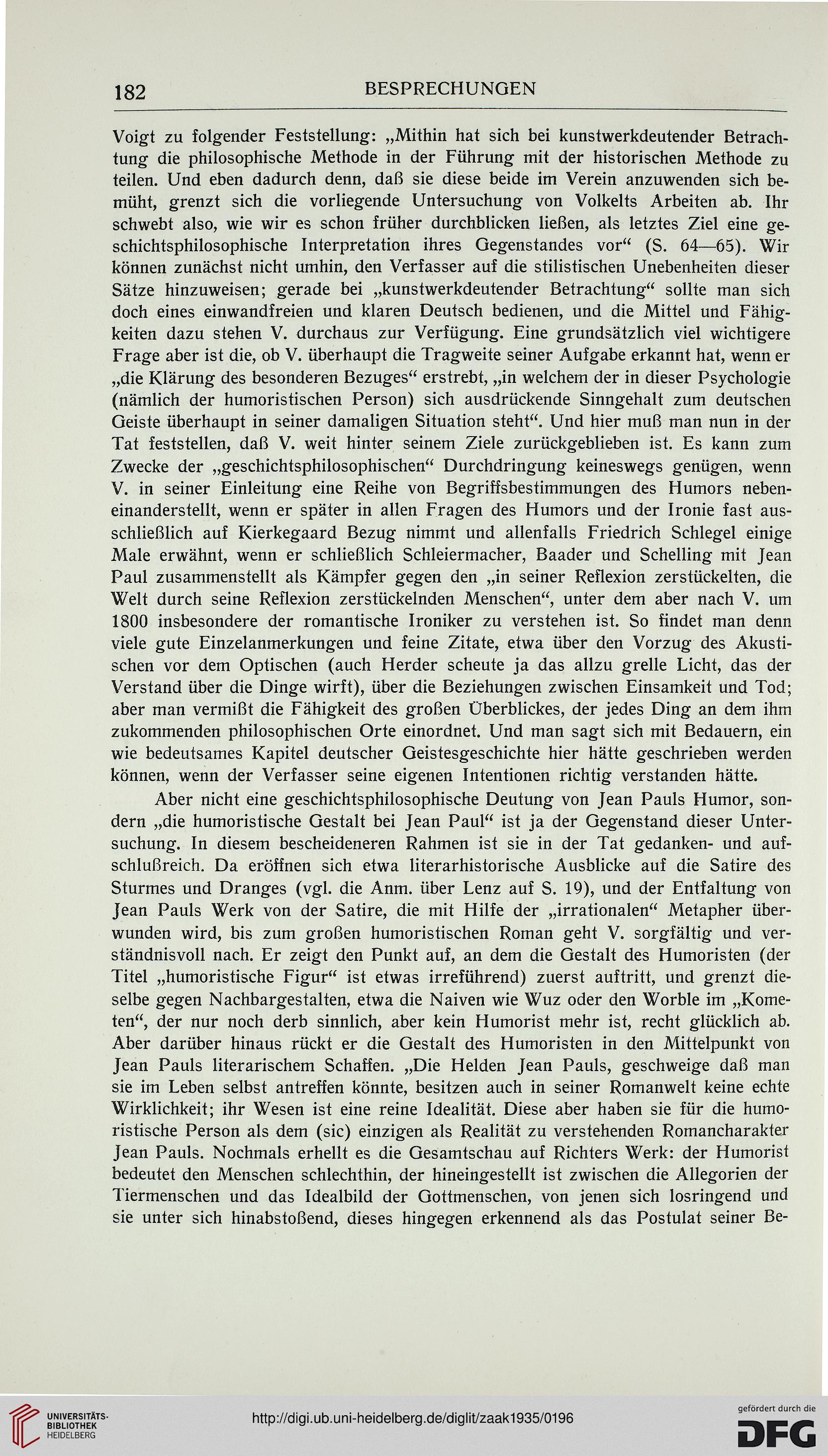182
BESPRECHUNGEN
Voigt zu folgender Feststellung: „Mithin hat sich bei kunstwerkdeutender Betrach-
tung die philosophische Methode in der Führung mit der historischen Methode zu
teilen. Und eben dadurch denn, daß sie diese beide im Verein anzuwenden sich be-
müht, grenzt sich die vorliegende Untersuchung von Volkelts Arbeiten ab. Ihr
schwebt also, wie wir es schon früher durchblicken ließen, als letztes Ziel eine ge-
schichtsphilosophische Interpretation ihres Gegenstandes vor" (S. 64—65). Wir
können zunächst nicht umhin, den Verfasser auf die stilistischen Unebenheiten dieser
Sätze hinzuweisen; gerade bei „kunstwerkdeutender Betrachtung" sollte man sich
doch eines einwandfreien und klaren Deutsch bedienen, und die Mittel und Fähig-
keiten dazu stehen V. durchaus zur Verfügung. Eine grundsätzlich viel wichtigere
Frage aber ist die, ob V. überhaupt die Tragweite seiner Aufgabe erkannt hat, wenn er
„die Klärung des besonderen Bezuges" erstrebt, „in welchem der in dieser Psychologie
(nämlich der humoristischen Person) sich ausdrückende Sinngehalt zum deutschen
Geiste überhaupt in seiner damaligen Situation steht". Und hier muß man nun in der
Tat feststellen, daß V. weit hinter seinem Ziele zurückgeblieben ist. Es kann zum
Zwecke der „geschichtsphilosophischen" Durchdringung keineswegs genügen, wenn
V. in seiner Einleitung eine Reihe von Begriffsbestimmungen des Humors neben-
einanderstellt, wenn er später in allen Fragen des Humors und der Ironie fast aus-
schließlich auf Kierkegaard Bezug nimmt und allenfalls Friedrich Schlegel einige
Male erwähnt, wenn er schließlich Schleiermacher, Baader und Schelling mit Jean
Paul zusammenstellt als Kämpfer gegen den „in seiner Reflexion zerstückelten, die
Welt durch seine Reflexion zerstückelnden Menschen", unter dem aber nach V. um
1800 insbesondere der romantische Ironiker zu verstehen ist. So findet man denn
viele gute Einzelanmerkungen und feine Zitate, etwa über den Vorzug des Akusti-
schen vor dem Optischen (auch Herder scheute ja das allzu grelle Licht, das der
Verstand über die Dinge wirft), über die Beziehungen zwischen Einsamkeit und Tod;
aber man vermißt die Fähigkeit des großen Überblickes, der jedes Ding an dem ihm
zukommenden philosophischen Orte einordnet. Und man sagt sich mit Bedauern, ein
wie bedeutsames Kapitel deutscher Geistesgeschichte hier hätte geschrieben werden
können, wenn der Verfasser seine eigenen Intentionen richtig verstanden hätte.
Aber nicht eine geschichtsphilosophische Deutung von Jean Pauls Humor, son-
dern „die humoristische Gestalt bei Jean Paul" ist ja der Gegenstand dieser Unter-
suchung. In diesem bescheideneren Rahmen ist sie in der Tat gedanken- und auf-
schlußreich. Da eröffnen sich etwa literarhistorische Ausblicke auf die Satire des
Sturmes und Dranges (vgl. die Anm. über Lenz auf S. 19), und der Entfaltung von
Jean Pauls Werk von der Satire, die mit Hilfe der „irrationalen" Metapher über-
wunden wird, bis zum großen humoristischen Roman geht V. sorgfältig und ver-
ständnisvoll nach. Er zeigt den Punkt auf, an dem die Gestalt des Humoristen (der
Titel „humoristische Figur" ist etwas irreführend) zuerst auftritt, und grenzt die-
selbe gegen Nachbargestalten, etwa die Naiven wie Wuz oder den Worble im „Kome-
ten", der nur noch derb sinnlich, aber kein Humorist mehr ist, recht glücklich ab.
Aber darüber hinaus rückt er die Gestalt des Humoristen in den Mittelpunkt von
Jean Pauls literarischem Schaffen. „Die Helden Jean Pauls, geschweige daß man
sie im Leben selbst antreffen könnte, besitzen auch in seiner Romanwelt keine echte
Wirklichkeit; ihr Wesen ist eine reine Idealität. Diese aber haben sie für die humo-
ristische Person als dem (sie) einzigen als Realität zu verstehenden Romancharakter
Jean Pauls. Nochmals erhellt es die Gesamtschau auf Richters Werk: der Humorist
bedeutet den Menschen schlechthin, der hineingestellt ist zwischen die Allegorien der
Tiermenschen und das Idealbild der Gottmenschen, von jenen sich losringend und
sie unter sich hinabstoßend, dieses hingegen erkennend als das Postulat seiner Be-
BESPRECHUNGEN
Voigt zu folgender Feststellung: „Mithin hat sich bei kunstwerkdeutender Betrach-
tung die philosophische Methode in der Führung mit der historischen Methode zu
teilen. Und eben dadurch denn, daß sie diese beide im Verein anzuwenden sich be-
müht, grenzt sich die vorliegende Untersuchung von Volkelts Arbeiten ab. Ihr
schwebt also, wie wir es schon früher durchblicken ließen, als letztes Ziel eine ge-
schichtsphilosophische Interpretation ihres Gegenstandes vor" (S. 64—65). Wir
können zunächst nicht umhin, den Verfasser auf die stilistischen Unebenheiten dieser
Sätze hinzuweisen; gerade bei „kunstwerkdeutender Betrachtung" sollte man sich
doch eines einwandfreien und klaren Deutsch bedienen, und die Mittel und Fähig-
keiten dazu stehen V. durchaus zur Verfügung. Eine grundsätzlich viel wichtigere
Frage aber ist die, ob V. überhaupt die Tragweite seiner Aufgabe erkannt hat, wenn er
„die Klärung des besonderen Bezuges" erstrebt, „in welchem der in dieser Psychologie
(nämlich der humoristischen Person) sich ausdrückende Sinngehalt zum deutschen
Geiste überhaupt in seiner damaligen Situation steht". Und hier muß man nun in der
Tat feststellen, daß V. weit hinter seinem Ziele zurückgeblieben ist. Es kann zum
Zwecke der „geschichtsphilosophischen" Durchdringung keineswegs genügen, wenn
V. in seiner Einleitung eine Reihe von Begriffsbestimmungen des Humors neben-
einanderstellt, wenn er später in allen Fragen des Humors und der Ironie fast aus-
schließlich auf Kierkegaard Bezug nimmt und allenfalls Friedrich Schlegel einige
Male erwähnt, wenn er schließlich Schleiermacher, Baader und Schelling mit Jean
Paul zusammenstellt als Kämpfer gegen den „in seiner Reflexion zerstückelten, die
Welt durch seine Reflexion zerstückelnden Menschen", unter dem aber nach V. um
1800 insbesondere der romantische Ironiker zu verstehen ist. So findet man denn
viele gute Einzelanmerkungen und feine Zitate, etwa über den Vorzug des Akusti-
schen vor dem Optischen (auch Herder scheute ja das allzu grelle Licht, das der
Verstand über die Dinge wirft), über die Beziehungen zwischen Einsamkeit und Tod;
aber man vermißt die Fähigkeit des großen Überblickes, der jedes Ding an dem ihm
zukommenden philosophischen Orte einordnet. Und man sagt sich mit Bedauern, ein
wie bedeutsames Kapitel deutscher Geistesgeschichte hier hätte geschrieben werden
können, wenn der Verfasser seine eigenen Intentionen richtig verstanden hätte.
Aber nicht eine geschichtsphilosophische Deutung von Jean Pauls Humor, son-
dern „die humoristische Gestalt bei Jean Paul" ist ja der Gegenstand dieser Unter-
suchung. In diesem bescheideneren Rahmen ist sie in der Tat gedanken- und auf-
schlußreich. Da eröffnen sich etwa literarhistorische Ausblicke auf die Satire des
Sturmes und Dranges (vgl. die Anm. über Lenz auf S. 19), und der Entfaltung von
Jean Pauls Werk von der Satire, die mit Hilfe der „irrationalen" Metapher über-
wunden wird, bis zum großen humoristischen Roman geht V. sorgfältig und ver-
ständnisvoll nach. Er zeigt den Punkt auf, an dem die Gestalt des Humoristen (der
Titel „humoristische Figur" ist etwas irreführend) zuerst auftritt, und grenzt die-
selbe gegen Nachbargestalten, etwa die Naiven wie Wuz oder den Worble im „Kome-
ten", der nur noch derb sinnlich, aber kein Humorist mehr ist, recht glücklich ab.
Aber darüber hinaus rückt er die Gestalt des Humoristen in den Mittelpunkt von
Jean Pauls literarischem Schaffen. „Die Helden Jean Pauls, geschweige daß man
sie im Leben selbst antreffen könnte, besitzen auch in seiner Romanwelt keine echte
Wirklichkeit; ihr Wesen ist eine reine Idealität. Diese aber haben sie für die humo-
ristische Person als dem (sie) einzigen als Realität zu verstehenden Romancharakter
Jean Pauls. Nochmals erhellt es die Gesamtschau auf Richters Werk: der Humorist
bedeutet den Menschen schlechthin, der hineingestellt ist zwischen die Allegorien der
Tiermenschen und das Idealbild der Gottmenschen, von jenen sich losringend und
sie unter sich hinabstoßend, dieses hingegen erkennend als das Postulat seiner Be-