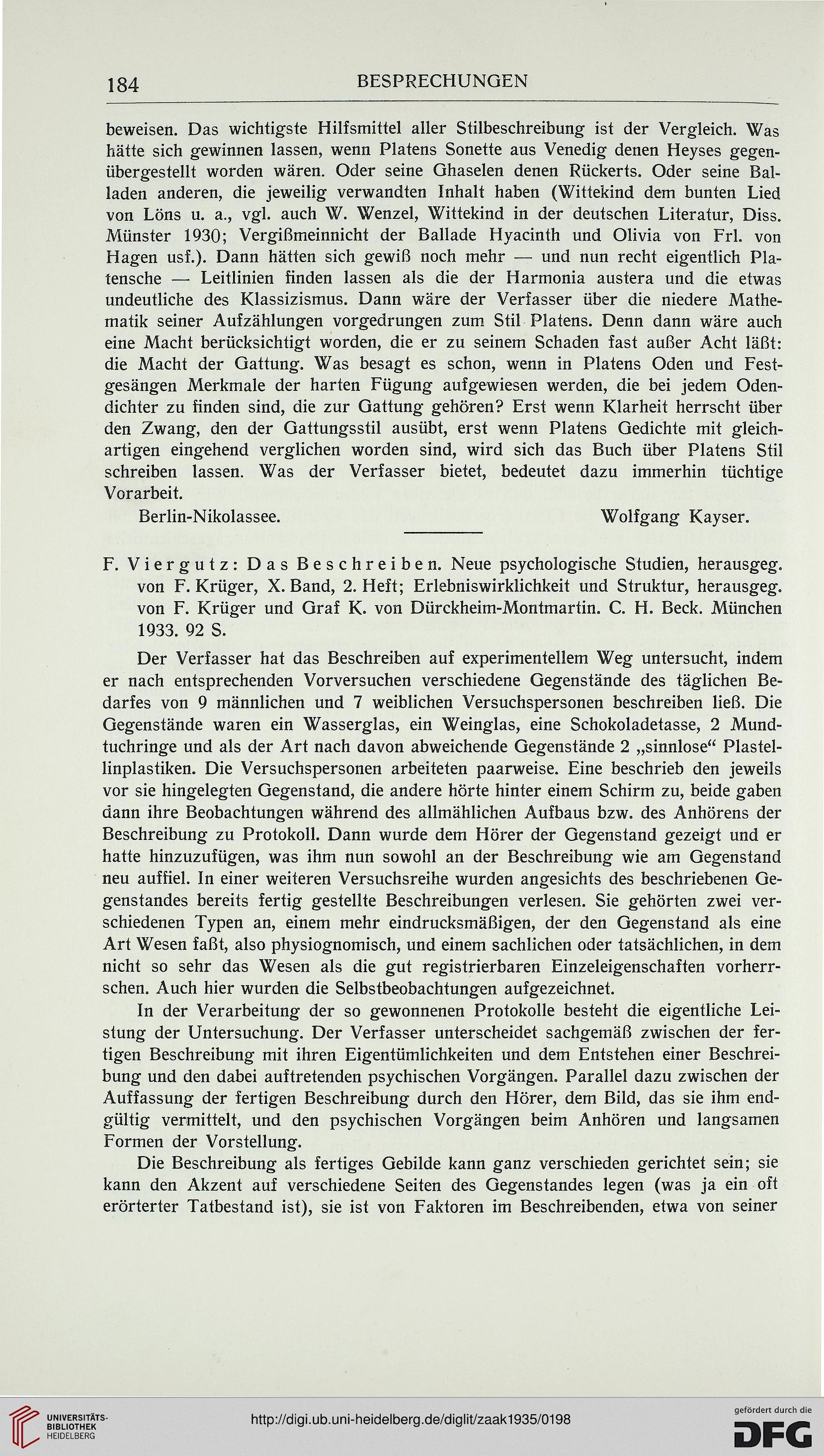184
BESPRECHUNGEN
beweisen. Das wichtigste Hilfsmittel aller Stilbeschreibung ist der Vergleich. Was
hätte sich gewinnen lassen, wenn Platens Sonette aus Venedig denen Heyses gegen-
übergestellt worden wären. Oder seine Ghaselen denen Rückerts. Oder seine Bal-
laden anderen, die jeweilig verwandten Inhalt haben (Wittekind dem bunten Lied
von Löns u. a., vgl. auch W. Wenzel, Wittekind in der deutschen Literatur, Diss.
Münster 1930; Vergißmeinnicht der Ballade Hyacinth und Olivia von Frl. von
Hagen usf.). Dann hätten sich gewiß noch mehr — und nun recht eigentlich Pla-
tensche —- Leitlinien finden lassen als die der Harmonia austera und die etwas
undeutliche des Klassizismus. Dann wäre der Verfasser über die niedere Mathe-
matik seiner Aufzählungen vorgedrungen zum Stil Platens. Denn dann wäre auch
eine Macht berücksichtigt worden, die er zu seinem Schaden fast außer Acht läßt:
die Macht der Gattung. Was besagt es schon, wenn in Platens Oden und Fest-
gesängen Merkmale der harten Fügung aufgewiesen werden, die bei jedem Oden-
dichter zu finden sind, die zur Gattung gehören? Erst wenn Klarheit herrscht über
den Zwang, den der Gattungsstil ausübt, erst wenn Platens Gedichte mit gleich-
artigen eingehend verglichen worden sind, wird sich das Buch über Platens Stil
schreiben lassen. Was der Verfasser bietet, bedeutet dazu immerhin tüchtige
Vorarbeit.
Berlin-Nikolassee. Wolfgang Kayser.
F. Viergutz: Das Beschreiben. Neue psychologische Studien, herausgeg.
von F.Krüger, X.Band, 2. Heft; Erlebniswirklichkeit und Struktur, herausgeg.
von F. Krüger und Graf K. von Dürckheim-Montmartin. C. H. Beck. München
1933. 92 S.
Der Verfasser hat das Beschreiben auf experimentellem Weg untersucht, indem
er nach entsprechenden Vorversuchen verschiedene Gegenstände des täglichen Be-
darfes von 9 männlichen und 7 weiblichen Versuchspersonen beschreiben ließ. Die
Gegenstände waren ein Wasserglas, ein Weinglas, eine Schokoladetasse, 2 Mund-
tuchringe und als der Art nach davon abweichende Gegenstände 2 „sinnlose" Plastel-
linplastiken. Die Versuchspersonen arbeiteten paarweise. Eine beschrieb den jeweils
vor sie hingelegten Gegenstand, die andere hörte hinter einem Schirm zu, beide gaben
dann ihre Beobachtungen während des allmählichen Aufbaus bzw. des Anhörens der
Beschreibung zu Protokoll. Dann wurde dem Hörer der Gegenstand gezeigt und er
hatte hinzuzufügen, was ihm nun sowohl an der Beschreibung wie am Gegenstand
neu auffiel. In einer weiteren Versuchsreihe wurden angesichts des beschriebenen Ge-
genstandes bereits fertig gestellte Beschreibungen verlesen. Sie gehörten zwei ver-
schiedenen Typen an, einem mehr eindrucksmäßigen, der den Gegenstand als eine
Art Wesen faßt, also physiognomisch, und einem sachlichen oder tatsächlichen, in dem
nicht so sehr das Wesen als die gut registrierbaren Einzeleigenschaften vorherr-
schen. Auch hier wurden die Selbstbeobachtungen aufgezeichnet.
In der Verarbeitung der so gewonnenen Protokolle besteht die eigentliche Lei-
stung der Untersuchung. Der Verfasser unterscheidet sachgemäß zwischen der fer-
tigen Beschreibung mit ihren Eigentümlichkeiten und dem Entstehen einer Beschrei-
bung und den dabei auftretenden psychischen Vorgängen. Parallel dazu zwischen der
Auffassung der fertigen Beschreibung durch den Hörer, dem Bild, das sie ihm end-
gültig vermittelt, und den psychischen Vorgängen beim Anhören und langsamen
Formen der Vorstellung.
Die Beschreibung als fertiges Gebilde kann ganz verschieden gerichtet sein; sie
kann den Akzent auf verschiedene Seiten des Gegenstandes legen (was ja ein oft
erörterter Tatbestand ist), sie ist von Faktoren im Beschreibenden, etwa von seiner
BESPRECHUNGEN
beweisen. Das wichtigste Hilfsmittel aller Stilbeschreibung ist der Vergleich. Was
hätte sich gewinnen lassen, wenn Platens Sonette aus Venedig denen Heyses gegen-
übergestellt worden wären. Oder seine Ghaselen denen Rückerts. Oder seine Bal-
laden anderen, die jeweilig verwandten Inhalt haben (Wittekind dem bunten Lied
von Löns u. a., vgl. auch W. Wenzel, Wittekind in der deutschen Literatur, Diss.
Münster 1930; Vergißmeinnicht der Ballade Hyacinth und Olivia von Frl. von
Hagen usf.). Dann hätten sich gewiß noch mehr — und nun recht eigentlich Pla-
tensche —- Leitlinien finden lassen als die der Harmonia austera und die etwas
undeutliche des Klassizismus. Dann wäre der Verfasser über die niedere Mathe-
matik seiner Aufzählungen vorgedrungen zum Stil Platens. Denn dann wäre auch
eine Macht berücksichtigt worden, die er zu seinem Schaden fast außer Acht läßt:
die Macht der Gattung. Was besagt es schon, wenn in Platens Oden und Fest-
gesängen Merkmale der harten Fügung aufgewiesen werden, die bei jedem Oden-
dichter zu finden sind, die zur Gattung gehören? Erst wenn Klarheit herrscht über
den Zwang, den der Gattungsstil ausübt, erst wenn Platens Gedichte mit gleich-
artigen eingehend verglichen worden sind, wird sich das Buch über Platens Stil
schreiben lassen. Was der Verfasser bietet, bedeutet dazu immerhin tüchtige
Vorarbeit.
Berlin-Nikolassee. Wolfgang Kayser.
F. Viergutz: Das Beschreiben. Neue psychologische Studien, herausgeg.
von F.Krüger, X.Band, 2. Heft; Erlebniswirklichkeit und Struktur, herausgeg.
von F. Krüger und Graf K. von Dürckheim-Montmartin. C. H. Beck. München
1933. 92 S.
Der Verfasser hat das Beschreiben auf experimentellem Weg untersucht, indem
er nach entsprechenden Vorversuchen verschiedene Gegenstände des täglichen Be-
darfes von 9 männlichen und 7 weiblichen Versuchspersonen beschreiben ließ. Die
Gegenstände waren ein Wasserglas, ein Weinglas, eine Schokoladetasse, 2 Mund-
tuchringe und als der Art nach davon abweichende Gegenstände 2 „sinnlose" Plastel-
linplastiken. Die Versuchspersonen arbeiteten paarweise. Eine beschrieb den jeweils
vor sie hingelegten Gegenstand, die andere hörte hinter einem Schirm zu, beide gaben
dann ihre Beobachtungen während des allmählichen Aufbaus bzw. des Anhörens der
Beschreibung zu Protokoll. Dann wurde dem Hörer der Gegenstand gezeigt und er
hatte hinzuzufügen, was ihm nun sowohl an der Beschreibung wie am Gegenstand
neu auffiel. In einer weiteren Versuchsreihe wurden angesichts des beschriebenen Ge-
genstandes bereits fertig gestellte Beschreibungen verlesen. Sie gehörten zwei ver-
schiedenen Typen an, einem mehr eindrucksmäßigen, der den Gegenstand als eine
Art Wesen faßt, also physiognomisch, und einem sachlichen oder tatsächlichen, in dem
nicht so sehr das Wesen als die gut registrierbaren Einzeleigenschaften vorherr-
schen. Auch hier wurden die Selbstbeobachtungen aufgezeichnet.
In der Verarbeitung der so gewonnenen Protokolle besteht die eigentliche Lei-
stung der Untersuchung. Der Verfasser unterscheidet sachgemäß zwischen der fer-
tigen Beschreibung mit ihren Eigentümlichkeiten und dem Entstehen einer Beschrei-
bung und den dabei auftretenden psychischen Vorgängen. Parallel dazu zwischen der
Auffassung der fertigen Beschreibung durch den Hörer, dem Bild, das sie ihm end-
gültig vermittelt, und den psychischen Vorgängen beim Anhören und langsamen
Formen der Vorstellung.
Die Beschreibung als fertiges Gebilde kann ganz verschieden gerichtet sein; sie
kann den Akzent auf verschiedene Seiten des Gegenstandes legen (was ja ein oft
erörterter Tatbestand ist), sie ist von Faktoren im Beschreibenden, etwa von seiner