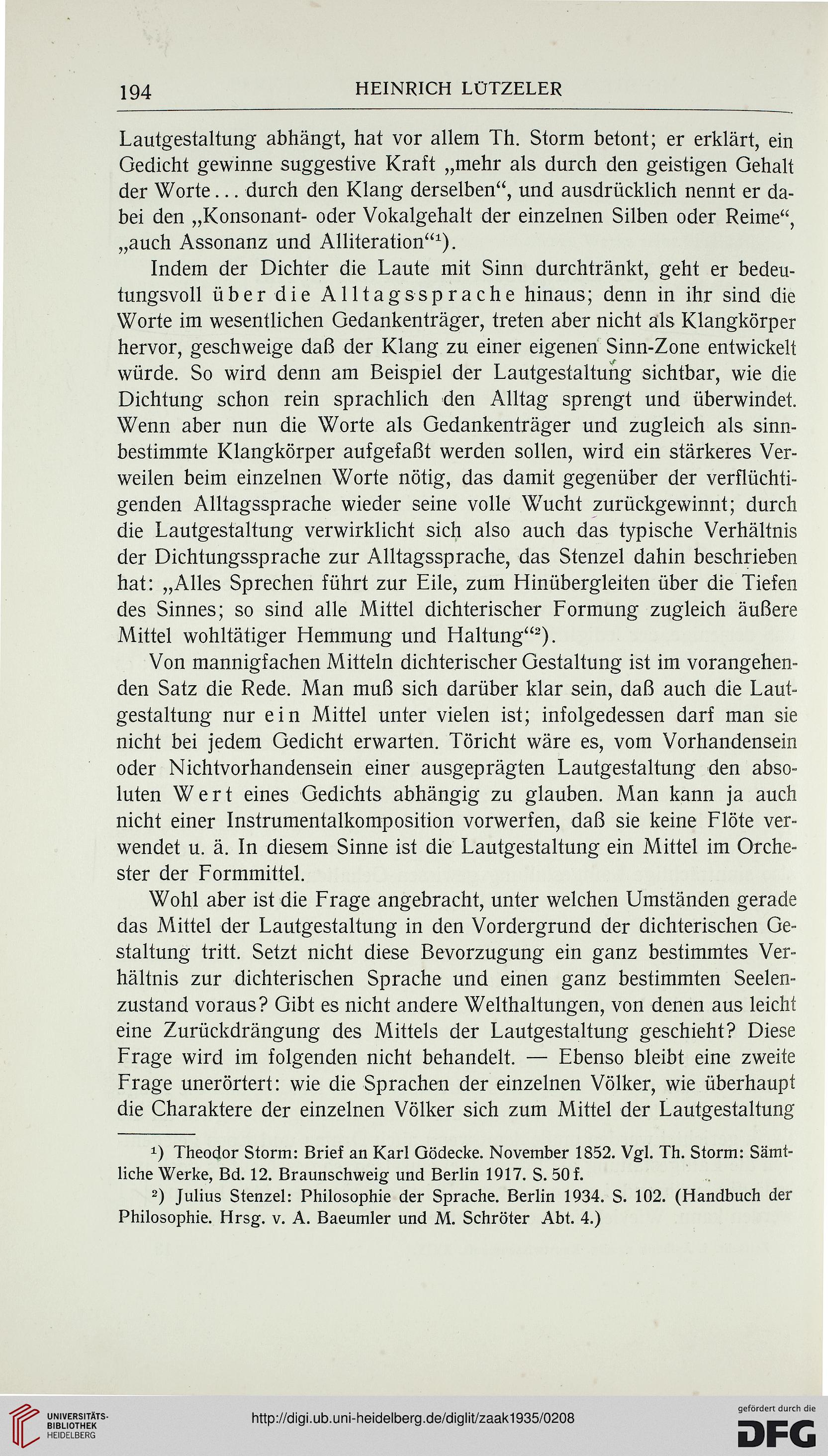194
HEINRICH LÜTZELER
Lautgestaltung abhängt, hat vor allem Th. Storni betont; er erklärt, ein
Gedicht gewinne suggestive Kraft „mehr als durch den geistigen Gehalt
der Worte... durch den Klang derselben", und ausdrücklich nennt er da-
bei den „Konsonant- oder Vokalgehalt der einzelnen Silben oder Reime",
„auch Assonanz und Alliteration"1).
Indem der Dichter die Laute mit Sinn durchtränkt, geht er bedeu-
tungsvoll über die Alltagssprache hinaus; denn in ihr sind die
Worte im wesentlichen Gedankenträger, treten aber nicht als Klangkörper
hervor, geschweige daß der Klang zu einer eigenen Sinn-Zone entwickelt
würde. So wird denn am Beispiel der Lautgestaltung sichtbar, wie die
Dichtung schon rein sprachlich den Alltag sprengt und überwindet.
Wenn aber nun die Worte als Gedankenträger und zugleich als sinn-
bestimmte Klangkörper aufgefaßt werden sollen, wird ein stärkeres Ver-
weilen beim einzelnen Worte nötig, das damit gegenüber der verflüchti-
genden Alltagssprache wieder seine volle Wucht zurückgewinnt; durch
die Lautgestaltung verwirklicht sich also auch das typische Verhältnis
der Dichtungssprache zur Alltagssprache, das Stenzel dahin beschrieben
hat: „Alles Sprechen führt zur Eile, zum Hinübergleiten über die Tiefen
des Sinnes; so sind alle Mittel dichterischer Formung zugleich äußere
Mittel wohltätiger Hemmung und Haltung"2).
Von mannigfachen Mitteln dichterischer Gestaltung ist im vorangehen-
den Satz die Rede. Man muß sich darüber klar sein, daß auch die Laut-
gestaltung nur ein Mittel unter vielen ist; infolgedessen darf man sie
nicht bei jedem Gedicht erwarten. Töricht wäre es, vom Vorhandensein
oder Nichtvorhandensein einer ausgeprägten Lautgestaltung den abso-
luten Wert eines Gedichts abhängig zu glauben. Man kann ja auch
nicht einer Instrumentalkomposition vorwerfen, daß sie keine Flöte ver-
wendet u. ä. In diesem Sinne ist die Lautgestaltung ein Mittel im Orche-
ster der Formmittel.
Wohl aber ist die Frage angebracht, unter welchen Umständen gerade
das Mittel der Lautgestaltung in den Vordergrund der dichterischen Ge-
staltung tritt. Setzt nicht diese Bevorzugung ein ganz bestimmtes Ver-
hältnis zur dichterischen Sprache und einen ganz bestimmten Seelen-
zustand voraus? Gibt es nicht andere Welthaltungen, von denen aus leicht
eine Zurückdrängung des Mittels der Lautgestaltung geschieht? Diese
Frage wird im folgenden nicht behandelt. — Ebenso bleibt eine zweite
Frage unerörtert: wie die Sprachen der einzelnen Völker, wie überhaupt
die Charaktere der einzelnen Völker sich zum Mittel der Lautgestaltung
1) Theodor Storm: Brief an Karl Gödecke. November 1852. Vgl. Th. Storm: Sämt-
liche Werke, Bd. 12. Braunschweig und Berlin 1917. S. 50 f.
2) Julius Stenzel: Philosophie der Sprache. Berlin 1934. S. 102. (Handbuch der
Philosophie. Hrsg. v. A. Baeumler und M. Schröter Abt. 4.)
HEINRICH LÜTZELER
Lautgestaltung abhängt, hat vor allem Th. Storni betont; er erklärt, ein
Gedicht gewinne suggestive Kraft „mehr als durch den geistigen Gehalt
der Worte... durch den Klang derselben", und ausdrücklich nennt er da-
bei den „Konsonant- oder Vokalgehalt der einzelnen Silben oder Reime",
„auch Assonanz und Alliteration"1).
Indem der Dichter die Laute mit Sinn durchtränkt, geht er bedeu-
tungsvoll über die Alltagssprache hinaus; denn in ihr sind die
Worte im wesentlichen Gedankenträger, treten aber nicht als Klangkörper
hervor, geschweige daß der Klang zu einer eigenen Sinn-Zone entwickelt
würde. So wird denn am Beispiel der Lautgestaltung sichtbar, wie die
Dichtung schon rein sprachlich den Alltag sprengt und überwindet.
Wenn aber nun die Worte als Gedankenträger und zugleich als sinn-
bestimmte Klangkörper aufgefaßt werden sollen, wird ein stärkeres Ver-
weilen beim einzelnen Worte nötig, das damit gegenüber der verflüchti-
genden Alltagssprache wieder seine volle Wucht zurückgewinnt; durch
die Lautgestaltung verwirklicht sich also auch das typische Verhältnis
der Dichtungssprache zur Alltagssprache, das Stenzel dahin beschrieben
hat: „Alles Sprechen führt zur Eile, zum Hinübergleiten über die Tiefen
des Sinnes; so sind alle Mittel dichterischer Formung zugleich äußere
Mittel wohltätiger Hemmung und Haltung"2).
Von mannigfachen Mitteln dichterischer Gestaltung ist im vorangehen-
den Satz die Rede. Man muß sich darüber klar sein, daß auch die Laut-
gestaltung nur ein Mittel unter vielen ist; infolgedessen darf man sie
nicht bei jedem Gedicht erwarten. Töricht wäre es, vom Vorhandensein
oder Nichtvorhandensein einer ausgeprägten Lautgestaltung den abso-
luten Wert eines Gedichts abhängig zu glauben. Man kann ja auch
nicht einer Instrumentalkomposition vorwerfen, daß sie keine Flöte ver-
wendet u. ä. In diesem Sinne ist die Lautgestaltung ein Mittel im Orche-
ster der Formmittel.
Wohl aber ist die Frage angebracht, unter welchen Umständen gerade
das Mittel der Lautgestaltung in den Vordergrund der dichterischen Ge-
staltung tritt. Setzt nicht diese Bevorzugung ein ganz bestimmtes Ver-
hältnis zur dichterischen Sprache und einen ganz bestimmten Seelen-
zustand voraus? Gibt es nicht andere Welthaltungen, von denen aus leicht
eine Zurückdrängung des Mittels der Lautgestaltung geschieht? Diese
Frage wird im folgenden nicht behandelt. — Ebenso bleibt eine zweite
Frage unerörtert: wie die Sprachen der einzelnen Völker, wie überhaupt
die Charaktere der einzelnen Völker sich zum Mittel der Lautgestaltung
1) Theodor Storm: Brief an Karl Gödecke. November 1852. Vgl. Th. Storm: Sämt-
liche Werke, Bd. 12. Braunschweig und Berlin 1917. S. 50 f.
2) Julius Stenzel: Philosophie der Sprache. Berlin 1934. S. 102. (Handbuch der
Philosophie. Hrsg. v. A. Baeumler und M. Schröter Abt. 4.)