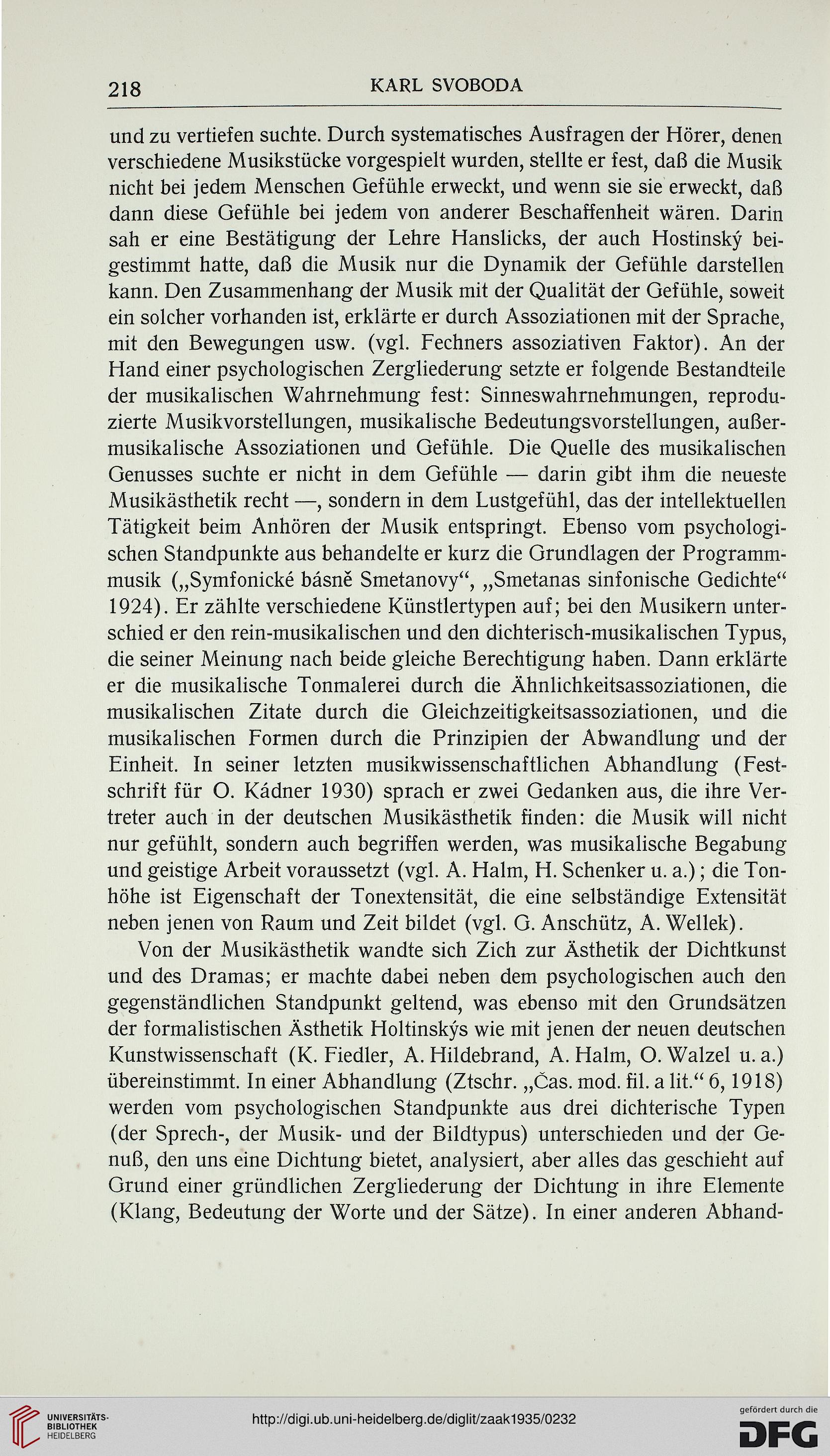218
KARL SVOBODA
und zu vertiefen suchte. Durch systematisches Ausfragen der Hörer, denen
verschiedene Musikstücke vorgespielt wurden, stellte er fest, daß die Musik
nicht bei jedem Menschen Gefühle erweckt, und wenn sie sie erweckt, daß
dann diese Gefühle bei jedem von anderer Beschaffenheit wären. Darin
sah er eine Bestätigung der Lehre Hanslicks, der auch Hostinsky bei-
gestimmt hatte, daß die Musik nur die Dynamik der Gefühle darstellen
kann. Den Zusammenhang der Musik mit der Qualität der Gefühle, soweit
ein solcher vorhanden ist, erklärte er durch Assoziationen mit der Sprache,
mit den Bewegungen usw. (vgl. Fechners assoziativen Faktor). An der
Hand einer psychologischen Zergliederung setzte er folgende Bestandteile
der musikalischen Wahrnehmung fest: Sinneswahrnehmungen, reprodu-
zierte Musikvorstellungen, musikalische Bedeutungsvorstellungen, außer-
musikalische Assoziationen und Gefühle. Die Quelle des musikalischen
Genusses suchte er nicht in dem Gefühle — darin gibt ihm die neueste
Musikästhetik recht —, sondern in dem Lustgefühl, das der intellektuellen
Tätigkeit beim Anhören der Musik entspringt. Ebenso vom psychologi-
schen Standpunkte aus behandelte er kurz die Grundlagen der Programm-
musik („Symfonicke bäsne Smetanovy", „Smetanas sinfonische Gedichte"
1924). Er zählte verschiedene Künstlertypen auf; bei den Musikern unter-
schied er den rein-musikalischen und den dichterisch-musikalischen Typus,
die seiner Meinung nach beide gleiche Berechtigung haben. Dann erklärte
er die musikalische Tonmalerei durch die Ähnlichkeitsassoziationen, die
musikalischen Zitate durch die Gleichzeitigkeitsassoziationen, und die
musikalischen Formen durch die Prinzipien der Abwandlung und der
Einheit. In seiner letzten musikwissenschaftlichen Abhandlung (Fest-
schrift für O. Kädner 1930) sprach er zwei Gedanken aus, die ihre Ver-
treter auch in der deutschen Musikästhetik finden: die Musik will nicht
nur gefühlt, sondern auch begriffen werden, was musikalische Begabung
und geistige Arbeit voraussetzt (vgl. A. Halm, H. Schenker u. a.); die Ton-
höhe ist Eigenschaft der Tonextensität, die eine selbständige Extensität
neben jenen von Raum und Zeit bildet (vgl. G. Anschütz, A. Wellek).
Von der Musikästhetik wandte sich Zieh zur Ästhetik der Dichtkunst
und des Dramas; er machte dabei neben dem psychologischen auch den
gegenständlichen Standpunkt geltend, was ebenso mit den Grundsätzen
der formalistischen Ästhetik Holtinskys wie mit jenen der neuen deutschen
Kunstwissenschaft (K. Fiedler, A. Hildebrand, A. Halm, O. Walzel u. a.)
übereinstimmt. In einer Abhandlung (Ztschr. „Cas. mod. hl. a lit." 6,1918)
werden vom psychologischen Standpunkte aus drei dichterische Typen
(der Sprech-, der Musik- und der Bildtypus) unterschieden und der Ge-
nuß, den uns eine Dichtung bietet, analysiert, aber alles das geschieht auf
Grund einer gründlichen Zergliederung der Dichtung in ihre Elemente
(Klang, Bedeutung der Worte und der Sätze). In einer anderen Abhand-
KARL SVOBODA
und zu vertiefen suchte. Durch systematisches Ausfragen der Hörer, denen
verschiedene Musikstücke vorgespielt wurden, stellte er fest, daß die Musik
nicht bei jedem Menschen Gefühle erweckt, und wenn sie sie erweckt, daß
dann diese Gefühle bei jedem von anderer Beschaffenheit wären. Darin
sah er eine Bestätigung der Lehre Hanslicks, der auch Hostinsky bei-
gestimmt hatte, daß die Musik nur die Dynamik der Gefühle darstellen
kann. Den Zusammenhang der Musik mit der Qualität der Gefühle, soweit
ein solcher vorhanden ist, erklärte er durch Assoziationen mit der Sprache,
mit den Bewegungen usw. (vgl. Fechners assoziativen Faktor). An der
Hand einer psychologischen Zergliederung setzte er folgende Bestandteile
der musikalischen Wahrnehmung fest: Sinneswahrnehmungen, reprodu-
zierte Musikvorstellungen, musikalische Bedeutungsvorstellungen, außer-
musikalische Assoziationen und Gefühle. Die Quelle des musikalischen
Genusses suchte er nicht in dem Gefühle — darin gibt ihm die neueste
Musikästhetik recht —, sondern in dem Lustgefühl, das der intellektuellen
Tätigkeit beim Anhören der Musik entspringt. Ebenso vom psychologi-
schen Standpunkte aus behandelte er kurz die Grundlagen der Programm-
musik („Symfonicke bäsne Smetanovy", „Smetanas sinfonische Gedichte"
1924). Er zählte verschiedene Künstlertypen auf; bei den Musikern unter-
schied er den rein-musikalischen und den dichterisch-musikalischen Typus,
die seiner Meinung nach beide gleiche Berechtigung haben. Dann erklärte
er die musikalische Tonmalerei durch die Ähnlichkeitsassoziationen, die
musikalischen Zitate durch die Gleichzeitigkeitsassoziationen, und die
musikalischen Formen durch die Prinzipien der Abwandlung und der
Einheit. In seiner letzten musikwissenschaftlichen Abhandlung (Fest-
schrift für O. Kädner 1930) sprach er zwei Gedanken aus, die ihre Ver-
treter auch in der deutschen Musikästhetik finden: die Musik will nicht
nur gefühlt, sondern auch begriffen werden, was musikalische Begabung
und geistige Arbeit voraussetzt (vgl. A. Halm, H. Schenker u. a.); die Ton-
höhe ist Eigenschaft der Tonextensität, die eine selbständige Extensität
neben jenen von Raum und Zeit bildet (vgl. G. Anschütz, A. Wellek).
Von der Musikästhetik wandte sich Zieh zur Ästhetik der Dichtkunst
und des Dramas; er machte dabei neben dem psychologischen auch den
gegenständlichen Standpunkt geltend, was ebenso mit den Grundsätzen
der formalistischen Ästhetik Holtinskys wie mit jenen der neuen deutschen
Kunstwissenschaft (K. Fiedler, A. Hildebrand, A. Halm, O. Walzel u. a.)
übereinstimmt. In einer Abhandlung (Ztschr. „Cas. mod. hl. a lit." 6,1918)
werden vom psychologischen Standpunkte aus drei dichterische Typen
(der Sprech-, der Musik- und der Bildtypus) unterschieden und der Ge-
nuß, den uns eine Dichtung bietet, analysiert, aber alles das geschieht auf
Grund einer gründlichen Zergliederung der Dichtung in ihre Elemente
(Klang, Bedeutung der Worte und der Sätze). In einer anderen Abhand-