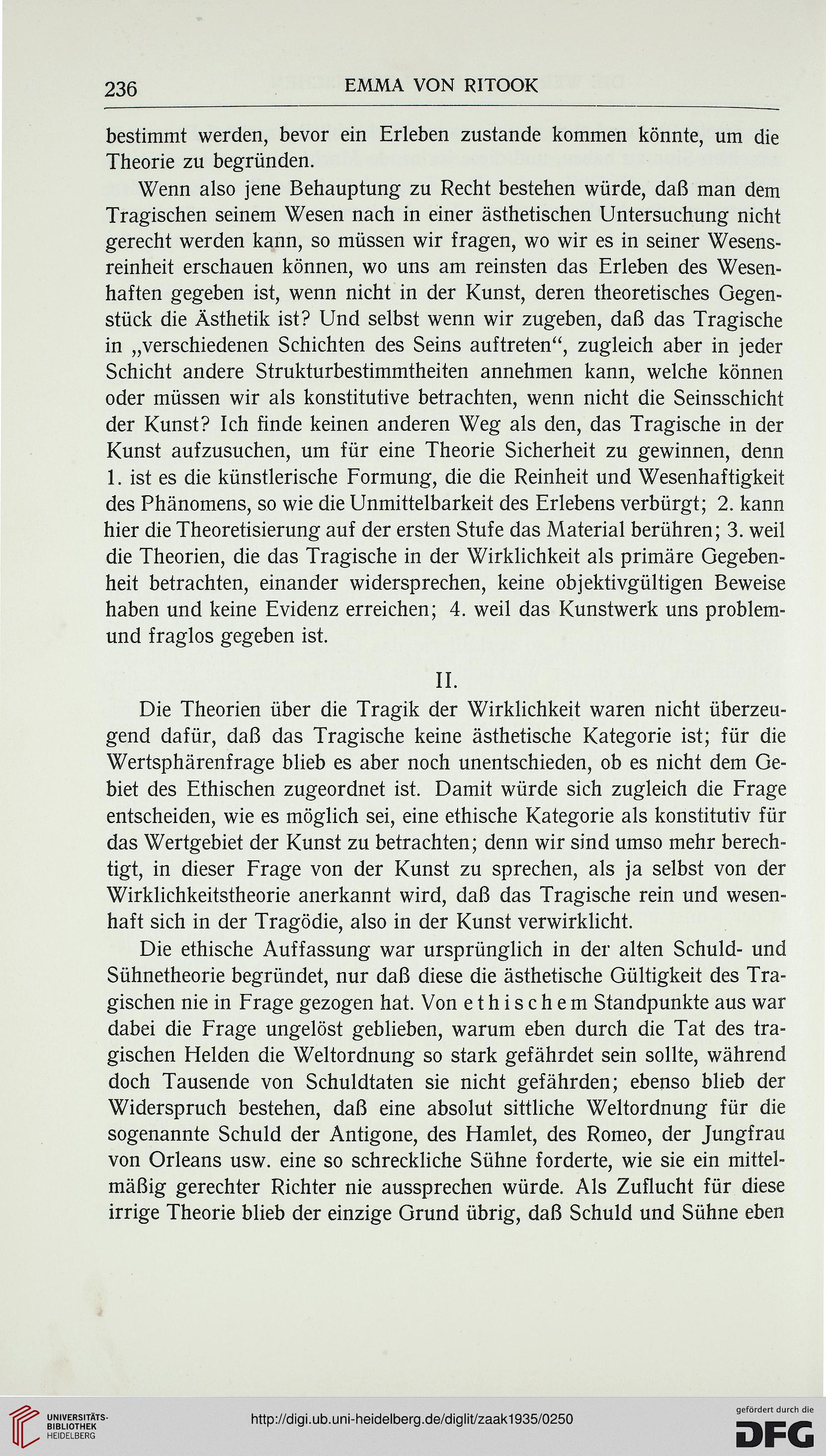236
EMMA VON RITOOK
bestimmt werden, bevor ein Erleben zustande kommen könnte, um die
Theorie zu begründen.
Wenn also jene Behauptung zu Recht bestehen würde, daß man dem
Tragischen seinem Wesen nach in einer ästhetischen Untersuchung nicht
gerecht werden kann, so müssen wir fragen, wo wir es in seiner Wesens-
reinheit erschauen können, wo uns am reinsten das Erleben des Wesen-
haften gegeben ist, wenn nicht in der Kunst, deren theoretisches Gegen-
stück die Ästhetik ist? Und selbst wenn wir zugeben, daß das Tragische
in „verschiedenen Schichten des Seins auftreten", zugleich aber in jeder
Schicht andere Strukturbestimmtheiten annehmen kann, welche können
oder müssen wir als konstitutive betrachten, wenn nicht die Seinsschicht
der Kunst? Ich finde keinen anderen Weg als den, das Tragische in der
Kunst aufzusuchen, um für eine Theorie Sicherheit zu gewinnen, denn
1. ist es die künstlerische Formung, die die Reinheit und Wesenhaftigkeit
des Phänomens, so wie die Unmittelbarkeit des Erlebens verbürgt; 2. kann
hier die Theoretisierung auf der ersten Stufe das Material berühren; 3. weil
die Theorien, die das Tragische in der Wirklichkeit als primäre Gegeben-
heit betrachten, einander widersprechen, keine objektivgültigen Beweise
haben und keine Evidenz erreichen; 4. weil das Kunstwerk uns problem-
und fraglos gegeben ist.
II.
Die Theorien über die Tragik der Wirklichkeit waren nicht überzeu-
gend dafür, daß das Tragische keine ästhetische Kategorie ist; für die
Wertsphärenfrage blieb es aber noch unentschieden, ob es nicht dem Ge-
biet des Ethischen zugeordnet ist. Damit würde sich zugleich die Frage
entscheiden, wie es möglich sei, eine ethische Kategorie als konstitutiv für
das Wertgebiet der Kunst zu betrachten; denn wir sind umso mehr berech-
tigt, in dieser Frage von der Kunst zu sprechen, als ja selbst von der
Wirklichkeitstheorie anerkannt wird, daß das Tragische rein und wesen-
haft sich in der Tragödie, also in der Kunst verwirklicht.
Die ethische Auffassung war ursprünglich in der alten Schuld- und
Sühnetheorie begründet, nur daß diese die ästhetische Gültigkeit des Tra-
gischen nie in Frage gezogen hat. Von ethischem Standpunkte aus war
dabei die Frage ungelöst geblieben, warum eben durch die Tat des tra-
gischen Helden die Weltordnung so stark gefährdet sein sollte, während
doch Tausende von Schuldtaten sie nicht gefährden; ebenso blieb der
Widerspruch bestehen, daß eine absolut sittliche Weltordnung für die
sogenannte Schuld der Antigone, des Hamlet, des Romeo, der Jungfrau
von Orleans usw. eine so schreckliche Sühne forderte, wie sie ein mittel-
mäßig gerechter Richter nie aussprechen würde. Als Zuflucht für diese
irrige Theorie blieb der einzige Grund übrig, daß Schuld und Sühne eben
EMMA VON RITOOK
bestimmt werden, bevor ein Erleben zustande kommen könnte, um die
Theorie zu begründen.
Wenn also jene Behauptung zu Recht bestehen würde, daß man dem
Tragischen seinem Wesen nach in einer ästhetischen Untersuchung nicht
gerecht werden kann, so müssen wir fragen, wo wir es in seiner Wesens-
reinheit erschauen können, wo uns am reinsten das Erleben des Wesen-
haften gegeben ist, wenn nicht in der Kunst, deren theoretisches Gegen-
stück die Ästhetik ist? Und selbst wenn wir zugeben, daß das Tragische
in „verschiedenen Schichten des Seins auftreten", zugleich aber in jeder
Schicht andere Strukturbestimmtheiten annehmen kann, welche können
oder müssen wir als konstitutive betrachten, wenn nicht die Seinsschicht
der Kunst? Ich finde keinen anderen Weg als den, das Tragische in der
Kunst aufzusuchen, um für eine Theorie Sicherheit zu gewinnen, denn
1. ist es die künstlerische Formung, die die Reinheit und Wesenhaftigkeit
des Phänomens, so wie die Unmittelbarkeit des Erlebens verbürgt; 2. kann
hier die Theoretisierung auf der ersten Stufe das Material berühren; 3. weil
die Theorien, die das Tragische in der Wirklichkeit als primäre Gegeben-
heit betrachten, einander widersprechen, keine objektivgültigen Beweise
haben und keine Evidenz erreichen; 4. weil das Kunstwerk uns problem-
und fraglos gegeben ist.
II.
Die Theorien über die Tragik der Wirklichkeit waren nicht überzeu-
gend dafür, daß das Tragische keine ästhetische Kategorie ist; für die
Wertsphärenfrage blieb es aber noch unentschieden, ob es nicht dem Ge-
biet des Ethischen zugeordnet ist. Damit würde sich zugleich die Frage
entscheiden, wie es möglich sei, eine ethische Kategorie als konstitutiv für
das Wertgebiet der Kunst zu betrachten; denn wir sind umso mehr berech-
tigt, in dieser Frage von der Kunst zu sprechen, als ja selbst von der
Wirklichkeitstheorie anerkannt wird, daß das Tragische rein und wesen-
haft sich in der Tragödie, also in der Kunst verwirklicht.
Die ethische Auffassung war ursprünglich in der alten Schuld- und
Sühnetheorie begründet, nur daß diese die ästhetische Gültigkeit des Tra-
gischen nie in Frage gezogen hat. Von ethischem Standpunkte aus war
dabei die Frage ungelöst geblieben, warum eben durch die Tat des tra-
gischen Helden die Weltordnung so stark gefährdet sein sollte, während
doch Tausende von Schuldtaten sie nicht gefährden; ebenso blieb der
Widerspruch bestehen, daß eine absolut sittliche Weltordnung für die
sogenannte Schuld der Antigone, des Hamlet, des Romeo, der Jungfrau
von Orleans usw. eine so schreckliche Sühne forderte, wie sie ein mittel-
mäßig gerechter Richter nie aussprechen würde. Als Zuflucht für diese
irrige Theorie blieb der einzige Grund übrig, daß Schuld und Sühne eben