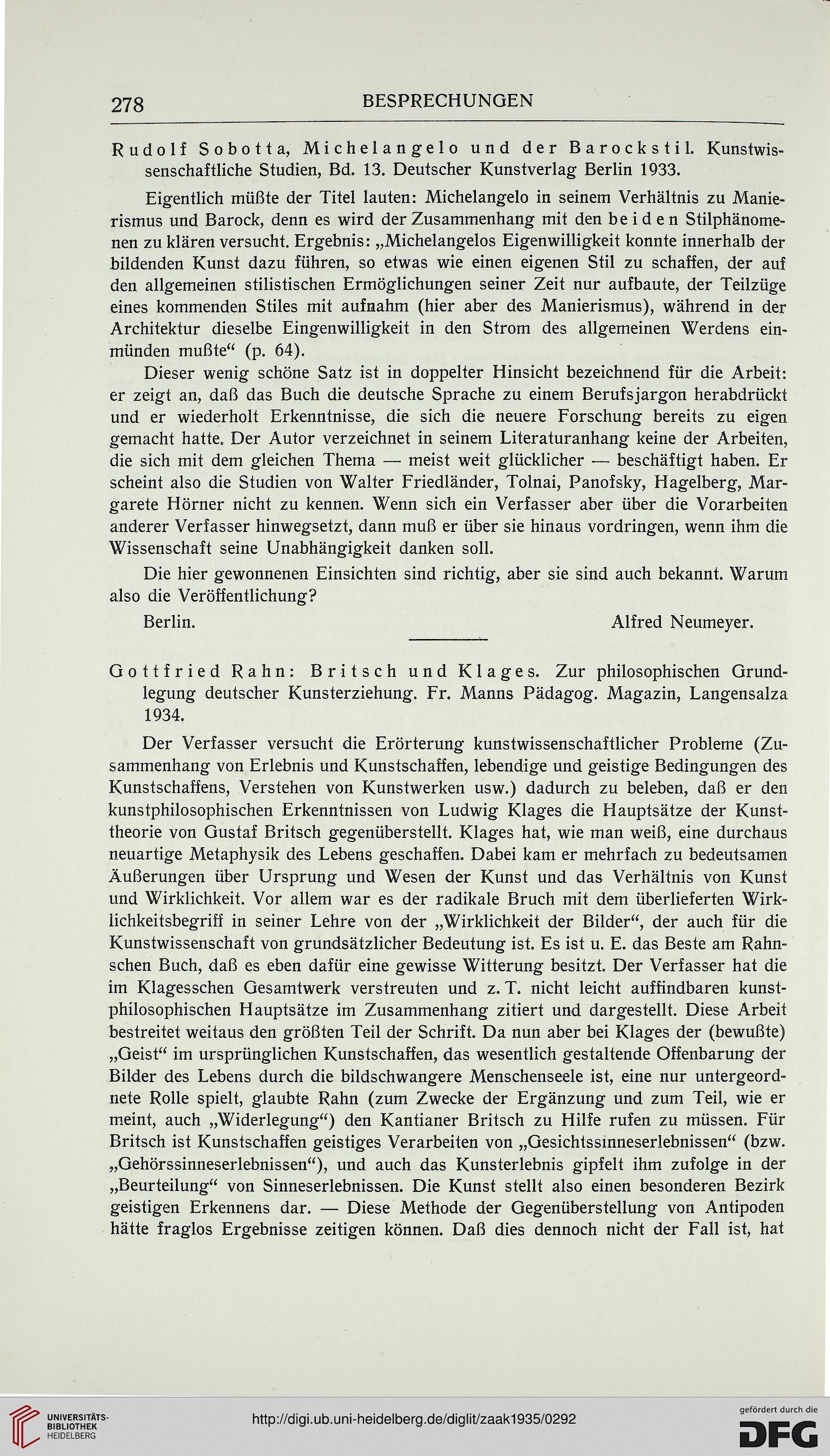278
BESPRECHUNGEN
Rudolf Sobotta, Michelangelo und der Barockstil. Kunstwis-
senschaftliche Studien, Bd. 13. Deutscher Kunstverlag Berlin 1933.
Eigentlich müßte der Titel lauten: Michelangelo in seinem Verhältnis zu Manie-
rismus und Barock, denn es wird der Zusammenhang mit den beiden Stilphänome-
nen zu klären versucht. Ergebnis: „Michelangelos Eigenwilligkeit konnte innerhalb der
bildenden Kunst dazu führen, so etwas wie einen eigenen Stil zu schaffen, der auf
den allgemeinen stilistischen Ermöglichungen seiner Zeit nur aufbaute, der Teilzüge
eines kommenden Stiles mit aufnahm (hier aber des Manierismus), während in der
Architektur dieselbe Eingenwilligkeit in den Strom des allgemeinen Werdens ein-
münden mußte" (p. 64).
Dieser wenig schöne Satz ist in doppelter Hinsicht bezeichnend für die Arbeit:
er zeigt an, daß das Buch die deutsche Sprache zu einem Berufsjargon herabdrückt
und er wiederholt Erkenntnisse, die sich die neuere Forschung bereits zu eigen
gemacht hatte. Der Autor verzeichnet in seinem Literaturanhang keine der Arbeiten,
die sich mit dem gleichen Thema — meist weit glücklicher — beschäftigt haben. Er
scheint also die Studien von Walter Friedländer, Tolnai, Panofsky, Hagelberg, Mar-
garete Hörner nicht zu kennen. Wenn sich ein Verfasser aber über die Vorarbeiten
anderer Verfasser hinwegsetzt, dann muß er über sie hinaus vordringen, wenn ihm die
Wissenschaft seine Unabhängigkeit danken soll.
Die hier gewonnenen Einsichten sind richtig, aber sie sind auch bekannt. Warum
also die Veröffentlichung?
Berlin. Alfred Neumeyer.
Gottfried Rahn: Britsch und Klage s. Zur philosophischen Grund-
legung deutscher Kunsterziehung. Fr. Manns Pädagog. Magazin, Langensalza
1934.
Der Verfasser versucht die Erörterung kunstwissenschaftlicher Probleme (Zu-
sammenhang von Erlebnis und Kunstschaffen, lebendige und geistige Bedingungen des
Kunstschaffens, Verstehen von Kunstwerken usw.) dadurch zu beleben, daß er den
kunstphilosophischen Erkenntnissen von Ludwig Klages die Hauptsätze der Kunst-
theorie von Gustaf Britsch gegenüberstellt. Klages hat, wie man weiß, eine durchaus
neuartige Metaphysik des Lebens geschaffen. Dabei kam er mehrfach zu bedeutsamen
Äußerungen über Ursprung und Wesen der Kunst und das Verhältnis von Kunst
und Wirklichkeit. Vor allem war es der radikale Bruch mit dem überlieferten Wirk-
lichkeitsbegriff in seiner Lehre von der „Wirklichkeit der Bilder", der auch für die
Kunstwissenschaft von grundsätzlicher Bedeutung ist. Es ist u. E. das Beste am Rahn-
schen Buch, daß es eben dafür eine gewisse Witterung besitzt. Der Verfasser hat die
im Klagesschen Gesamtwerk verstreuten und z. T. nicht leicht auffindbaren kunst-
philosophischen Hauptsätze im Zusammenhang zitiert und dargestellt. Diese Arbeit
bestreitet weitaus den größten Teil der Schrift. Da nun aber bei Klages der (bewußte)
„Geist" im ursprünglichen Kunstschaffen, das wesentlich gestaltende Offenbarung der
Bilder des Lebens durch die bildschwangere Menschenseele ist, eine nur untergeord-
nete Rolle spielt, glaubte Rahn (zum Zwecke der Ergänzung und zum Teil, wie er
meint, auch „Widerlegung") den Kantianer Britsch zu Hilfe rufen zu müssen. Für
Britsch ist Kunstschaffen geistiges Verarbeiten von „Gesichtssinneserlebnissen" (bzw.
„Gehörssinneserlebnissen"), und auch das Kunsterlebnis gipfelt ihm zufolge in der
„Beurteilung" von Sinneserlebnissen. Die Kunst stellt also einen besonderen Bezirk
geistigen Erkennens dar. — Diese Methode der Gegenüberstellung von Antipoden
hätte fraglos Ergebnisse zeitigen können. Daß dies dennoch nicht der Fall ist, hat
BESPRECHUNGEN
Rudolf Sobotta, Michelangelo und der Barockstil. Kunstwis-
senschaftliche Studien, Bd. 13. Deutscher Kunstverlag Berlin 1933.
Eigentlich müßte der Titel lauten: Michelangelo in seinem Verhältnis zu Manie-
rismus und Barock, denn es wird der Zusammenhang mit den beiden Stilphänome-
nen zu klären versucht. Ergebnis: „Michelangelos Eigenwilligkeit konnte innerhalb der
bildenden Kunst dazu führen, so etwas wie einen eigenen Stil zu schaffen, der auf
den allgemeinen stilistischen Ermöglichungen seiner Zeit nur aufbaute, der Teilzüge
eines kommenden Stiles mit aufnahm (hier aber des Manierismus), während in der
Architektur dieselbe Eingenwilligkeit in den Strom des allgemeinen Werdens ein-
münden mußte" (p. 64).
Dieser wenig schöne Satz ist in doppelter Hinsicht bezeichnend für die Arbeit:
er zeigt an, daß das Buch die deutsche Sprache zu einem Berufsjargon herabdrückt
und er wiederholt Erkenntnisse, die sich die neuere Forschung bereits zu eigen
gemacht hatte. Der Autor verzeichnet in seinem Literaturanhang keine der Arbeiten,
die sich mit dem gleichen Thema — meist weit glücklicher — beschäftigt haben. Er
scheint also die Studien von Walter Friedländer, Tolnai, Panofsky, Hagelberg, Mar-
garete Hörner nicht zu kennen. Wenn sich ein Verfasser aber über die Vorarbeiten
anderer Verfasser hinwegsetzt, dann muß er über sie hinaus vordringen, wenn ihm die
Wissenschaft seine Unabhängigkeit danken soll.
Die hier gewonnenen Einsichten sind richtig, aber sie sind auch bekannt. Warum
also die Veröffentlichung?
Berlin. Alfred Neumeyer.
Gottfried Rahn: Britsch und Klage s. Zur philosophischen Grund-
legung deutscher Kunsterziehung. Fr. Manns Pädagog. Magazin, Langensalza
1934.
Der Verfasser versucht die Erörterung kunstwissenschaftlicher Probleme (Zu-
sammenhang von Erlebnis und Kunstschaffen, lebendige und geistige Bedingungen des
Kunstschaffens, Verstehen von Kunstwerken usw.) dadurch zu beleben, daß er den
kunstphilosophischen Erkenntnissen von Ludwig Klages die Hauptsätze der Kunst-
theorie von Gustaf Britsch gegenüberstellt. Klages hat, wie man weiß, eine durchaus
neuartige Metaphysik des Lebens geschaffen. Dabei kam er mehrfach zu bedeutsamen
Äußerungen über Ursprung und Wesen der Kunst und das Verhältnis von Kunst
und Wirklichkeit. Vor allem war es der radikale Bruch mit dem überlieferten Wirk-
lichkeitsbegriff in seiner Lehre von der „Wirklichkeit der Bilder", der auch für die
Kunstwissenschaft von grundsätzlicher Bedeutung ist. Es ist u. E. das Beste am Rahn-
schen Buch, daß es eben dafür eine gewisse Witterung besitzt. Der Verfasser hat die
im Klagesschen Gesamtwerk verstreuten und z. T. nicht leicht auffindbaren kunst-
philosophischen Hauptsätze im Zusammenhang zitiert und dargestellt. Diese Arbeit
bestreitet weitaus den größten Teil der Schrift. Da nun aber bei Klages der (bewußte)
„Geist" im ursprünglichen Kunstschaffen, das wesentlich gestaltende Offenbarung der
Bilder des Lebens durch die bildschwangere Menschenseele ist, eine nur untergeord-
nete Rolle spielt, glaubte Rahn (zum Zwecke der Ergänzung und zum Teil, wie er
meint, auch „Widerlegung") den Kantianer Britsch zu Hilfe rufen zu müssen. Für
Britsch ist Kunstschaffen geistiges Verarbeiten von „Gesichtssinneserlebnissen" (bzw.
„Gehörssinneserlebnissen"), und auch das Kunsterlebnis gipfelt ihm zufolge in der
„Beurteilung" von Sinneserlebnissen. Die Kunst stellt also einen besonderen Bezirk
geistigen Erkennens dar. — Diese Methode der Gegenüberstellung von Antipoden
hätte fraglos Ergebnisse zeitigen können. Daß dies dennoch nicht der Fall ist, hat