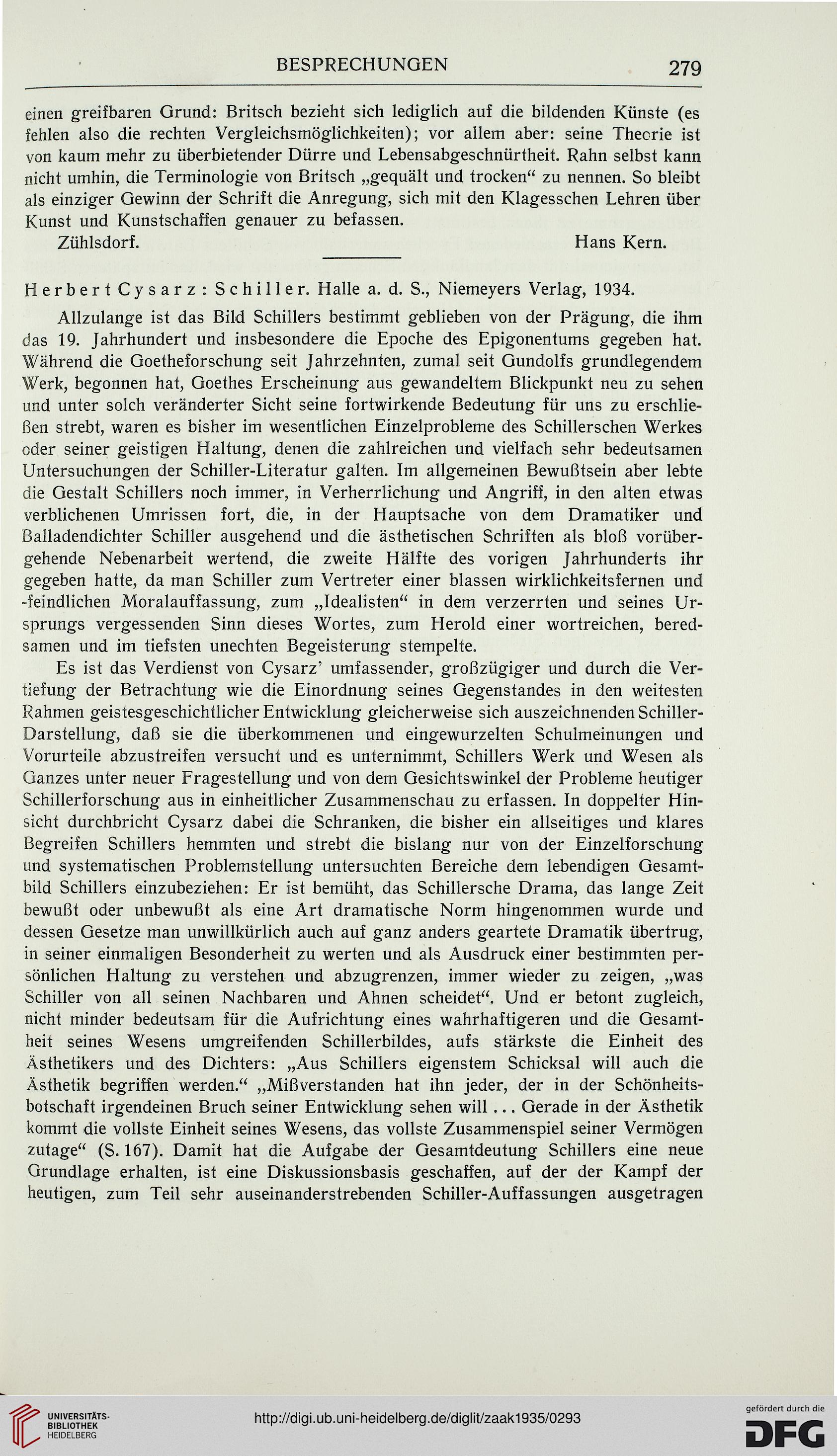BESPRECHUNGEN
279
einen greifbaren Grund: Britsch bezieht sich lediglich auf die bildenden Künste (es
fehlen also die rechten Vergleichsmöglichkeiten); vor allem aber: seine Theorie ist
von kaum mehr zu überbietender Dürre und Lebensabgeschnürtheit. Rahn selbst kann
nicht umhin, die Terminologie von Britsch „gequält und trocken" zu nennen. So bleibt
als einziger Gewinn der Schrift die Anregung, sich mit den Klagesschen Lehren über
Kunst und Kunstschaffen genauer zu befassen.
Zühlsdorf. Hans Kern.
Herbert Cysarz: Schiller. Halle a. d. S., Niemeyers Verlag, 1934.
Allzulange ist das Bild Schillers bestimmt geblieben von der Prägung, die ihm
das 19. Jahrhundert und insbesondere die Epoche des Epigonentums gegeben hat.
Während die Goetheforschung seit Jahrzehnten, zumal seit Gundolfs grundlegendem
Werk, begonnen hat, Goethes Erscheinung aus gewandeltem Blickpunkt neu zu sehen
und unter solch veränderter Sicht seine fortwirkende Bedeutung für uns zu erschlie-
ßen strebt, waren es bisher im wesentlichen Einzelprobleme des Schillerschen Werkes
oder seiner geistigen Haltung, denen die zahlreichen und vielfach sehr bedeutsamen
Untersuchungen der Schiller-Literatur galten. Im allgemeinen Bewußtsein aber lebte
die Gestalt Schillers noch immer, in Verherrlichung und Angriff, in den alten etwas
verblichenen Umrissen fort, die, in der Hauptsache von dem Dramatiker und
Balladendichter Schiller ausgehend und die ästhetischen Schriften als bloß vorüber-
gehende Nebenarbeit wertend, die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts ihr
gegeben hatte, da man Schiller zum Vertreter einer blassen wirklichkeitsfernen und
-feindlichen Moralauffassung, zum „Idealisten" in dem verzerrten und seines Ur-
sprungs vergessenden Sinn dieses Wortes, zum Herold einer wortreichen, bered-
samen und im tiefsten unechten Begeisterung stempelte.
Es ist das Verdienst von Cysarz' umfassender, großzügiger und durch die Ver-
tiefung der Betrachtung wie die Einordnung seines Gegenstandes in den weitesten
Rahmen geistesgeschichtlicher Entwicklung gleicherweise sich auszeichnenden Schiller-
Darstellung, daß sie die überkommenen und eingewurzelten Schulmeinungen und
Vorurteile abzustreifen versucht und es unternimmt, Schillers Werk und Wesen als
Ganzes unter neuer Fragestellung und von dem Gesichtswinkel der Probleme heutiger
Schillerforschung aus in einheitlicher Zusammenschau zu erfassen. In doppelter Hin-
sicht durchbricht Cysarz dabei die Schranken, die bisher ein allseitiges und klares
Begreifen Schillers hemmten und strebt die bislang nur von der Einzelforschung
und systematischen Problemstellung untersuchten Bereiche dem lebendigen Gesamt-
bild Schillers einzubeziehen: Er ist bemüht, das Schillersche Drama, das lange Zeit
bewußt oder unbewußt als eine Art dramatische Norm hingenommen wurde und
dessen Gesetze man unwillkürlich auch auf ganz anders geartete Dramatik übertrug,
in seiner einmaligen Besonderheit zu werten und als Ausdruck einer bestimmten per-
sönlichen Haltung zu verstehen und abzugrenzen, immer wieder zu zeigen, „was
Schiller von all seinen Nachbaren und Ahnen scheidet". Und er betont zugleich,
nicht minder bedeutsam für die Aufrichtung eines wahrhaftigeren und die Gesamt-
heit seines Wesens umgreifenden Schillerbildes, aufs stärkste die Einheit des
Ästhetikers und des Dichters: „Aus Schillers eigenstem Schicksal will auch die
Ästhetik begriffen werden." „Mißverstanden hat ihn jeder, der in der Schönheits-
botschaft irgendeinen Bruch seiner Entwicklung sehen will ... Gerade in der Ästhetik
kommt die vollste Einheit seines Wesens, das vollste Zusammenspiel seiner Vermögen
zutage" (S. 167). Damit hat die Aufgabe der Gesamtdeutung Schillers eine neue
Grundlage erhalten, ist eine Diskussionsbasis geschaffen, auf der der Kampf der
heutigen, zum Teil sehr auseinanderstrebenden Schiller-Auffassungen ausgetragen
279
einen greifbaren Grund: Britsch bezieht sich lediglich auf die bildenden Künste (es
fehlen also die rechten Vergleichsmöglichkeiten); vor allem aber: seine Theorie ist
von kaum mehr zu überbietender Dürre und Lebensabgeschnürtheit. Rahn selbst kann
nicht umhin, die Terminologie von Britsch „gequält und trocken" zu nennen. So bleibt
als einziger Gewinn der Schrift die Anregung, sich mit den Klagesschen Lehren über
Kunst und Kunstschaffen genauer zu befassen.
Zühlsdorf. Hans Kern.
Herbert Cysarz: Schiller. Halle a. d. S., Niemeyers Verlag, 1934.
Allzulange ist das Bild Schillers bestimmt geblieben von der Prägung, die ihm
das 19. Jahrhundert und insbesondere die Epoche des Epigonentums gegeben hat.
Während die Goetheforschung seit Jahrzehnten, zumal seit Gundolfs grundlegendem
Werk, begonnen hat, Goethes Erscheinung aus gewandeltem Blickpunkt neu zu sehen
und unter solch veränderter Sicht seine fortwirkende Bedeutung für uns zu erschlie-
ßen strebt, waren es bisher im wesentlichen Einzelprobleme des Schillerschen Werkes
oder seiner geistigen Haltung, denen die zahlreichen und vielfach sehr bedeutsamen
Untersuchungen der Schiller-Literatur galten. Im allgemeinen Bewußtsein aber lebte
die Gestalt Schillers noch immer, in Verherrlichung und Angriff, in den alten etwas
verblichenen Umrissen fort, die, in der Hauptsache von dem Dramatiker und
Balladendichter Schiller ausgehend und die ästhetischen Schriften als bloß vorüber-
gehende Nebenarbeit wertend, die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts ihr
gegeben hatte, da man Schiller zum Vertreter einer blassen wirklichkeitsfernen und
-feindlichen Moralauffassung, zum „Idealisten" in dem verzerrten und seines Ur-
sprungs vergessenden Sinn dieses Wortes, zum Herold einer wortreichen, bered-
samen und im tiefsten unechten Begeisterung stempelte.
Es ist das Verdienst von Cysarz' umfassender, großzügiger und durch die Ver-
tiefung der Betrachtung wie die Einordnung seines Gegenstandes in den weitesten
Rahmen geistesgeschichtlicher Entwicklung gleicherweise sich auszeichnenden Schiller-
Darstellung, daß sie die überkommenen und eingewurzelten Schulmeinungen und
Vorurteile abzustreifen versucht und es unternimmt, Schillers Werk und Wesen als
Ganzes unter neuer Fragestellung und von dem Gesichtswinkel der Probleme heutiger
Schillerforschung aus in einheitlicher Zusammenschau zu erfassen. In doppelter Hin-
sicht durchbricht Cysarz dabei die Schranken, die bisher ein allseitiges und klares
Begreifen Schillers hemmten und strebt die bislang nur von der Einzelforschung
und systematischen Problemstellung untersuchten Bereiche dem lebendigen Gesamt-
bild Schillers einzubeziehen: Er ist bemüht, das Schillersche Drama, das lange Zeit
bewußt oder unbewußt als eine Art dramatische Norm hingenommen wurde und
dessen Gesetze man unwillkürlich auch auf ganz anders geartete Dramatik übertrug,
in seiner einmaligen Besonderheit zu werten und als Ausdruck einer bestimmten per-
sönlichen Haltung zu verstehen und abzugrenzen, immer wieder zu zeigen, „was
Schiller von all seinen Nachbaren und Ahnen scheidet". Und er betont zugleich,
nicht minder bedeutsam für die Aufrichtung eines wahrhaftigeren und die Gesamt-
heit seines Wesens umgreifenden Schillerbildes, aufs stärkste die Einheit des
Ästhetikers und des Dichters: „Aus Schillers eigenstem Schicksal will auch die
Ästhetik begriffen werden." „Mißverstanden hat ihn jeder, der in der Schönheits-
botschaft irgendeinen Bruch seiner Entwicklung sehen will ... Gerade in der Ästhetik
kommt die vollste Einheit seines Wesens, das vollste Zusammenspiel seiner Vermögen
zutage" (S. 167). Damit hat die Aufgabe der Gesamtdeutung Schillers eine neue
Grundlage erhalten, ist eine Diskussionsbasis geschaffen, auf der der Kampf der
heutigen, zum Teil sehr auseinanderstrebenden Schiller-Auffassungen ausgetragen