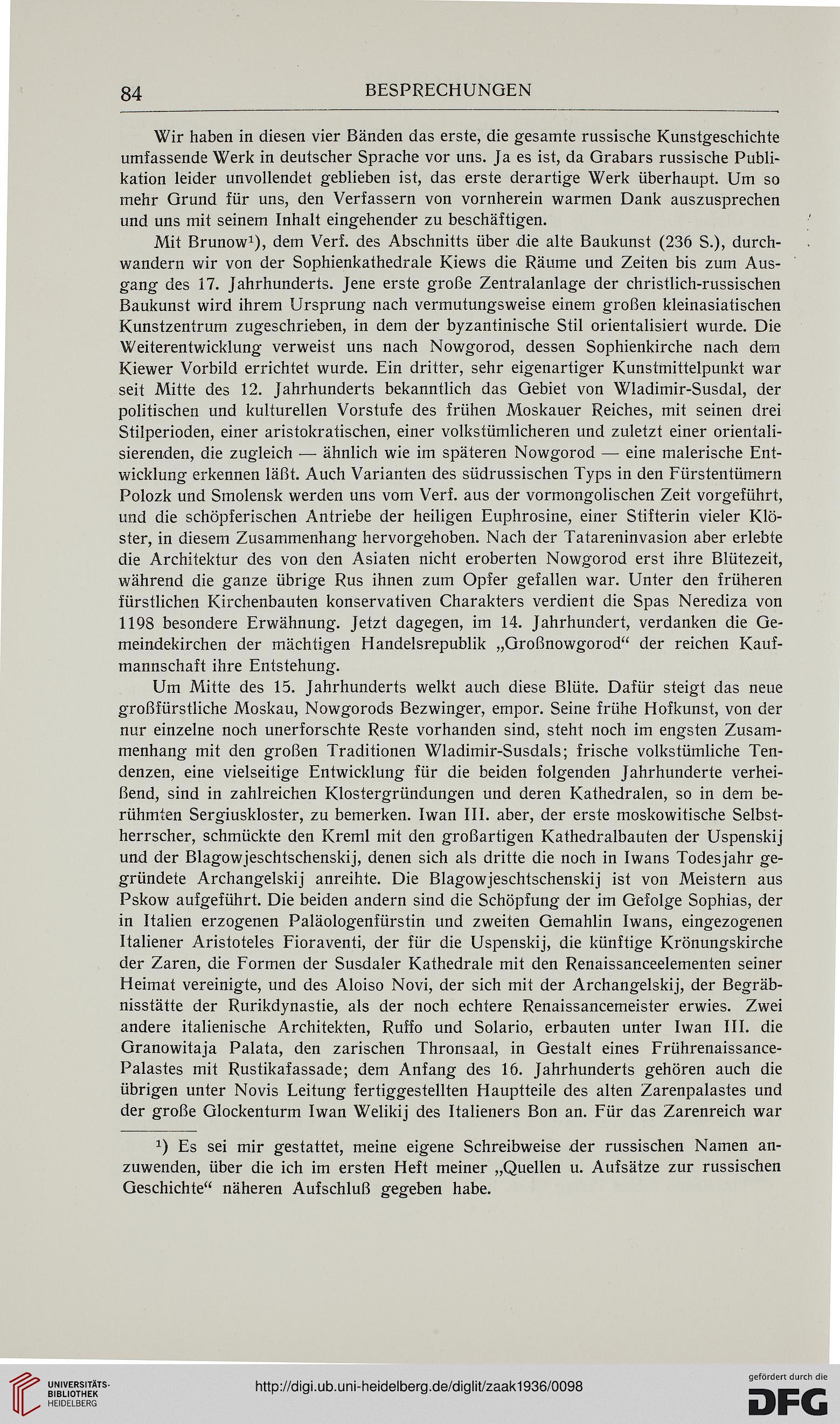Wir haben in diesen vier Bänden das erste, die gesamte russische Kunstgeschichte
umfassende Werk in deutscher Sprache vor uns. Ja es ist, da Grabars russische Publi-
kation leider unvollendet geblieben ist, das erste derartige Werk überhaupt. Um so
mehr Grund für uns, den Verfassern von vornherein warmen Dank auszusprechen
und uns mit seinem Inhalt eingehender zu beschäftigen.
Mit Brunow1), dem Verf. des Abschnitts über die alte Baukunst (236 S.), durch-
wandern wir von der Sophienkathedrale Kiews die Räume und Zeiten bis zum Aus-
gang des 17. Jahrhunderts. Jene erste große Zentralanlage der christlich-russischen
Baukunst wird ihrem Ursprung nach vermutungsweise einem großen kleinasiatischen
Kunstzentrum zugeschrieben, in dem der byzantinische Stil orientalisiert wurde. Die
Weiterentwicklung verweist uns nach Nowgorod, dessen Sophienkirche nach dem
Kiewer Vorbild errichtet wurde. Ein dritter, sehr eigenartiger Kunstmittelpunkt war
seit Mitte des 12. Jahrhunderts bekanntlich das Gebiet von Wladimir-Susdal, der
politischen und kulturellen Vorstufe des frühen Moskauer Reiches, mit seinen drei
Stilperioden, einer aristokratischen, einer volkstümlicheren und zuletzt einer orientali-
sierenden, die zugleich — ähnlich wie im späteren Nowgorod — eine malerische Ent-
wicklung erkennen läßt. Auch Varianten des südrussischen Typs in den Fürstentümern
Polozk und Smolensk werden uns vom Verf. aus der vormongolischen Zeit vorgeführt,
und die schöpferischen Antriebe der heiligen Euphrosine, einer Stifterin vieler Klö-
ster, in diesem Zusammenhang hervorgehoben. Nach der Tatareninvasion aber erlebte
die Architektur des von den Asiaten nicht eroberten Nowgorod erst ihre Blütezeit,
während die ganze übrige Rus ihnen zum Opfer gefallen war. Unter den früheren
fürstlichen Kirchenbauten konservativen Charakters verdient die Spas Nerediza von
1198 besondere Erwähnung. Jetzt dagegen, im 14. Jahrhundert, verdanken die Ge-
meindekirchen der mächtigen Handelsrepublik „Großnowgorod" der reichen Kauf-
mannschaft ihre Entstehung.
Um Mitte des 15. Jahrhunderts welkt auch diese Blüte. Dafür steigt das neue
großfürstliche Moskau, Nowgorods Bezwinger, empor. Seine frühe Hofkunst, von der
nur einzelne noch unerforschte Reste vorhanden sind, steht noch im engsten Zusam-
menhang mit den großen Traditionen Wladimir-Susdals; frische volkstümliche Ten-
denzen, eine vielseitige Entwicklung für die beiden folgenden Jahrhunderte verhei-
ßend, sind in zahlreichen Klostergründungen und deren Kathedralen, so in dem be-
rühmten Sergiuskloster, zu bemerken. Iwan III. aber, der erste moskowitische Selbst-
herrscher, schmückte den Kreml mit den großartigen Kathedralbauten der Uspenskij
und der Blagowjeschtschenskij, denen sich als dritte die noch in Iwans Todesjahr ge-
gründete Archangelskij anreihte. Die Blagowjeschtschenskij ist von Meistern aus
Pskow aufgeführt. Die beiden andern sind die Schöpfung der im Gefolge Sophias, der
in Italien erzogenen Paläologenfürstin und zweiten Gemahlin Iwans, eingezogenen
Italiener Aristoteles Fioraventi, der für die Uspenskij, die künftige Krönungskirche
der Zaren, die Formen der Susdaler Kathedrale mit den Renaissanceelementen seiner
Heimat vereinigte, und des Aloiso Novi, der sich mit der Archangelskij, der Begräb-
nisstätte der Rurikdynastie, als der noch echtere Renaissancemeister erwies. Zwei
andere italienische Architekten, Ruffo und Solario, erbauten unter Iwan III. die
Granowitaja Palata, den zarischen Thronsaal, in Gestalt eines Frührenaissance-
Palastes mit Rustikafassade; dem Anfang des 16. Jahrhunderts gehören auch die
übrigen unter Novis Leitung fertiggestellten Hauptteile des alten Zarenpalastes und
der große Glockenturm Iwan Welikij des Italieners Bon an. Für das Zarenreich war
x) Es sei mir gestattet, meine eigene Schreibweise der russischen Namen an-
zuwenden, über die ich im ersten Heft meiner „Quellen u. Aufsätze zur russischen
Geschichte" näheren Aufschluß gegeben habe.
umfassende Werk in deutscher Sprache vor uns. Ja es ist, da Grabars russische Publi-
kation leider unvollendet geblieben ist, das erste derartige Werk überhaupt. Um so
mehr Grund für uns, den Verfassern von vornherein warmen Dank auszusprechen
und uns mit seinem Inhalt eingehender zu beschäftigen.
Mit Brunow1), dem Verf. des Abschnitts über die alte Baukunst (236 S.), durch-
wandern wir von der Sophienkathedrale Kiews die Räume und Zeiten bis zum Aus-
gang des 17. Jahrhunderts. Jene erste große Zentralanlage der christlich-russischen
Baukunst wird ihrem Ursprung nach vermutungsweise einem großen kleinasiatischen
Kunstzentrum zugeschrieben, in dem der byzantinische Stil orientalisiert wurde. Die
Weiterentwicklung verweist uns nach Nowgorod, dessen Sophienkirche nach dem
Kiewer Vorbild errichtet wurde. Ein dritter, sehr eigenartiger Kunstmittelpunkt war
seit Mitte des 12. Jahrhunderts bekanntlich das Gebiet von Wladimir-Susdal, der
politischen und kulturellen Vorstufe des frühen Moskauer Reiches, mit seinen drei
Stilperioden, einer aristokratischen, einer volkstümlicheren und zuletzt einer orientali-
sierenden, die zugleich — ähnlich wie im späteren Nowgorod — eine malerische Ent-
wicklung erkennen läßt. Auch Varianten des südrussischen Typs in den Fürstentümern
Polozk und Smolensk werden uns vom Verf. aus der vormongolischen Zeit vorgeführt,
und die schöpferischen Antriebe der heiligen Euphrosine, einer Stifterin vieler Klö-
ster, in diesem Zusammenhang hervorgehoben. Nach der Tatareninvasion aber erlebte
die Architektur des von den Asiaten nicht eroberten Nowgorod erst ihre Blütezeit,
während die ganze übrige Rus ihnen zum Opfer gefallen war. Unter den früheren
fürstlichen Kirchenbauten konservativen Charakters verdient die Spas Nerediza von
1198 besondere Erwähnung. Jetzt dagegen, im 14. Jahrhundert, verdanken die Ge-
meindekirchen der mächtigen Handelsrepublik „Großnowgorod" der reichen Kauf-
mannschaft ihre Entstehung.
Um Mitte des 15. Jahrhunderts welkt auch diese Blüte. Dafür steigt das neue
großfürstliche Moskau, Nowgorods Bezwinger, empor. Seine frühe Hofkunst, von der
nur einzelne noch unerforschte Reste vorhanden sind, steht noch im engsten Zusam-
menhang mit den großen Traditionen Wladimir-Susdals; frische volkstümliche Ten-
denzen, eine vielseitige Entwicklung für die beiden folgenden Jahrhunderte verhei-
ßend, sind in zahlreichen Klostergründungen und deren Kathedralen, so in dem be-
rühmten Sergiuskloster, zu bemerken. Iwan III. aber, der erste moskowitische Selbst-
herrscher, schmückte den Kreml mit den großartigen Kathedralbauten der Uspenskij
und der Blagowjeschtschenskij, denen sich als dritte die noch in Iwans Todesjahr ge-
gründete Archangelskij anreihte. Die Blagowjeschtschenskij ist von Meistern aus
Pskow aufgeführt. Die beiden andern sind die Schöpfung der im Gefolge Sophias, der
in Italien erzogenen Paläologenfürstin und zweiten Gemahlin Iwans, eingezogenen
Italiener Aristoteles Fioraventi, der für die Uspenskij, die künftige Krönungskirche
der Zaren, die Formen der Susdaler Kathedrale mit den Renaissanceelementen seiner
Heimat vereinigte, und des Aloiso Novi, der sich mit der Archangelskij, der Begräb-
nisstätte der Rurikdynastie, als der noch echtere Renaissancemeister erwies. Zwei
andere italienische Architekten, Ruffo und Solario, erbauten unter Iwan III. die
Granowitaja Palata, den zarischen Thronsaal, in Gestalt eines Frührenaissance-
Palastes mit Rustikafassade; dem Anfang des 16. Jahrhunderts gehören auch die
übrigen unter Novis Leitung fertiggestellten Hauptteile des alten Zarenpalastes und
der große Glockenturm Iwan Welikij des Italieners Bon an. Für das Zarenreich war
x) Es sei mir gestattet, meine eigene Schreibweise der russischen Namen an-
zuwenden, über die ich im ersten Heft meiner „Quellen u. Aufsätze zur russischen
Geschichte" näheren Aufschluß gegeben habe.