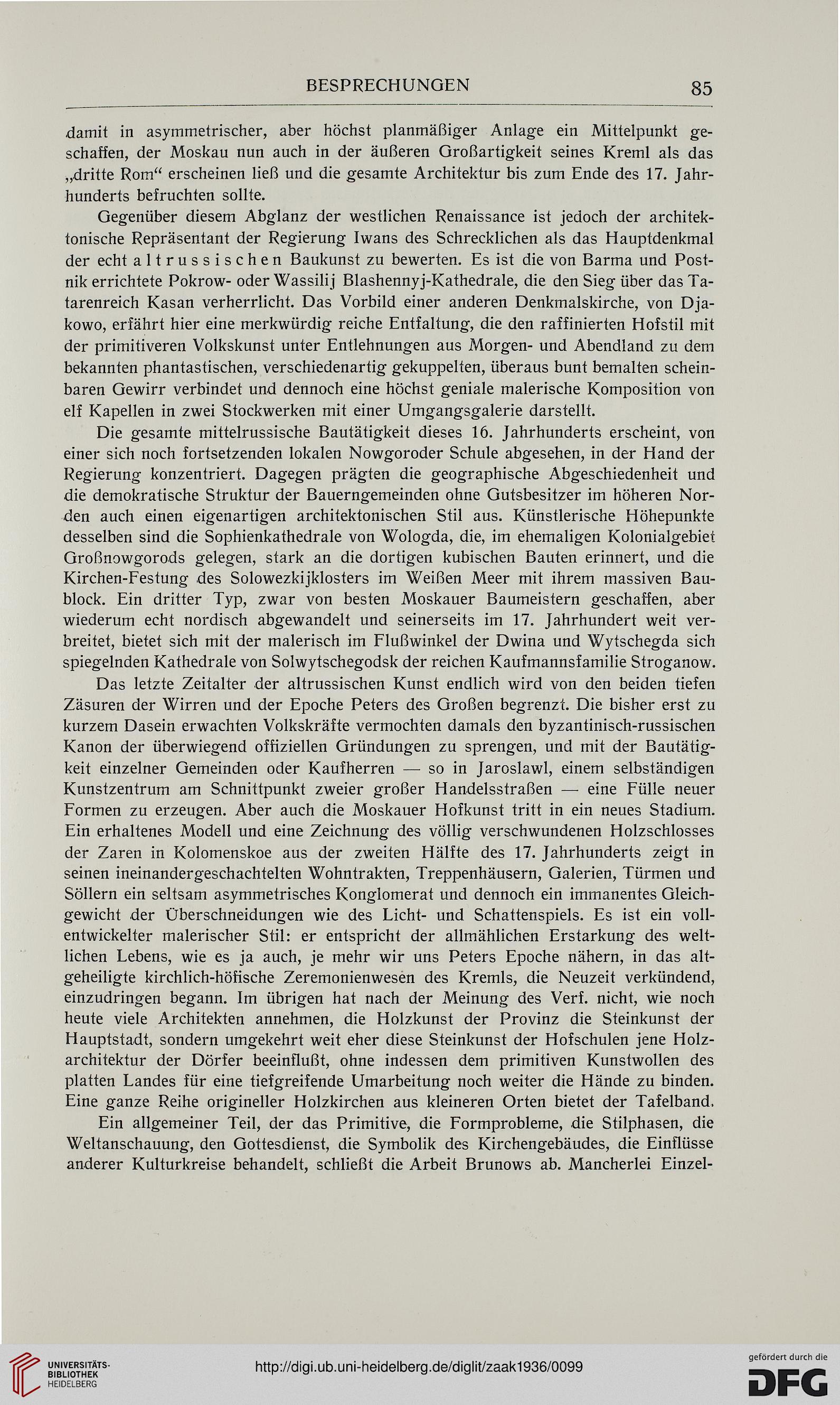damit in asymmetrischer, aber höchst planmäßiger Anlage ein Mittelpunkt ge-
schaffen, der Moskau nun auch in der äußeren Großartigkeit seines Kreml als das
„dritte Rom" erscheinen ließ und die gesamte Architektur bis zum Ende des 17. Jahr-
hunderts befruchten sollte.
Gegenüber diesem Abglanz der westlichen Renaissance ist jedoch der architek-
tonische Repräsentant der Regierung Iwans des Schrecklichen als das Hauptdenkmal
der echt altrussischen Baukunst zu bewerten. Es ist die von Barma und Post-
nik errichtete Pokrow- oder Wassili j Blashennyj-Kathedrale, die den Sieg über das Ta-
tarenreich Kasan verherrlicht. Das Vorbild einer anderen Denkmalskirche, von Dja-
kowo, erfährt hier eine merkwürdig reiche Entfaltung, die den raffinierten Hofstil mit
der primitiveren Volkskunst unter Entlehnungen aus Morgen- und Abendland zu dem
bekannten phantastischen, verschiedenartig gekuppelten, überaus bunt bemalten schein-
baren Gewirr verbindet und dennoch eine höchst geniale malerische Komposition von
elf Kapellen in zwei Stockwerken mit einer Umgangsgalerie darstellt.
Die gesamte mittelrussische Bautätigkeit dieses 16. Jahrhunderts erscheint, von
einer sich noch fortsetzenden lokalen Nowgoroder Schule abgesehen, in der Hand der
Regierung konzentriert. Dagegen prägten die geographische Abgeschiedenheit und
die demokratische Struktur der Bauerngemeinden ohne Gutsbesitzer im höheren Nor-
den auch einen eigenartigen architektonischen Stil aus. Künstlerische Höhepunkte
desselben sind die Sophienkathedrale von Wologda, die, im ehemaligen Kolonialgebiet
Großnowgorods gelegen, stark an die dortigen kubischen Bauten erinnert, und die
Kirchen-Festung des Solowezkijklosters im Weißen Meer mit ihrem massiven Bau-
block. Ein dritter Typ, zwar von besten Moskauer Baumeistern geschaffen, aber
wiederum echt nordisch abgewandelt und seinerseits im 17. Jahrhundert weit ver-
breitet, bietet sich mit der malerisch im Flußwinkel der Dwina und Wytschegda sich
spiegelnden Kathedrale von Solwytschegodsk der reichen Kaufmannsfamilie Stroganow.
Das letzte Zeitalter der altrussischen Kunst endlich wird von den beiden tiefen
Zäsuren der Wirren und der Epoche Peters des Großen begrenzt. Die bisher erst zu
kurzem Dasein erwachten Volkskräfte vermochten damals den byzantinisch-russischen
Kanon der überwiegend offiziellen Gründungen zu sprengen, und mit der Bautätig-
keit einzelner Gemeinden oder Kaufherren — so in Jaroslawl, einem selbständigen
Kunstzentrum am Schnittpunkt zweier großer Handelsstraßen — eine Fülle neuer
Formen zu erzeugen. Aber auch die Moskauer Hofkunst tritt in ein neues Stadium.
Ein erhaltenes Modell und eine Zeichnung des völlig verschwundenen Holzschlosses
der Zaren in Kolomenskoe aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zeigt in
seinen ineinandergeschachtelten Wohntrakten, Treppenhäusern, Galerien, Türmen und
Söllern ein seltsam asymmetrisches Konglomerat und dennoch ein immanentes Gleich-
gewicht der Überschneidungen wie des Licht- und Schattenspiels. Es ist ein voll-
entwickelter malerischer Stil: er entspricht der allmählichen Erstarkung des welt-
lichen Lebens, wie es ja auch, je mehr wir uns Peters Epoche nähern, in das alt-
geheiligte kirchlich-höfische Zeremonienwesen des Kremls, die Neuzeit verkündend,
einzudringen begann. Im übrigen hat nach der Meinung des Verf. nicht, wie noch
heute viele Architekten annehmen, die Holzkunst der Provinz die Steinkunst der
Hauptstadt, sondern umgekehrt weit eher diese Steinkunst der Hofschulen jene Holz-
architektur der Dörfer beeinflußt, ohne indessen dem primitiven Kunstwollen des
platten Landes für eine tiefgreifende Umarbeitung noch weiter die Hände zu binden.
Eine ganze Reihe origineller Holzkirchen aus kleineren Orten bietet der Tafelband,
Ein allgemeiner Teil, der das Primitive, die Formprobleme, die Stilphasen, die
Weltanschauung, den Gottesdienst, die Symbolik des Kirchengebäudes, die Einflüsse
anderer Kulturkreise behandelt, schließt die Arbeit Brunows ab. Mancherlei Einzel-
schaffen, der Moskau nun auch in der äußeren Großartigkeit seines Kreml als das
„dritte Rom" erscheinen ließ und die gesamte Architektur bis zum Ende des 17. Jahr-
hunderts befruchten sollte.
Gegenüber diesem Abglanz der westlichen Renaissance ist jedoch der architek-
tonische Repräsentant der Regierung Iwans des Schrecklichen als das Hauptdenkmal
der echt altrussischen Baukunst zu bewerten. Es ist die von Barma und Post-
nik errichtete Pokrow- oder Wassili j Blashennyj-Kathedrale, die den Sieg über das Ta-
tarenreich Kasan verherrlicht. Das Vorbild einer anderen Denkmalskirche, von Dja-
kowo, erfährt hier eine merkwürdig reiche Entfaltung, die den raffinierten Hofstil mit
der primitiveren Volkskunst unter Entlehnungen aus Morgen- und Abendland zu dem
bekannten phantastischen, verschiedenartig gekuppelten, überaus bunt bemalten schein-
baren Gewirr verbindet und dennoch eine höchst geniale malerische Komposition von
elf Kapellen in zwei Stockwerken mit einer Umgangsgalerie darstellt.
Die gesamte mittelrussische Bautätigkeit dieses 16. Jahrhunderts erscheint, von
einer sich noch fortsetzenden lokalen Nowgoroder Schule abgesehen, in der Hand der
Regierung konzentriert. Dagegen prägten die geographische Abgeschiedenheit und
die demokratische Struktur der Bauerngemeinden ohne Gutsbesitzer im höheren Nor-
den auch einen eigenartigen architektonischen Stil aus. Künstlerische Höhepunkte
desselben sind die Sophienkathedrale von Wologda, die, im ehemaligen Kolonialgebiet
Großnowgorods gelegen, stark an die dortigen kubischen Bauten erinnert, und die
Kirchen-Festung des Solowezkijklosters im Weißen Meer mit ihrem massiven Bau-
block. Ein dritter Typ, zwar von besten Moskauer Baumeistern geschaffen, aber
wiederum echt nordisch abgewandelt und seinerseits im 17. Jahrhundert weit ver-
breitet, bietet sich mit der malerisch im Flußwinkel der Dwina und Wytschegda sich
spiegelnden Kathedrale von Solwytschegodsk der reichen Kaufmannsfamilie Stroganow.
Das letzte Zeitalter der altrussischen Kunst endlich wird von den beiden tiefen
Zäsuren der Wirren und der Epoche Peters des Großen begrenzt. Die bisher erst zu
kurzem Dasein erwachten Volkskräfte vermochten damals den byzantinisch-russischen
Kanon der überwiegend offiziellen Gründungen zu sprengen, und mit der Bautätig-
keit einzelner Gemeinden oder Kaufherren — so in Jaroslawl, einem selbständigen
Kunstzentrum am Schnittpunkt zweier großer Handelsstraßen — eine Fülle neuer
Formen zu erzeugen. Aber auch die Moskauer Hofkunst tritt in ein neues Stadium.
Ein erhaltenes Modell und eine Zeichnung des völlig verschwundenen Holzschlosses
der Zaren in Kolomenskoe aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zeigt in
seinen ineinandergeschachtelten Wohntrakten, Treppenhäusern, Galerien, Türmen und
Söllern ein seltsam asymmetrisches Konglomerat und dennoch ein immanentes Gleich-
gewicht der Überschneidungen wie des Licht- und Schattenspiels. Es ist ein voll-
entwickelter malerischer Stil: er entspricht der allmählichen Erstarkung des welt-
lichen Lebens, wie es ja auch, je mehr wir uns Peters Epoche nähern, in das alt-
geheiligte kirchlich-höfische Zeremonienwesen des Kremls, die Neuzeit verkündend,
einzudringen begann. Im übrigen hat nach der Meinung des Verf. nicht, wie noch
heute viele Architekten annehmen, die Holzkunst der Provinz die Steinkunst der
Hauptstadt, sondern umgekehrt weit eher diese Steinkunst der Hofschulen jene Holz-
architektur der Dörfer beeinflußt, ohne indessen dem primitiven Kunstwollen des
platten Landes für eine tiefgreifende Umarbeitung noch weiter die Hände zu binden.
Eine ganze Reihe origineller Holzkirchen aus kleineren Orten bietet der Tafelband,
Ein allgemeiner Teil, der das Primitive, die Formprobleme, die Stilphasen, die
Weltanschauung, den Gottesdienst, die Symbolik des Kirchengebäudes, die Einflüsse
anderer Kulturkreise behandelt, schließt die Arbeit Brunows ab. Mancherlei Einzel-