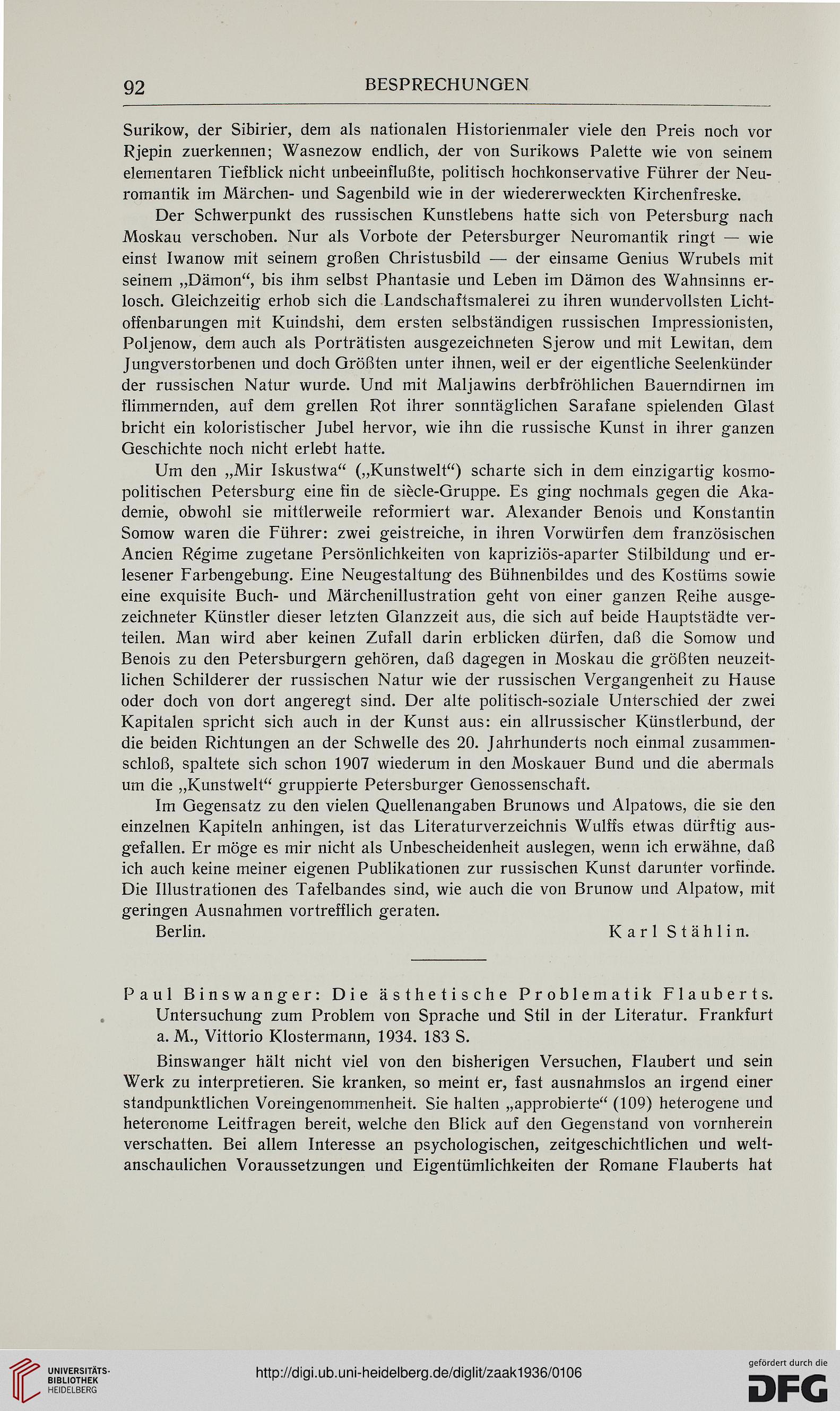Surikow, der Sibirier, dem als nationalen Historienmaler viele den Preis noch vor
Rjepin zuerkennen; Wasnezow endlich, der von Surikows Palette wie von seinem
elementaren Tiefblick nicht unbeeinflußte, politisch hochkonservative Führer der Neu-
romantik im Märchen- und Sagenbild wie in der wiedererweckten Kirchenfreske.
Der Schwerpunkt des russischen Kunstlebens hatte sich von Petersburg nach
Moskau verschoben. Nur als Vorbote der Petersburger Neuromantik ringt — wie
einst Iwanow mit seinem großen Christusbild — der einsame Genius Wrubels mit
seinem „Dämon", bis ihm selbst Phantasie und Leben im Dämon des Wahnsinns er-
losch. Gleichzeitig erhob sich die Landschaftsmalerei zu ihren wundervollsten Licht-
offenbarungen mit Kuindshi, dem ersten selbständigen russischen Impressionisten,
Poljenow, dem auch als Porträtisten ausgezeichneten Sjerow und mit Lewitan, dem
Jungverstorbenen und doch Größten unter ihnen, weil er der eigentliche Seelenkünder
der russischen Natur wurde. Und mit Maljawins derbfröhlichen Bauerndirnen im
flimmernden, auf dem grellen Rot ihrer sonntäglichen Sarafane spielenden Glast
bricht ein koloristischer Jubel hervor, wie ihn die russische Kunst in ihrer ganzen
Geschichte noch nicht erlebt hatte.
Um den „Mir Iskustwa" („Kunstwelt") scharte sich in dem einzigartig kosmo-
politischen Petersburg eine fin de siecle-Gruppe. Es ging nochmals gegen die Aka-
demie, obwohl sie mittlerweile reformiert war. Alexander Benois und Konstantin
Somow waren die Führer: zwei geistreiche, in ihren Vorwürfen dem französischen
Ancien Regime zugetane Persönlichkeiten von kapriziös-aparter Stilbildung und er-
lesener Farbengebung. Eine Neugestaltung des Bühnenbildes und des Kostüms sowie
eine exquisite Buch- und Märchenillustration geht von einer ganzen Reihe ausge-
zeichneter Künstler dieser letzten Glanzzeit aus, die sich auf beide Hauptstädte ver-
teilen. Man wird aber keinen Zufall darin erblicken dürfen, daß die Somow und
Benois zu den Petersburgern gehören, daß dagegen in Moskau die größten neuzeit-
lichen Schilderer der russischen Natur wie der russischen Vergangenheit zu Hause
oder doch von dort angeregt sind. Der alte politisch-soziale Unterschied der zwei
Kapitalen spricht sich auch in der Kunst aus: ein allrussischer Künstlerbund, der
die beiden Richtungen an der Schwelle des 20. Jahrhunderts noch einmal zusammen-
schloß, spaltete sich schon 1907 wiederum in den Moskauer Bund und die abermals
um die „Kunstwelt" gruppierte Petersburger Genossenschaft.
Im Gegensatz zu den vielen Quellenangaben Brunows und Alpatows, die sie den
einzelnen Kapiteln anhingen, ist das Literaturverzeichnis Wulffs etwas dürftig aus-
gefallen. Er möge es mir nicht als Unbescheidenheit auslegen, wenn ich erwähne, daß
ich auch keine meiner eigenen Publikationen zur russischen Kunst darunter vorfinde.
Die Illustrationen des Tafelbandes sind, wie auch die von Brunow und Alpatow, mit
geringen Ausnahmen vortrefflich geraten.
Berlin. Karl Stählin.
Paul Binswanger: Die ästhetische Problematik Flauberts.
Untersuchung zum Problem von Sprache und Stil in der Literatur. Frankfurt
a. M., Vittorio Klostermann, 1934. 183 S.
Binswanger hält nicht viel von den bisherigen Versuchen, Flaubert und sein
Werk zu interpretieren. Sie kranken, so meint er, fast ausnahmslos an irgend einer
standpunktlichen Voreingenommenheit. Sie halten „approbierte" (109) heterogene und
heteronome Leitfragen bereit, welche den Blick auf den Gegenstand von vornherein
verschatten. Bei allem Interesse an psychologischen, zeitgeschichtlichen und welt-
anschaulichen Voraussetzungen und Eigentümlichkeiten der Romane Flauberts hat
Rjepin zuerkennen; Wasnezow endlich, der von Surikows Palette wie von seinem
elementaren Tiefblick nicht unbeeinflußte, politisch hochkonservative Führer der Neu-
romantik im Märchen- und Sagenbild wie in der wiedererweckten Kirchenfreske.
Der Schwerpunkt des russischen Kunstlebens hatte sich von Petersburg nach
Moskau verschoben. Nur als Vorbote der Petersburger Neuromantik ringt — wie
einst Iwanow mit seinem großen Christusbild — der einsame Genius Wrubels mit
seinem „Dämon", bis ihm selbst Phantasie und Leben im Dämon des Wahnsinns er-
losch. Gleichzeitig erhob sich die Landschaftsmalerei zu ihren wundervollsten Licht-
offenbarungen mit Kuindshi, dem ersten selbständigen russischen Impressionisten,
Poljenow, dem auch als Porträtisten ausgezeichneten Sjerow und mit Lewitan, dem
Jungverstorbenen und doch Größten unter ihnen, weil er der eigentliche Seelenkünder
der russischen Natur wurde. Und mit Maljawins derbfröhlichen Bauerndirnen im
flimmernden, auf dem grellen Rot ihrer sonntäglichen Sarafane spielenden Glast
bricht ein koloristischer Jubel hervor, wie ihn die russische Kunst in ihrer ganzen
Geschichte noch nicht erlebt hatte.
Um den „Mir Iskustwa" („Kunstwelt") scharte sich in dem einzigartig kosmo-
politischen Petersburg eine fin de siecle-Gruppe. Es ging nochmals gegen die Aka-
demie, obwohl sie mittlerweile reformiert war. Alexander Benois und Konstantin
Somow waren die Führer: zwei geistreiche, in ihren Vorwürfen dem französischen
Ancien Regime zugetane Persönlichkeiten von kapriziös-aparter Stilbildung und er-
lesener Farbengebung. Eine Neugestaltung des Bühnenbildes und des Kostüms sowie
eine exquisite Buch- und Märchenillustration geht von einer ganzen Reihe ausge-
zeichneter Künstler dieser letzten Glanzzeit aus, die sich auf beide Hauptstädte ver-
teilen. Man wird aber keinen Zufall darin erblicken dürfen, daß die Somow und
Benois zu den Petersburgern gehören, daß dagegen in Moskau die größten neuzeit-
lichen Schilderer der russischen Natur wie der russischen Vergangenheit zu Hause
oder doch von dort angeregt sind. Der alte politisch-soziale Unterschied der zwei
Kapitalen spricht sich auch in der Kunst aus: ein allrussischer Künstlerbund, der
die beiden Richtungen an der Schwelle des 20. Jahrhunderts noch einmal zusammen-
schloß, spaltete sich schon 1907 wiederum in den Moskauer Bund und die abermals
um die „Kunstwelt" gruppierte Petersburger Genossenschaft.
Im Gegensatz zu den vielen Quellenangaben Brunows und Alpatows, die sie den
einzelnen Kapiteln anhingen, ist das Literaturverzeichnis Wulffs etwas dürftig aus-
gefallen. Er möge es mir nicht als Unbescheidenheit auslegen, wenn ich erwähne, daß
ich auch keine meiner eigenen Publikationen zur russischen Kunst darunter vorfinde.
Die Illustrationen des Tafelbandes sind, wie auch die von Brunow und Alpatow, mit
geringen Ausnahmen vortrefflich geraten.
Berlin. Karl Stählin.
Paul Binswanger: Die ästhetische Problematik Flauberts.
Untersuchung zum Problem von Sprache und Stil in der Literatur. Frankfurt
a. M., Vittorio Klostermann, 1934. 183 S.
Binswanger hält nicht viel von den bisherigen Versuchen, Flaubert und sein
Werk zu interpretieren. Sie kranken, so meint er, fast ausnahmslos an irgend einer
standpunktlichen Voreingenommenheit. Sie halten „approbierte" (109) heterogene und
heteronome Leitfragen bereit, welche den Blick auf den Gegenstand von vornherein
verschatten. Bei allem Interesse an psychologischen, zeitgeschichtlichen und welt-
anschaulichen Voraussetzungen und Eigentümlichkeiten der Romane Flauberts hat