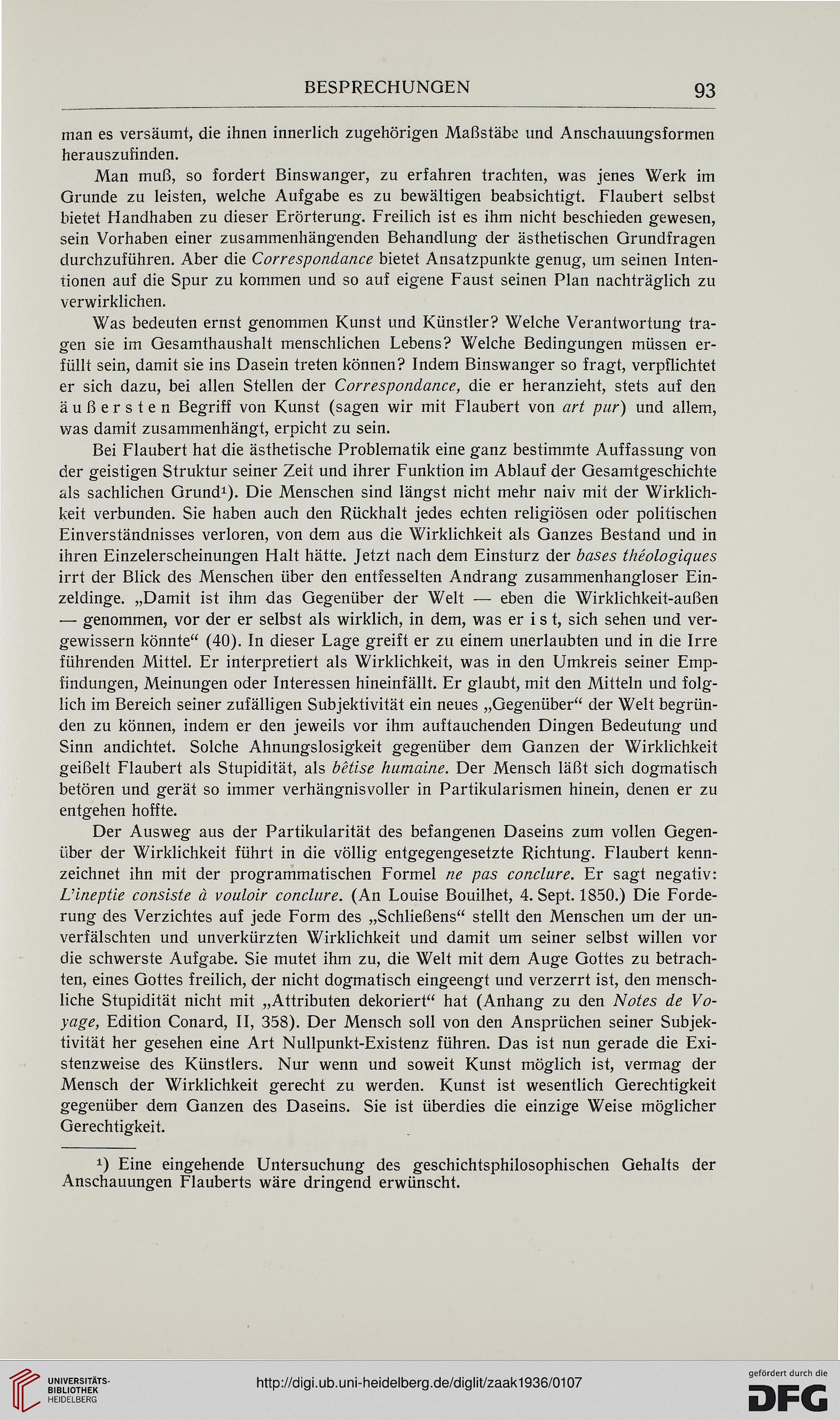BESPRECHUNGEN
93
man es versäumt, die ihnen innerlich zugehörigen Maßstäbe und Anschauungsformen
herauszufinden.
Man muß, so fordert Binswanger, zu erfahren trachten, was jenes Werk im
Grunde zu leisten, welche Aufgabe es zu bewältigen beabsichtigt. Flaubert selbst
bietet Handhaben zu dieser Erörterung. Freilich ist es ihm nicht beschieden gewesen,
sein Vorhaben einer zusammenhängenden Behandlung der ästhetischen Grundfragen
durchzuführen. Aber die Correspondance bietet Ansatzpunkte genug, um seinen Inten-
tionen auf die Spur zu kommen und so auf eigene Faust seinen Plan nachträglich zu
verwirklichen.
Was bedeuten ernst genommen Kunst und Künstler? Welche Verantwortung tra-
gen sie im Gesamthaushalt menschlichen Lebens? Welche Bedingungen müssen er-
füllt sein, damit sie ins Dasein treten können? Indem Binswanger so fragt, verpflichtet
er sich dazu, bei allen Stellen der Correspondance, die er heranzieht, stets auf den
äußersten Begriff von Kunst (sagen wir mit Flaubert von art pur) und allem,
was damit zusammenhängt, erpicht zu sein.
Bei Flaubert hat die ästhetische Problematik eine ganz bestimmte Auffassung von
der geistigen Struktur seiner Zeit und ihrer Funktion im Ablauf der Gesamtgeschichte
als sachlichen Grund1). Die Menschen sind längst nicht mehr naiv mit der Wirklich-
keit verbunden. Sie haben auch den Rückhalt jedes echten religiösen oder politischen
Einverständnisses verloren, von dem aus die Wirklichkeit als Ganzes Bestand und in
ihren Einzelerscheinungen Halt hätte. Jetzt nach dem Einsturz der bases theologiques
irrt der Blick des Menschen über den entfesselten Andrang zusammenhangloser Ein-
zeldinge. „Damit ist ihm das Gegenüber der Welt — eben die Wirklichkeit-außen
— genommen, vor der er selbst als wirklich, in dem, was er i s t, sich sehen und ver-
gewissern könnte" (40). In dieser Lage greift er zu einem unerlaubten und in die Irre
führenden Mittel. Er interpretiert als Wirklichkeit, was in den Umkreis seiner Emp-
findungen, Meinungen oder Interessen hineinfällt. Er glaubt, mit den Mitteln und folg-
lich im Bereich seiner zufälligen Subjektivität ein neues „Gegenüber" der Welt begrün-
den zu können, indem er den jeweils vor ihm auftauchenden Dingen Bedeutung und
Sinn andichtet. Solche Ahnungslosigkeit gegenüber dem Ganzen der Wirklichkeit
geißelt Flaubert als Stupidität, als betise humaine. Der Mensch läßt sich dogmatisch
betören und gerät so immer verhängnisvoller in Partikularismen hinein, denen er zu
entgehen hoffte.
Der Ausweg aus der Partikularität des befangenen Daseins zum vollen Gegen-
über der Wirklichkeit führt in die völlig entgegengesetzte Richtung. Flaubert kenn-
zeichnet ihn mit der programmatischen Formel ne pas conclure. Er sagt negativ:
LHneptie consiste ä vouloir conclure. (An Louise Bouilhet, 4. Sept. 1850.) Die Forde-
rung des Verzichtes auf jede Form des „Schließens" stellt den Menschen um der un-
verfälschten und unverkürzten Wirklichkeit und damit um seiner selbst willen vor
die schwerste Aufgabe. Sie mutet ihm zu, die Welt mit dem Auge Gottes zu betrach-
ten, eines Gottes freilich, der nicht dogmatisch eingeengt und verzerrt ist, den mensch-
liche Stupidität nicht mit „Attributen dekoriert" hat (Anhang zu den Notes de Vo-
yage, Edition Conard, II, 358). Der Mensch soll von den Ansprüchen seiner Subjek-
tivität her gesehen eine Art Nullpunkt-Existenz führen. Das ist nun gerade die Exi-
stenzweise des Künstlers. Nur wenn und soweit Kunst möglich ist, vermag der
Mensch der Wirklichkeit gerecht zu werden. Kunst ist wesentlich Gerechtigkeit
gegenüber dem Ganzen des Daseins. Sie ist überdies die einzige Weise möglicher
Gerechtigkeit.
x) Eine eingehende Untersuchung des geschichtsphilosophischen Gehalts der
Anschauungen Flauberts wäre dringend erwünscht.
93
man es versäumt, die ihnen innerlich zugehörigen Maßstäbe und Anschauungsformen
herauszufinden.
Man muß, so fordert Binswanger, zu erfahren trachten, was jenes Werk im
Grunde zu leisten, welche Aufgabe es zu bewältigen beabsichtigt. Flaubert selbst
bietet Handhaben zu dieser Erörterung. Freilich ist es ihm nicht beschieden gewesen,
sein Vorhaben einer zusammenhängenden Behandlung der ästhetischen Grundfragen
durchzuführen. Aber die Correspondance bietet Ansatzpunkte genug, um seinen Inten-
tionen auf die Spur zu kommen und so auf eigene Faust seinen Plan nachträglich zu
verwirklichen.
Was bedeuten ernst genommen Kunst und Künstler? Welche Verantwortung tra-
gen sie im Gesamthaushalt menschlichen Lebens? Welche Bedingungen müssen er-
füllt sein, damit sie ins Dasein treten können? Indem Binswanger so fragt, verpflichtet
er sich dazu, bei allen Stellen der Correspondance, die er heranzieht, stets auf den
äußersten Begriff von Kunst (sagen wir mit Flaubert von art pur) und allem,
was damit zusammenhängt, erpicht zu sein.
Bei Flaubert hat die ästhetische Problematik eine ganz bestimmte Auffassung von
der geistigen Struktur seiner Zeit und ihrer Funktion im Ablauf der Gesamtgeschichte
als sachlichen Grund1). Die Menschen sind längst nicht mehr naiv mit der Wirklich-
keit verbunden. Sie haben auch den Rückhalt jedes echten religiösen oder politischen
Einverständnisses verloren, von dem aus die Wirklichkeit als Ganzes Bestand und in
ihren Einzelerscheinungen Halt hätte. Jetzt nach dem Einsturz der bases theologiques
irrt der Blick des Menschen über den entfesselten Andrang zusammenhangloser Ein-
zeldinge. „Damit ist ihm das Gegenüber der Welt — eben die Wirklichkeit-außen
— genommen, vor der er selbst als wirklich, in dem, was er i s t, sich sehen und ver-
gewissern könnte" (40). In dieser Lage greift er zu einem unerlaubten und in die Irre
führenden Mittel. Er interpretiert als Wirklichkeit, was in den Umkreis seiner Emp-
findungen, Meinungen oder Interessen hineinfällt. Er glaubt, mit den Mitteln und folg-
lich im Bereich seiner zufälligen Subjektivität ein neues „Gegenüber" der Welt begrün-
den zu können, indem er den jeweils vor ihm auftauchenden Dingen Bedeutung und
Sinn andichtet. Solche Ahnungslosigkeit gegenüber dem Ganzen der Wirklichkeit
geißelt Flaubert als Stupidität, als betise humaine. Der Mensch läßt sich dogmatisch
betören und gerät so immer verhängnisvoller in Partikularismen hinein, denen er zu
entgehen hoffte.
Der Ausweg aus der Partikularität des befangenen Daseins zum vollen Gegen-
über der Wirklichkeit führt in die völlig entgegengesetzte Richtung. Flaubert kenn-
zeichnet ihn mit der programmatischen Formel ne pas conclure. Er sagt negativ:
LHneptie consiste ä vouloir conclure. (An Louise Bouilhet, 4. Sept. 1850.) Die Forde-
rung des Verzichtes auf jede Form des „Schließens" stellt den Menschen um der un-
verfälschten und unverkürzten Wirklichkeit und damit um seiner selbst willen vor
die schwerste Aufgabe. Sie mutet ihm zu, die Welt mit dem Auge Gottes zu betrach-
ten, eines Gottes freilich, der nicht dogmatisch eingeengt und verzerrt ist, den mensch-
liche Stupidität nicht mit „Attributen dekoriert" hat (Anhang zu den Notes de Vo-
yage, Edition Conard, II, 358). Der Mensch soll von den Ansprüchen seiner Subjek-
tivität her gesehen eine Art Nullpunkt-Existenz führen. Das ist nun gerade die Exi-
stenzweise des Künstlers. Nur wenn und soweit Kunst möglich ist, vermag der
Mensch der Wirklichkeit gerecht zu werden. Kunst ist wesentlich Gerechtigkeit
gegenüber dem Ganzen des Daseins. Sie ist überdies die einzige Weise möglicher
Gerechtigkeit.
x) Eine eingehende Untersuchung des geschichtsphilosophischen Gehalts der
Anschauungen Flauberts wäre dringend erwünscht.