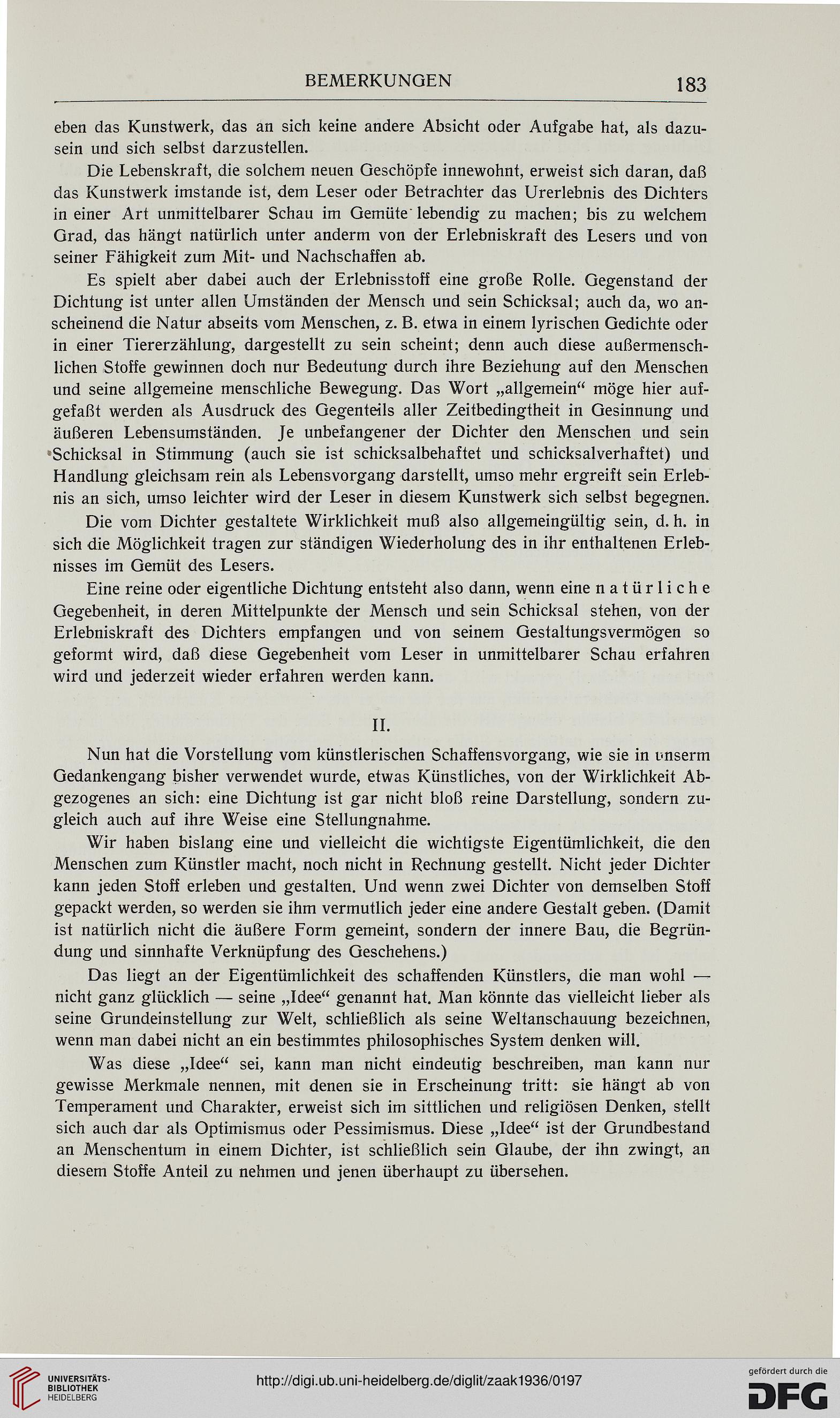BEMERKUNGEN
183
eben das Kunstwerk, das an sich keine andere Absicht oder Aufgabe hat, als dazu-
sein und sich selbst darzustellen.
Die Lebenskraft, die solchem neuen Geschöpfe innewohnt, erweist sich daran, daß
das Kunstwerk imstande ist, dem Leser oder Betrachter das Urerlebnis des Dichters
in einer Art unmittelbarer Schau im Gemüte lebendig zu machen; bis zu welchem
Grad, das hängt natürlich unter anderm von der Erlebniskraft des Lesers und von
seiner Fähigkeit zum Mit- und Nachschaffen ab.
Es spielt aber dabei auch der Erlebnisstoff eine große Rolle. Gegenstand der
Dichtung ist unter allen Umständen der Mensch und sein Schicksal; auch da, wo an-
scheinend die Natur abseits vom Menschen, z. B. etwa in einem lyrischen Gedichte oder
in einer Tiererzählung, dargestellt zu sein scheint; denn auch diese außermensch-
lichen Stoffe gewinnen doch nur Bedeutung durch ihre Beziehung auf den Menschen
und seine allgemeine menschliche Bewegung. Das Wort „allgemein" möge hier auf-
gefaßt werden als Ausdruck des Gegenteils aller Zeitbedingtheit in Gesinnung und
äußeren Lebensumständen. Je unbefangener der Dichter den Menschen und sein
;Schicksal in Stimmung (auch sie ist schicksalbehaftet und schicksalverhaftet) und
Handlung gleichsam rein als Lebensvorgang darstellt, umso mehr ergreift sein Erleb-
nis an sich, umso leichter wird der Leser in diesem Kunstwerk sich selbst begegnen.
Die vom Dichter gestaltete Wirklichkeit muß also allgemeingültig sein, d. h. in
sich die Möglichkeit tragen zur ständigen Wiederholung des in ihr enthaltenen Erleb-
nisses im Gemüt des Lesers.
Eine reine oder eigentliche Dichtung entsteht also dann, wenn eine natürliche
Gegebenheit, in deren Mittelpunkte der Mensch und sein Schicksal stehen, von der
Erlebniskraft des Dichters empfangen und von seinem Gestaltungsvermögen so
geformt wird, daß diese Gegebenheit vom Leser in unmittelbarer Schau erfahren
wird und jederzeit wieder erfahren werden kann.
II.
Nun hat die Vorstellung vom künstlerischen Schaffensvorgang, wie sie in unserm
Gedankengang bisher verwendet wurde, etwas Künstliches, von der Wirklichkeit Ab-
gezogenes an sich: eine Dichtung ist gar nicht bloß reine Darstellung, sondern zu-
gleich auch auf ihre Weise eine Stellungnahme.
Wir haben bislang eine und vielleicht die wichtigste Eigentümlichkeit, die den
Menschen zum Künstler macht, noch nicht in Rechnung gestellt. Nicht jeder Dichter
kann jeden Stoff erleben und gestalten. Und wenn zwei Dichter von demselben Stoff
gepackt werden, so werden sie ihm vermutlich jeder eine andere Gestalt geben. (Damit
ist natürlich nicht die äußere Form gemeint, sondern der innere Bau, die Begrün-
dung und sinnhafte Verknüpfung des Geschehens.)
Das liegt an der Eigentümlichkeit des schaffenden Künstlers, die man wohl —
nicht ganz glücklich — seine „Idee" genannt hat. Man könnte das vielleicht lieber als
seine Grundeinstellung zur Welt, schließlich als seine Weltanschauung bezeichnen,
wenn man dabei nicht an ein bestimmtes philosophisches System denken will.
Was diese „Idee" sei, kann man nicht eindeutig beschreiben, man kann nur
gewisse Merkmale nennen, mit denen sie in Erscheinung tritt: sie hängt ab von
Temperament und Charakter, erweist sich im sittlichen und religiösen Denken, stellt
sich auch dar als Optimismus oder Pessimismus. Diese „Idee" ist der Grundbestand
an Menschentum in einem Dichter, ist schließlich sein Glaube, der ihn zwingt, an
diesem Stoffe Anteil zu nehmen und jenen überhaupt zu übersehen.
183
eben das Kunstwerk, das an sich keine andere Absicht oder Aufgabe hat, als dazu-
sein und sich selbst darzustellen.
Die Lebenskraft, die solchem neuen Geschöpfe innewohnt, erweist sich daran, daß
das Kunstwerk imstande ist, dem Leser oder Betrachter das Urerlebnis des Dichters
in einer Art unmittelbarer Schau im Gemüte lebendig zu machen; bis zu welchem
Grad, das hängt natürlich unter anderm von der Erlebniskraft des Lesers und von
seiner Fähigkeit zum Mit- und Nachschaffen ab.
Es spielt aber dabei auch der Erlebnisstoff eine große Rolle. Gegenstand der
Dichtung ist unter allen Umständen der Mensch und sein Schicksal; auch da, wo an-
scheinend die Natur abseits vom Menschen, z. B. etwa in einem lyrischen Gedichte oder
in einer Tiererzählung, dargestellt zu sein scheint; denn auch diese außermensch-
lichen Stoffe gewinnen doch nur Bedeutung durch ihre Beziehung auf den Menschen
und seine allgemeine menschliche Bewegung. Das Wort „allgemein" möge hier auf-
gefaßt werden als Ausdruck des Gegenteils aller Zeitbedingtheit in Gesinnung und
äußeren Lebensumständen. Je unbefangener der Dichter den Menschen und sein
;Schicksal in Stimmung (auch sie ist schicksalbehaftet und schicksalverhaftet) und
Handlung gleichsam rein als Lebensvorgang darstellt, umso mehr ergreift sein Erleb-
nis an sich, umso leichter wird der Leser in diesem Kunstwerk sich selbst begegnen.
Die vom Dichter gestaltete Wirklichkeit muß also allgemeingültig sein, d. h. in
sich die Möglichkeit tragen zur ständigen Wiederholung des in ihr enthaltenen Erleb-
nisses im Gemüt des Lesers.
Eine reine oder eigentliche Dichtung entsteht also dann, wenn eine natürliche
Gegebenheit, in deren Mittelpunkte der Mensch und sein Schicksal stehen, von der
Erlebniskraft des Dichters empfangen und von seinem Gestaltungsvermögen so
geformt wird, daß diese Gegebenheit vom Leser in unmittelbarer Schau erfahren
wird und jederzeit wieder erfahren werden kann.
II.
Nun hat die Vorstellung vom künstlerischen Schaffensvorgang, wie sie in unserm
Gedankengang bisher verwendet wurde, etwas Künstliches, von der Wirklichkeit Ab-
gezogenes an sich: eine Dichtung ist gar nicht bloß reine Darstellung, sondern zu-
gleich auch auf ihre Weise eine Stellungnahme.
Wir haben bislang eine und vielleicht die wichtigste Eigentümlichkeit, die den
Menschen zum Künstler macht, noch nicht in Rechnung gestellt. Nicht jeder Dichter
kann jeden Stoff erleben und gestalten. Und wenn zwei Dichter von demselben Stoff
gepackt werden, so werden sie ihm vermutlich jeder eine andere Gestalt geben. (Damit
ist natürlich nicht die äußere Form gemeint, sondern der innere Bau, die Begrün-
dung und sinnhafte Verknüpfung des Geschehens.)
Das liegt an der Eigentümlichkeit des schaffenden Künstlers, die man wohl —
nicht ganz glücklich — seine „Idee" genannt hat. Man könnte das vielleicht lieber als
seine Grundeinstellung zur Welt, schließlich als seine Weltanschauung bezeichnen,
wenn man dabei nicht an ein bestimmtes philosophisches System denken will.
Was diese „Idee" sei, kann man nicht eindeutig beschreiben, man kann nur
gewisse Merkmale nennen, mit denen sie in Erscheinung tritt: sie hängt ab von
Temperament und Charakter, erweist sich im sittlichen und religiösen Denken, stellt
sich auch dar als Optimismus oder Pessimismus. Diese „Idee" ist der Grundbestand
an Menschentum in einem Dichter, ist schließlich sein Glaube, der ihn zwingt, an
diesem Stoffe Anteil zu nehmen und jenen überhaupt zu übersehen.