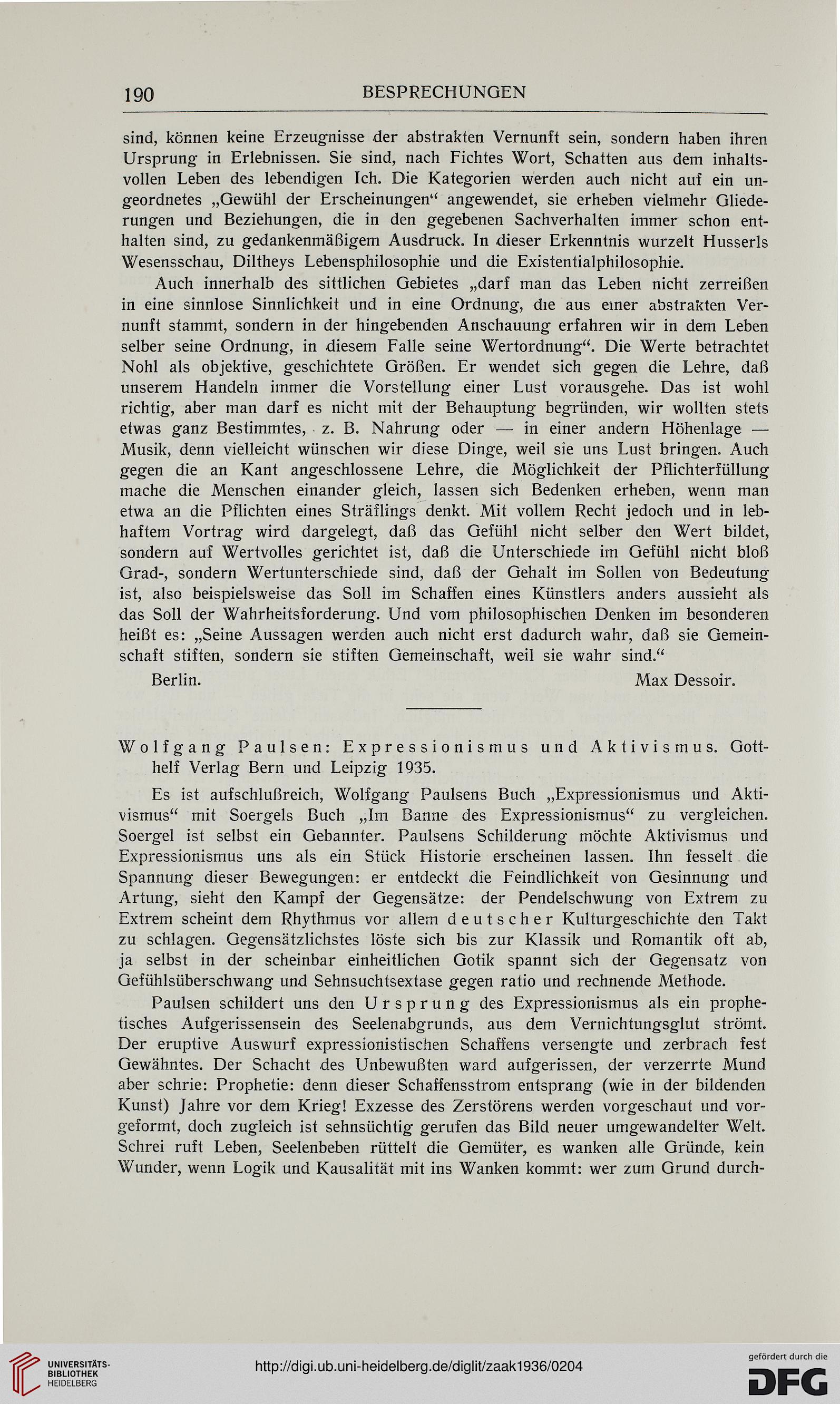190
sind, können keine Erzeugnisse der abstrakten Vernunft sein, sondern haben ihren
Ursprung in Erlebnissen. Sie sind, nach Fichtes Wort, Schatten aus dem inhalts-
vollen Leben des lebendigen Ich. Die Kategorien werden auch nicht auf ein un-
geordnetes „Gewühl der Erscheinungen" angewendet, sie erheben vielmehr Gliede-
rungen und Beziehungen, die in den gegebenen Sachverhalten immer schon ent-
halten sind, zu gedankenmäßigem Ausdruck. In dieser Erkenntnis wurzelt Husserls
Wesensschau, Diltheys Lebensphilosophie und die Existentialphilosophie.
Auch innerhalb des sittlichen Gebietes „darf man das Leben nicht zerreißen
in eine sinnlose Sinnlichkeit und in eine Ordnung, die aus einer abstrakten Ver-
nunft stammt, sondern in der hingebenden Anschauung erfahren wir in dem Leben
selber seine Ordnung, in diesem Falle seine Wertordnung". Die Werte betrachtet
Nohl als objektive, geschichtete Größen. Er wendet sich gegen die Lehre, daß
unserem Handeln immer die Vorstellung einer Lust vorausgehe. Das ist wohl
richtig, aber man darf es nicht mit der Behauptung begründen, wir wollten stets
etwas ganz Bestimmtes, z. B. Nahrung oder — in einer andern Höhenlage —
Musik, denn vielleicht wünschen wir diese Dinge, weil sie uns Lust bringen. Auch
gegen die an Kant angeschlossene Lehre, die Möglichkeit der Pflichterfüllung
mache die Menschen einander gleich, lassen sich Bedenken erheben, wenn man
etwa an die Pflichten eines Sträflings denkt. Mit vollem Recht jedoch und in leb-
haftem Vortrag wird dargelegt, daß das Gefühl nicht selber den Wert bildet,
sondern auf Wertvolles gerichtet ist, daß die Unterschiede im Gefühl nicht bloß
Grad-, sondern Wertunterschiede sind, daß der Gehalt im Sollen von Bedeutung
ist, also beispielsweise das Soll im Schaffen eines Künstlers anders aussieht als
das Soll der Wahrheitsforderung. Und vom philosophischen Denken im besonderen
heißt es: „Seine Aussagen werden auch nicht erst dadurch wahr, daß sie Gemein-
schaft stiften, sondern sie stiften Gemeinschaft, weil sie wahr sind."
Berlin. Max Dessoir.
Wolfgang Paulsen: Expressionismus und Aktivismus. Gott-
helf Verlag Bern und Leipzig 1935.
Es ist aufschlußreich, Wolfgang Paulsens Buch „Expressionismus und Akti-
vismus" mit Soergels Buch „Im Banne des Expressionismus" zu vergleichen.
Soergel ist selbst ein Gebannter. Paulsens Schilderung möchte Aktivismus und
Expressionismus uns als ein Stück Historie erscheinen lassen. Ihn fesselt die
Spannung dieser Bewegungen: er entdeckt die Feindlichkeit von Gesinnung und
Artung, sieht den Kampf der Gegensätze: der Pendelschwung von Extrem zu
Extrem scheint dem Rhythmus vor allem deutscher Kulturgeschichte den Takt
zu schlagen. Gegensätzlichstes löste sich bis zur Klassik und Romantik oft ab,
ja selbst in der scheinbar einheitlichen Gotik spannt sich der Gegensatz von
Gefühlsüberschwang und Sehnsuchtsextase gegen ratio und rechnende Methode.
Paulsen schildert uns den Ursprung des Expressionismus als ein prophe-
tisches Aufgerissensein des Seelenabgrunds, aus dem Vernichtungsglut strömt.
Der eruptive Auswurf expressionistischen Schaffens versengte und zerbrach fest
Gewähntes. Der Schacht des Unbewußten ward aufgerissen, der verzerrte Mund
aber schrie: Prophetie: denn dieser Schaffensstrom entsprang (wie in der bildenden
Kunst) Jahre vor dem Krieg! Exzesse des Zerstörens werden vorgeschaut und vor-
geformt, doch zugleich ist sehnsüchtig gerufen das Bild neuer umgewandelter Welt.
Schrei ruft Leben, Seelenbeben rüttelt die Gemüter, es wanken alle Gründe, kein
Wunder, wenn Logik und Kausalität mit ins Wanken kommt: wer zum Grund durch-
sind, können keine Erzeugnisse der abstrakten Vernunft sein, sondern haben ihren
Ursprung in Erlebnissen. Sie sind, nach Fichtes Wort, Schatten aus dem inhalts-
vollen Leben des lebendigen Ich. Die Kategorien werden auch nicht auf ein un-
geordnetes „Gewühl der Erscheinungen" angewendet, sie erheben vielmehr Gliede-
rungen und Beziehungen, die in den gegebenen Sachverhalten immer schon ent-
halten sind, zu gedankenmäßigem Ausdruck. In dieser Erkenntnis wurzelt Husserls
Wesensschau, Diltheys Lebensphilosophie und die Existentialphilosophie.
Auch innerhalb des sittlichen Gebietes „darf man das Leben nicht zerreißen
in eine sinnlose Sinnlichkeit und in eine Ordnung, die aus einer abstrakten Ver-
nunft stammt, sondern in der hingebenden Anschauung erfahren wir in dem Leben
selber seine Ordnung, in diesem Falle seine Wertordnung". Die Werte betrachtet
Nohl als objektive, geschichtete Größen. Er wendet sich gegen die Lehre, daß
unserem Handeln immer die Vorstellung einer Lust vorausgehe. Das ist wohl
richtig, aber man darf es nicht mit der Behauptung begründen, wir wollten stets
etwas ganz Bestimmtes, z. B. Nahrung oder — in einer andern Höhenlage —
Musik, denn vielleicht wünschen wir diese Dinge, weil sie uns Lust bringen. Auch
gegen die an Kant angeschlossene Lehre, die Möglichkeit der Pflichterfüllung
mache die Menschen einander gleich, lassen sich Bedenken erheben, wenn man
etwa an die Pflichten eines Sträflings denkt. Mit vollem Recht jedoch und in leb-
haftem Vortrag wird dargelegt, daß das Gefühl nicht selber den Wert bildet,
sondern auf Wertvolles gerichtet ist, daß die Unterschiede im Gefühl nicht bloß
Grad-, sondern Wertunterschiede sind, daß der Gehalt im Sollen von Bedeutung
ist, also beispielsweise das Soll im Schaffen eines Künstlers anders aussieht als
das Soll der Wahrheitsforderung. Und vom philosophischen Denken im besonderen
heißt es: „Seine Aussagen werden auch nicht erst dadurch wahr, daß sie Gemein-
schaft stiften, sondern sie stiften Gemeinschaft, weil sie wahr sind."
Berlin. Max Dessoir.
Wolfgang Paulsen: Expressionismus und Aktivismus. Gott-
helf Verlag Bern und Leipzig 1935.
Es ist aufschlußreich, Wolfgang Paulsens Buch „Expressionismus und Akti-
vismus" mit Soergels Buch „Im Banne des Expressionismus" zu vergleichen.
Soergel ist selbst ein Gebannter. Paulsens Schilderung möchte Aktivismus und
Expressionismus uns als ein Stück Historie erscheinen lassen. Ihn fesselt die
Spannung dieser Bewegungen: er entdeckt die Feindlichkeit von Gesinnung und
Artung, sieht den Kampf der Gegensätze: der Pendelschwung von Extrem zu
Extrem scheint dem Rhythmus vor allem deutscher Kulturgeschichte den Takt
zu schlagen. Gegensätzlichstes löste sich bis zur Klassik und Romantik oft ab,
ja selbst in der scheinbar einheitlichen Gotik spannt sich der Gegensatz von
Gefühlsüberschwang und Sehnsuchtsextase gegen ratio und rechnende Methode.
Paulsen schildert uns den Ursprung des Expressionismus als ein prophe-
tisches Aufgerissensein des Seelenabgrunds, aus dem Vernichtungsglut strömt.
Der eruptive Auswurf expressionistischen Schaffens versengte und zerbrach fest
Gewähntes. Der Schacht des Unbewußten ward aufgerissen, der verzerrte Mund
aber schrie: Prophetie: denn dieser Schaffensstrom entsprang (wie in der bildenden
Kunst) Jahre vor dem Krieg! Exzesse des Zerstörens werden vorgeschaut und vor-
geformt, doch zugleich ist sehnsüchtig gerufen das Bild neuer umgewandelter Welt.
Schrei ruft Leben, Seelenbeben rüttelt die Gemüter, es wanken alle Gründe, kein
Wunder, wenn Logik und Kausalität mit ins Wanken kommt: wer zum Grund durch-