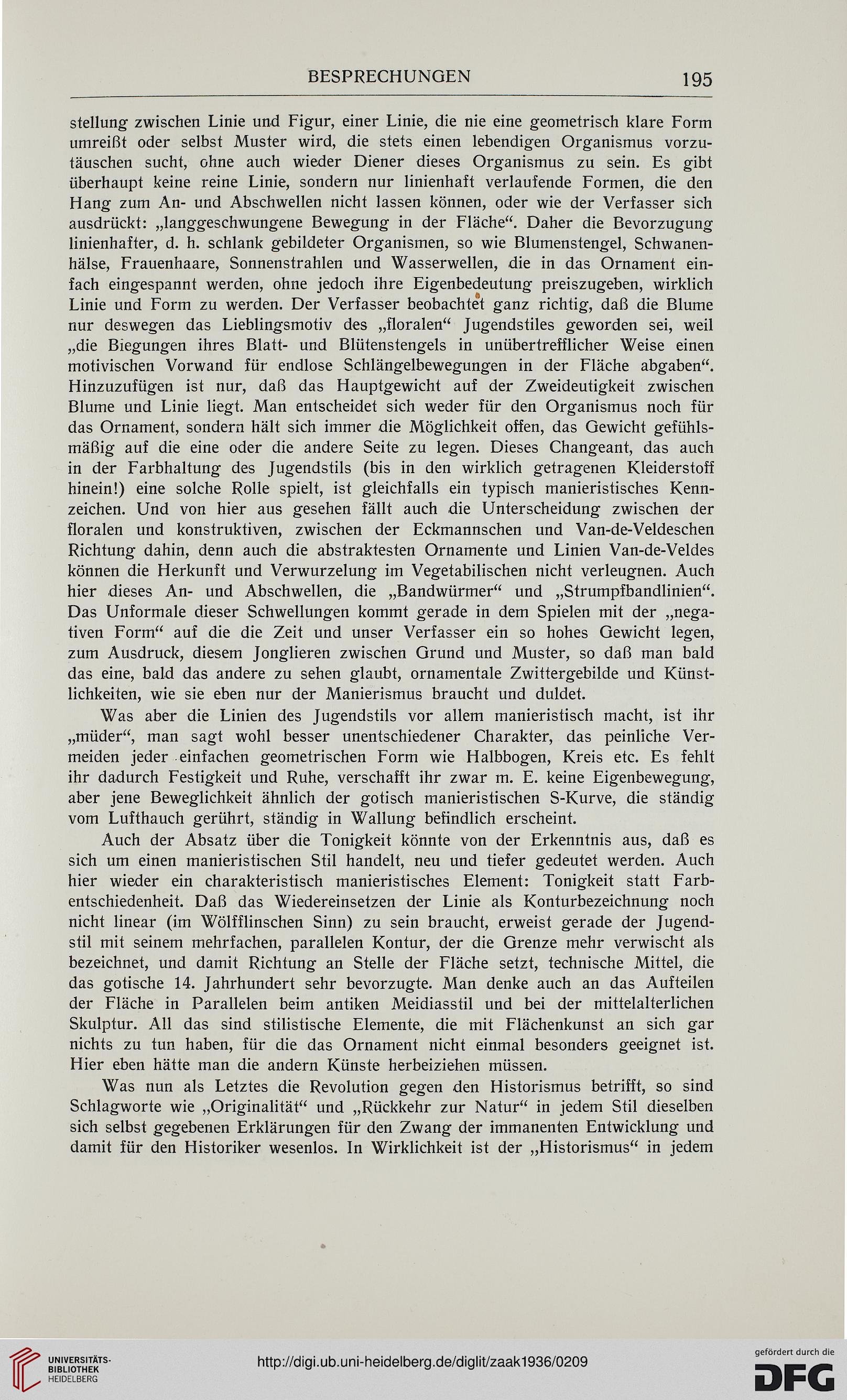BESPRECHUNGEN
195
Stellung zwischen Linie und Figur, einer Linie, die nie eine geometrisch klare Form
umreißt oder selbst Muster wird, die stets einen lebendigen Organismus vorzu-
täuschen sucht, ohne auch wieder Diener dieses Organismus zu sein. Es gibt
überhaupt keine reine Linie, sondern nur linienhaft verlaufende Formen, die den
Hang zum An- und Abschwellen nicht lassen können, oder wie der Verfasser sich
ausdrückt: „langgeschwungene Bewegung in der Fläche". Daher die Bevorzugung
linienhafter, d. h. schlank gebildeter Organismen, so wie Blumenstengel, Schwanen-
hälse, Frauenhaare, Sonnenstrahlen und Wasserwellen, die in das Ornament ein-
fach eingespannt werden, ohne jedoch ihre Eigenbedeutung preiszugeben, wirklich
Linie und Form zu werden. Der Verfasser beobachtet ganz richtig, daß die Blume
nur deswegen das Lieblingsmotiv des „floralen" Jugendstiles geworden sei, weil
„die Biegungen ihres Blatt- und Blütenstengels in unübertrefflicher Weise einen
motivischen Vorwand für endlose Schlängelbewegungen in der Fläche abgaben".
Hinzuzufügen ist nur, daß das Hauptgewicht auf der Zweideutigkeit zwischen
Blume und Linie liegt. Man entscheidet sich weder für den Organismus noch für
das Ornament, sondern hält sich immer die Möglichkeit offen, das Gewicht gefühls-
mäßig auf die eine oder die andere Seite zu legen. Dieses Changeant, das auch
in der Farbhaltung des Jugendstils (bis in den wirklich getragenen Kleiderstoff
hinein!) eine solche Rolle spielt, ist gleichfalls ein typisch manieristisches Kenn-
zeichen. Und von hier aus gesehen fällt auch die Unterscheidung zwischen der
floralen und konstruktiven, zwischen der Eckmannschen und Van-de-Veldeschen
Richtung dahin, denn auch die abstraktesten Ornamente und Linien Van-de-Veldes
können die Herkunft und Verwurzelung im Vegetabilischen nicht verleugnen. Auch
hier dieses An- und Abschwellen, die „Bandwürmer" und „Strumpfbandlinien".
Das Unformale dieser Schwellungen kommt gerade in dem Spielen mit der „nega-
tiven Form" auf die die Zeit und unser Verfasser ein so hohes Gewicht legen,
zum Ausdruck, diesem Jonglieren zwischen Grund und Muster, so daß man bald
das eine, bald das andere zu sehen glaubt, ornamentale Zwittergebilde und Künst-
lichkeiten, wie sie eben nur der Manierismus braucht und duldet.
Was aber die Linien des Jugendstils vor allem manieristisch macht, ist ihr
„müder", man sagt wohl besser unentschiedener Charakter, das peinliche Ver-
meiden jeder einfachen geometrischen Form wie Halbbogen, Kreis etc. Es fehlt
ihr dadurch Festigkeit und Ruhe, verschafft ihr zwar m. E. keine Eigenbewegung,
aber jene Beweglichkeit ähnlich der gotisch manieristischen S-Kurve, die ständig
vom Lufthauch gerührt, ständig in Wallung befindlich erscheint.
Auch der Absatz über die Tonigkeit könnte von der Erkenntnis aus, daß es
sich um einen manieristischen Stil handelt, neu und tiefer gedeutet werden. Auch
hier wieder ein charakteristisch manieristisches Element: Tonigkeit statt Farb-
entschiedenheit. Daß das Wiedereinsetzen der Linie als Konturbezeichnung noch
nicht linear (im Wölfflinschen Sinn) zu sein braucht, erweist gerade der Jugend-
stil mit seinem mehrfachen, parallelen Kontur, der die Grenze mehr verwischt als
bezeichnet, und damit Richtung an Stelle der Fläche setzt, technische Mittel, die
das gotische 14. Jahrhundert sehr bevorzugte. Man denke auch an das Aufteilen
der Fläche in Parallelen beim antiken Meidiasstil und bei der mittelalterlichen
Skulptur. All das sind stilistische Elemente, die mit Flächenkunst an sich gar
nichts zu tun haben, für die das Ornament nicht einmal besonders geeignet ist.
Hier eben hätte man die andern Künste herbeiziehen müssen.
Was nun als Letztes die Revolution gegen den Historismus betrifft, so sind
Schlagworte wie „Originalität" und „Rückkehr zur Natur" in jedem Stil dieselben
sich selbst gegebenen Erklärungen für den Zwang der immanenten Entwicklung und
damit für den Historiker wesenlos. In Wirklichkeit ist der „Historismus" in jedem
195
Stellung zwischen Linie und Figur, einer Linie, die nie eine geometrisch klare Form
umreißt oder selbst Muster wird, die stets einen lebendigen Organismus vorzu-
täuschen sucht, ohne auch wieder Diener dieses Organismus zu sein. Es gibt
überhaupt keine reine Linie, sondern nur linienhaft verlaufende Formen, die den
Hang zum An- und Abschwellen nicht lassen können, oder wie der Verfasser sich
ausdrückt: „langgeschwungene Bewegung in der Fläche". Daher die Bevorzugung
linienhafter, d. h. schlank gebildeter Organismen, so wie Blumenstengel, Schwanen-
hälse, Frauenhaare, Sonnenstrahlen und Wasserwellen, die in das Ornament ein-
fach eingespannt werden, ohne jedoch ihre Eigenbedeutung preiszugeben, wirklich
Linie und Form zu werden. Der Verfasser beobachtet ganz richtig, daß die Blume
nur deswegen das Lieblingsmotiv des „floralen" Jugendstiles geworden sei, weil
„die Biegungen ihres Blatt- und Blütenstengels in unübertrefflicher Weise einen
motivischen Vorwand für endlose Schlängelbewegungen in der Fläche abgaben".
Hinzuzufügen ist nur, daß das Hauptgewicht auf der Zweideutigkeit zwischen
Blume und Linie liegt. Man entscheidet sich weder für den Organismus noch für
das Ornament, sondern hält sich immer die Möglichkeit offen, das Gewicht gefühls-
mäßig auf die eine oder die andere Seite zu legen. Dieses Changeant, das auch
in der Farbhaltung des Jugendstils (bis in den wirklich getragenen Kleiderstoff
hinein!) eine solche Rolle spielt, ist gleichfalls ein typisch manieristisches Kenn-
zeichen. Und von hier aus gesehen fällt auch die Unterscheidung zwischen der
floralen und konstruktiven, zwischen der Eckmannschen und Van-de-Veldeschen
Richtung dahin, denn auch die abstraktesten Ornamente und Linien Van-de-Veldes
können die Herkunft und Verwurzelung im Vegetabilischen nicht verleugnen. Auch
hier dieses An- und Abschwellen, die „Bandwürmer" und „Strumpfbandlinien".
Das Unformale dieser Schwellungen kommt gerade in dem Spielen mit der „nega-
tiven Form" auf die die Zeit und unser Verfasser ein so hohes Gewicht legen,
zum Ausdruck, diesem Jonglieren zwischen Grund und Muster, so daß man bald
das eine, bald das andere zu sehen glaubt, ornamentale Zwittergebilde und Künst-
lichkeiten, wie sie eben nur der Manierismus braucht und duldet.
Was aber die Linien des Jugendstils vor allem manieristisch macht, ist ihr
„müder", man sagt wohl besser unentschiedener Charakter, das peinliche Ver-
meiden jeder einfachen geometrischen Form wie Halbbogen, Kreis etc. Es fehlt
ihr dadurch Festigkeit und Ruhe, verschafft ihr zwar m. E. keine Eigenbewegung,
aber jene Beweglichkeit ähnlich der gotisch manieristischen S-Kurve, die ständig
vom Lufthauch gerührt, ständig in Wallung befindlich erscheint.
Auch der Absatz über die Tonigkeit könnte von der Erkenntnis aus, daß es
sich um einen manieristischen Stil handelt, neu und tiefer gedeutet werden. Auch
hier wieder ein charakteristisch manieristisches Element: Tonigkeit statt Farb-
entschiedenheit. Daß das Wiedereinsetzen der Linie als Konturbezeichnung noch
nicht linear (im Wölfflinschen Sinn) zu sein braucht, erweist gerade der Jugend-
stil mit seinem mehrfachen, parallelen Kontur, der die Grenze mehr verwischt als
bezeichnet, und damit Richtung an Stelle der Fläche setzt, technische Mittel, die
das gotische 14. Jahrhundert sehr bevorzugte. Man denke auch an das Aufteilen
der Fläche in Parallelen beim antiken Meidiasstil und bei der mittelalterlichen
Skulptur. All das sind stilistische Elemente, die mit Flächenkunst an sich gar
nichts zu tun haben, für die das Ornament nicht einmal besonders geeignet ist.
Hier eben hätte man die andern Künste herbeiziehen müssen.
Was nun als Letztes die Revolution gegen den Historismus betrifft, so sind
Schlagworte wie „Originalität" und „Rückkehr zur Natur" in jedem Stil dieselben
sich selbst gegebenen Erklärungen für den Zwang der immanenten Entwicklung und
damit für den Historiker wesenlos. In Wirklichkeit ist der „Historismus" in jedem