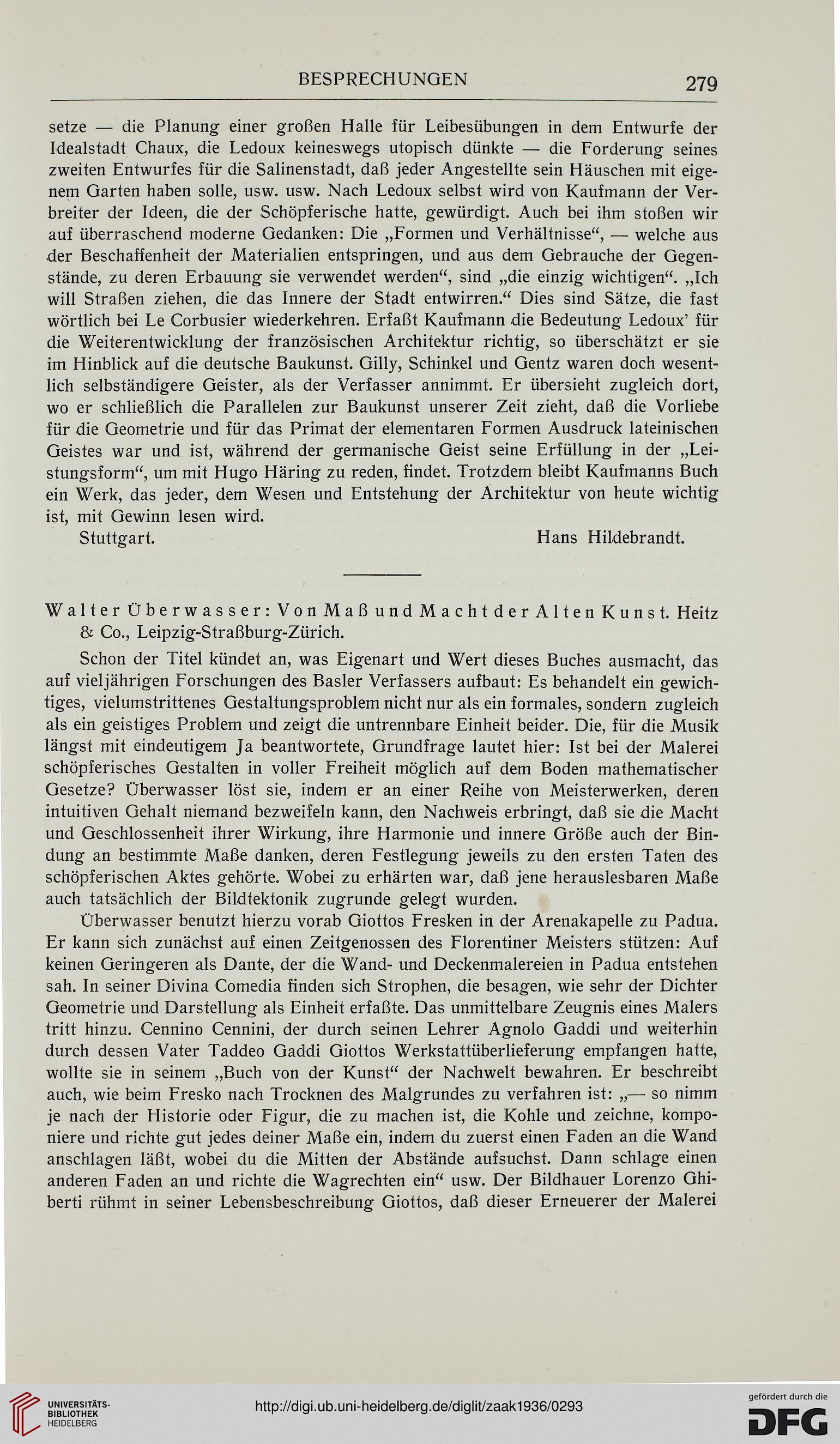setze — die Planung einer großen Halle für Leibesübungen in dem Entwürfe der
Idealstadt Chaux, die Ledoux keineswegs utopisch dünkte — die Forderung seines
zweiten Entwurfes für die Salinenstadt, daß jeder Angestellte sein Häuschen mit eige-
nem Garten haben solle, usw. usw. Nach Ledoux selbst wird von Kaufmann der Ver-
breiter der Ideen, die der Schöpferische hatte, gewürdigt. Auch bei ihm stoßen wir
auf überraschend moderne Gedanken: Die „Formen und Verhältnisse", — welche aus
der Beschaffenheit der Materialien entspringen, und aus dem Gebrauche der Gegen-
stände, zu deren Erbauung sie verwendet werden", sind „die einzig wichtigen". „Ich
will Straßen ziehen, die das Innere der Stadt entwirren." Dies sind Sätze, die fast
wörtlich bei Le Corbusier wiederkehren. Erfaßt Kaufmann die Bedeutung Ledoux' für
die Weiterentwicklung der französischen Architektur richtig, so überschätzt er sie
im Hinblick auf die deutsche Baukunst. Gilly, Schinkel und Gentz waren doch wesent-
lich selbständigere Geister, als der Verfasser annimmt. Er übersieht zugleich dort,
wo er schließlich die Parallelen zur Baukunst unserer Zeit zieht, daß die Vorliebe
für die Geometrie und für das Primat der elementaren Formen Ausdruck lateinischen
Geistes war und ist, während der germanische Geist seine Erfüllung in der „Lei-
stungsform", um mit Hugo Häring zu reden, findet. Trotzdem bleibt Kaufmanns Buch
ein Werk, das jeder, dem Wesen und Entstehung der Architektur von heute wichtig
ist, mit Gewinn lesen wird.
Stuttgart. Hans Hildebrandt.
Walter Überwasser: VonMaß undMachtder Alten Kunst. Heitz
& Co., Leipzig-Straßburg-Zürich.
Schon der Titel kündet an, was Eigenart und Wert dieses Buches ausmacht, das
auf vieljährigen Forschungen des Basler Verfassers aufbaut: Es behandelt ein gewich-
tiges, vielumstrittenes Gestaltungsproblem nicht nur als ein formales, sondern zugleich
als ein geistiges Problem und zeigt die untrennbare Einheit beider. Die, für die Musik
längst mit eindeutigem Ja beantwortete, Grundfrage lautet hier: Ist bei der Malerei
schöpferisches Gestalten in voller Freiheit möglich auf dem Boden mathematischer
Gesetze? Überwasser löst sie, indem er an einer Reihe von Meisterwerken, deren
intuitiven Gehalt niemand bezweifeln kann, den Nachweis erbringt, daß sie die Macht
und Geschlossenheit ihrer Wirkung, ihre Harmonie und innere Größe auch der Bin-
dung an bestimmte Maße danken, deren Festlegung jeweils zu den ersten Taten des
schöpferischen Aktes gehörte. Wobei zu erhärten war, daß jene herauslesbaren Maße
auch tatsächlich der Bildtektonik zugrunde gelegt wurden.
Überwasser benutzt hierzu vorab Giottos Fresken in der Arenakapelle zu Padua.
Er kann sich zunächst auf einen Zeitgenossen des Florentiner Meisters stützen: Auf
keinen Geringeren als Dante, der die Wand- und Deckenmalereien in Padua entstehen
sah. In seiner Divina Comedia finden sich Strophen, die besagen, wie sehr der Dichter
Geometrie und Darstellung als Einheit erfaßte. Das unmittelbare Zeugnis eines Malers
tritt hinzu. Cennino Cennini, der durch seinen Lehrer Agnolo Gaddi und weiterhin
durch dessen Vater Taddeo Gaddi Giottos Werkstattüberlieferung empfangen hatte,
wollte sie in seinem „Buch von der Kunst" der Nachwelt bewahren. Er beschreibt
auch, wie beim Fresko nach Trocknen des Malgrundes zu verfahren ist: „— so nimm
je nach der Historie oder Figur, die zu machen ist, die Kohle und zeichne, kompo-
niere und richte gut jedes deiner Maße ein, indem du zuerst einen Faden an die Wand
anschlagen läßt, wobei du die Mitten der Abstände aufsuchst. Dann schlage einen
anderen Faden an und richte die Wagrechten ein" usw. Der Bildhauer Lorenzo Ghi-
berti rühmt in seiner Lebensbeschreibung Giottos, daß dieser Erneuerer der Malerei
Idealstadt Chaux, die Ledoux keineswegs utopisch dünkte — die Forderung seines
zweiten Entwurfes für die Salinenstadt, daß jeder Angestellte sein Häuschen mit eige-
nem Garten haben solle, usw. usw. Nach Ledoux selbst wird von Kaufmann der Ver-
breiter der Ideen, die der Schöpferische hatte, gewürdigt. Auch bei ihm stoßen wir
auf überraschend moderne Gedanken: Die „Formen und Verhältnisse", — welche aus
der Beschaffenheit der Materialien entspringen, und aus dem Gebrauche der Gegen-
stände, zu deren Erbauung sie verwendet werden", sind „die einzig wichtigen". „Ich
will Straßen ziehen, die das Innere der Stadt entwirren." Dies sind Sätze, die fast
wörtlich bei Le Corbusier wiederkehren. Erfaßt Kaufmann die Bedeutung Ledoux' für
die Weiterentwicklung der französischen Architektur richtig, so überschätzt er sie
im Hinblick auf die deutsche Baukunst. Gilly, Schinkel und Gentz waren doch wesent-
lich selbständigere Geister, als der Verfasser annimmt. Er übersieht zugleich dort,
wo er schließlich die Parallelen zur Baukunst unserer Zeit zieht, daß die Vorliebe
für die Geometrie und für das Primat der elementaren Formen Ausdruck lateinischen
Geistes war und ist, während der germanische Geist seine Erfüllung in der „Lei-
stungsform", um mit Hugo Häring zu reden, findet. Trotzdem bleibt Kaufmanns Buch
ein Werk, das jeder, dem Wesen und Entstehung der Architektur von heute wichtig
ist, mit Gewinn lesen wird.
Stuttgart. Hans Hildebrandt.
Walter Überwasser: VonMaß undMachtder Alten Kunst. Heitz
& Co., Leipzig-Straßburg-Zürich.
Schon der Titel kündet an, was Eigenart und Wert dieses Buches ausmacht, das
auf vieljährigen Forschungen des Basler Verfassers aufbaut: Es behandelt ein gewich-
tiges, vielumstrittenes Gestaltungsproblem nicht nur als ein formales, sondern zugleich
als ein geistiges Problem und zeigt die untrennbare Einheit beider. Die, für die Musik
längst mit eindeutigem Ja beantwortete, Grundfrage lautet hier: Ist bei der Malerei
schöpferisches Gestalten in voller Freiheit möglich auf dem Boden mathematischer
Gesetze? Überwasser löst sie, indem er an einer Reihe von Meisterwerken, deren
intuitiven Gehalt niemand bezweifeln kann, den Nachweis erbringt, daß sie die Macht
und Geschlossenheit ihrer Wirkung, ihre Harmonie und innere Größe auch der Bin-
dung an bestimmte Maße danken, deren Festlegung jeweils zu den ersten Taten des
schöpferischen Aktes gehörte. Wobei zu erhärten war, daß jene herauslesbaren Maße
auch tatsächlich der Bildtektonik zugrunde gelegt wurden.
Überwasser benutzt hierzu vorab Giottos Fresken in der Arenakapelle zu Padua.
Er kann sich zunächst auf einen Zeitgenossen des Florentiner Meisters stützen: Auf
keinen Geringeren als Dante, der die Wand- und Deckenmalereien in Padua entstehen
sah. In seiner Divina Comedia finden sich Strophen, die besagen, wie sehr der Dichter
Geometrie und Darstellung als Einheit erfaßte. Das unmittelbare Zeugnis eines Malers
tritt hinzu. Cennino Cennini, der durch seinen Lehrer Agnolo Gaddi und weiterhin
durch dessen Vater Taddeo Gaddi Giottos Werkstattüberlieferung empfangen hatte,
wollte sie in seinem „Buch von der Kunst" der Nachwelt bewahren. Er beschreibt
auch, wie beim Fresko nach Trocknen des Malgrundes zu verfahren ist: „— so nimm
je nach der Historie oder Figur, die zu machen ist, die Kohle und zeichne, kompo-
niere und richte gut jedes deiner Maße ein, indem du zuerst einen Faden an die Wand
anschlagen läßt, wobei du die Mitten der Abstände aufsuchst. Dann schlage einen
anderen Faden an und richte die Wagrechten ein" usw. Der Bildhauer Lorenzo Ghi-
berti rühmt in seiner Lebensbeschreibung Giottos, daß dieser Erneuerer der Malerei