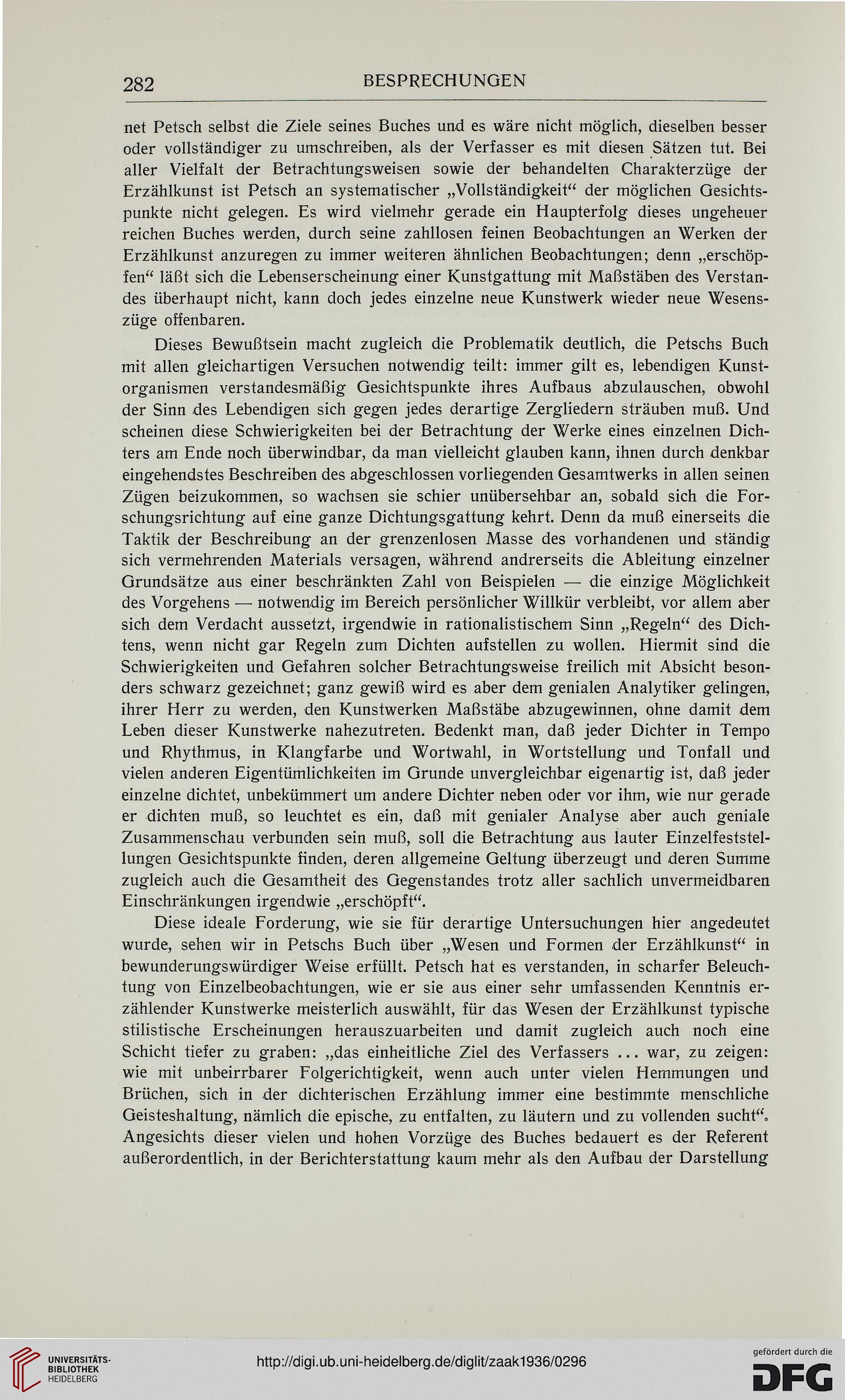net Petsch selbst die Ziele seines Buches und es wäre nicht möglich, dieselben besser
oder vollständiger zu umschreiben, als der Verfasser es mit diesen Sätzen tut. Bei
aller Vielfalt der Betrachtungsweisen sowie der behandelten Charakterzüge der
Erzählkunst ist Petsch an systematischer „Vollständigkeit" der möglichen Gesichts-
punkte nicht gelegen. Es wird vielmehr gerade ein Haupterfolg dieses ungeheuer
reichen Buches werden, durch seine zahllosen feinen Beobachtungen an Werken der
Erzählkunst anzuregen zu immer weiteren ähnlichen Beobachtungen; denn „erschöp-
fen" läßt sich die Lebenserscheinung einer Kunstgattung mit Maßstäben des Verstan-
des überhaupt nicht, kann doch jedes einzelne neue Kunstwerk wieder neue Wesens-
züge offenbaren.
Dieses Bewußtsein macht zugleich die Problematik deutlich, die Petschs Buch
mit allen gleichartigen Versuchen notwendig teilt: immer gilt es, lebendigen Kunst-
organismen verstandesmäßig Gesichtspunkte ihres Aufbaus abzulauschen, obwohl
der Sinn des Lebendigen sich gegen jedes derartige Zergliedern sträuben muß. Und
scheinen diese Schwierigkeiten bei der Betrachtung der Werke eines einzelnen Dich-
ters am Ende noch überwindbar, da man vielleicht glauben kann, ihnen durch denkbar
eingehendstes Beschreiben des abgeschlossen vorliegenden Gesamtwerks in allen seinen
Zügen beizukommen, so wachsen sie schier unübersehbar an, sobald sich die For-
schungsrichtung auf eine ganze Dichtungsgattung kehrt. Denn da muß einerseits die
Taktik der Beschreibung an der grenzenlosen Masse des vorhandenen und ständig
sich vermehrenden Materials versagen, während andrerseits die Ableitung einzelner
Grundsätze aus einer beschränkten Zahl von Beispielen — die einzige Möglichkeit
des Vorgehens — notwendig im Bereich persönlicher Willkür verbleibt, vor allem aber
sich dem Verdacht aussetzt, irgendwie in rationalistischem Sinn „Regeln" des Dich-
tens, wenn nicht gar Regeln zum Dichten aufstellen zu wollen. Hiermit sind die
Schwierigkeiten und Gefahren solcher Betrachtungsweise freilich mit Absicht beson-
ders schwarz gezeichnet; ganz gewiß wird es aber dem genialen Analytiker gelingen,
ihrer Herr zu werden, den Kunstwerken Maßstäbe abzugewinnen, ohne damit dem
Leben dieser Kunstwerke nahezutreten. Bedenkt man, daß jeder Dichter in Tempo
und Rhythmus, in Klangfarbe und Wortwahl, in Wortstellung und Tonfall und
vielen anderen Eigentümlichkeiten im Grunde unvergleichbar eigenartig ist, daß jeder
einzelne dichtet, unbekümmert um andere Dichter neben oder vor ihm, wie nur gerade
er dichten muß, so leuchtet es ein, daß mit genialer Analyse aber auch geniale
Zusammenschau verbunden sein muß, soll die Betrachtung aus lauter Einzelfeststel-
lungen Gesichtspunkte finden, deren allgemeine Geltung überzeugt und deren Summe
zugleich auch die Gesamtheit des Gegenstandes trotz aller sachlich unvermeidbaren
Einschränkungen irgendwie „erschöpft".
Diese ideale Forderung, wie sie für derartige Untersuchungen hier angedeutet
wurde, sehen wir in Petschs Buch über „Wesen und Formen der Erzählkunst" in
bewunderungswürdiger Weise erfüllt. Petsch hat es verstanden, in scharfer Beleuch-
tung von Einzelbeobachtungen, wie er sie aus einer sehr umfassenden Kenntnis er-
zählender Kunstwerke meisterlich auswählt, für das Wesen der Erzählkunst typische
stilistische Erscheinungen herauszuarbeiten und damit zugleich auch noch eine
Schicht tiefer zu graben: „das einheitliche Ziel des Verfassers ... war, zu zeigen:
wie mit unbeirrbarer Folgerichtigkeit, wenn auch unter vielen Hemmungen und
Brüchen, sich in der dichterischen Erzählung immer eine bestimmte menschliche
Geisteshaltung, nämlich die epische, zu entfalten, zu läutern und zu vollenden sucht".
Angesichts dieser vielen und hohen Vorzüge des Buches bedauert es der Referent
außerordentlich, in der Berichterstattung kaum mehr als den Aufbau der Darstellung
oder vollständiger zu umschreiben, als der Verfasser es mit diesen Sätzen tut. Bei
aller Vielfalt der Betrachtungsweisen sowie der behandelten Charakterzüge der
Erzählkunst ist Petsch an systematischer „Vollständigkeit" der möglichen Gesichts-
punkte nicht gelegen. Es wird vielmehr gerade ein Haupterfolg dieses ungeheuer
reichen Buches werden, durch seine zahllosen feinen Beobachtungen an Werken der
Erzählkunst anzuregen zu immer weiteren ähnlichen Beobachtungen; denn „erschöp-
fen" läßt sich die Lebenserscheinung einer Kunstgattung mit Maßstäben des Verstan-
des überhaupt nicht, kann doch jedes einzelne neue Kunstwerk wieder neue Wesens-
züge offenbaren.
Dieses Bewußtsein macht zugleich die Problematik deutlich, die Petschs Buch
mit allen gleichartigen Versuchen notwendig teilt: immer gilt es, lebendigen Kunst-
organismen verstandesmäßig Gesichtspunkte ihres Aufbaus abzulauschen, obwohl
der Sinn des Lebendigen sich gegen jedes derartige Zergliedern sträuben muß. Und
scheinen diese Schwierigkeiten bei der Betrachtung der Werke eines einzelnen Dich-
ters am Ende noch überwindbar, da man vielleicht glauben kann, ihnen durch denkbar
eingehendstes Beschreiben des abgeschlossen vorliegenden Gesamtwerks in allen seinen
Zügen beizukommen, so wachsen sie schier unübersehbar an, sobald sich die For-
schungsrichtung auf eine ganze Dichtungsgattung kehrt. Denn da muß einerseits die
Taktik der Beschreibung an der grenzenlosen Masse des vorhandenen und ständig
sich vermehrenden Materials versagen, während andrerseits die Ableitung einzelner
Grundsätze aus einer beschränkten Zahl von Beispielen — die einzige Möglichkeit
des Vorgehens — notwendig im Bereich persönlicher Willkür verbleibt, vor allem aber
sich dem Verdacht aussetzt, irgendwie in rationalistischem Sinn „Regeln" des Dich-
tens, wenn nicht gar Regeln zum Dichten aufstellen zu wollen. Hiermit sind die
Schwierigkeiten und Gefahren solcher Betrachtungsweise freilich mit Absicht beson-
ders schwarz gezeichnet; ganz gewiß wird es aber dem genialen Analytiker gelingen,
ihrer Herr zu werden, den Kunstwerken Maßstäbe abzugewinnen, ohne damit dem
Leben dieser Kunstwerke nahezutreten. Bedenkt man, daß jeder Dichter in Tempo
und Rhythmus, in Klangfarbe und Wortwahl, in Wortstellung und Tonfall und
vielen anderen Eigentümlichkeiten im Grunde unvergleichbar eigenartig ist, daß jeder
einzelne dichtet, unbekümmert um andere Dichter neben oder vor ihm, wie nur gerade
er dichten muß, so leuchtet es ein, daß mit genialer Analyse aber auch geniale
Zusammenschau verbunden sein muß, soll die Betrachtung aus lauter Einzelfeststel-
lungen Gesichtspunkte finden, deren allgemeine Geltung überzeugt und deren Summe
zugleich auch die Gesamtheit des Gegenstandes trotz aller sachlich unvermeidbaren
Einschränkungen irgendwie „erschöpft".
Diese ideale Forderung, wie sie für derartige Untersuchungen hier angedeutet
wurde, sehen wir in Petschs Buch über „Wesen und Formen der Erzählkunst" in
bewunderungswürdiger Weise erfüllt. Petsch hat es verstanden, in scharfer Beleuch-
tung von Einzelbeobachtungen, wie er sie aus einer sehr umfassenden Kenntnis er-
zählender Kunstwerke meisterlich auswählt, für das Wesen der Erzählkunst typische
stilistische Erscheinungen herauszuarbeiten und damit zugleich auch noch eine
Schicht tiefer zu graben: „das einheitliche Ziel des Verfassers ... war, zu zeigen:
wie mit unbeirrbarer Folgerichtigkeit, wenn auch unter vielen Hemmungen und
Brüchen, sich in der dichterischen Erzählung immer eine bestimmte menschliche
Geisteshaltung, nämlich die epische, zu entfalten, zu läutern und zu vollenden sucht".
Angesichts dieser vielen und hohen Vorzüge des Buches bedauert es der Referent
außerordentlich, in der Berichterstattung kaum mehr als den Aufbau der Darstellung