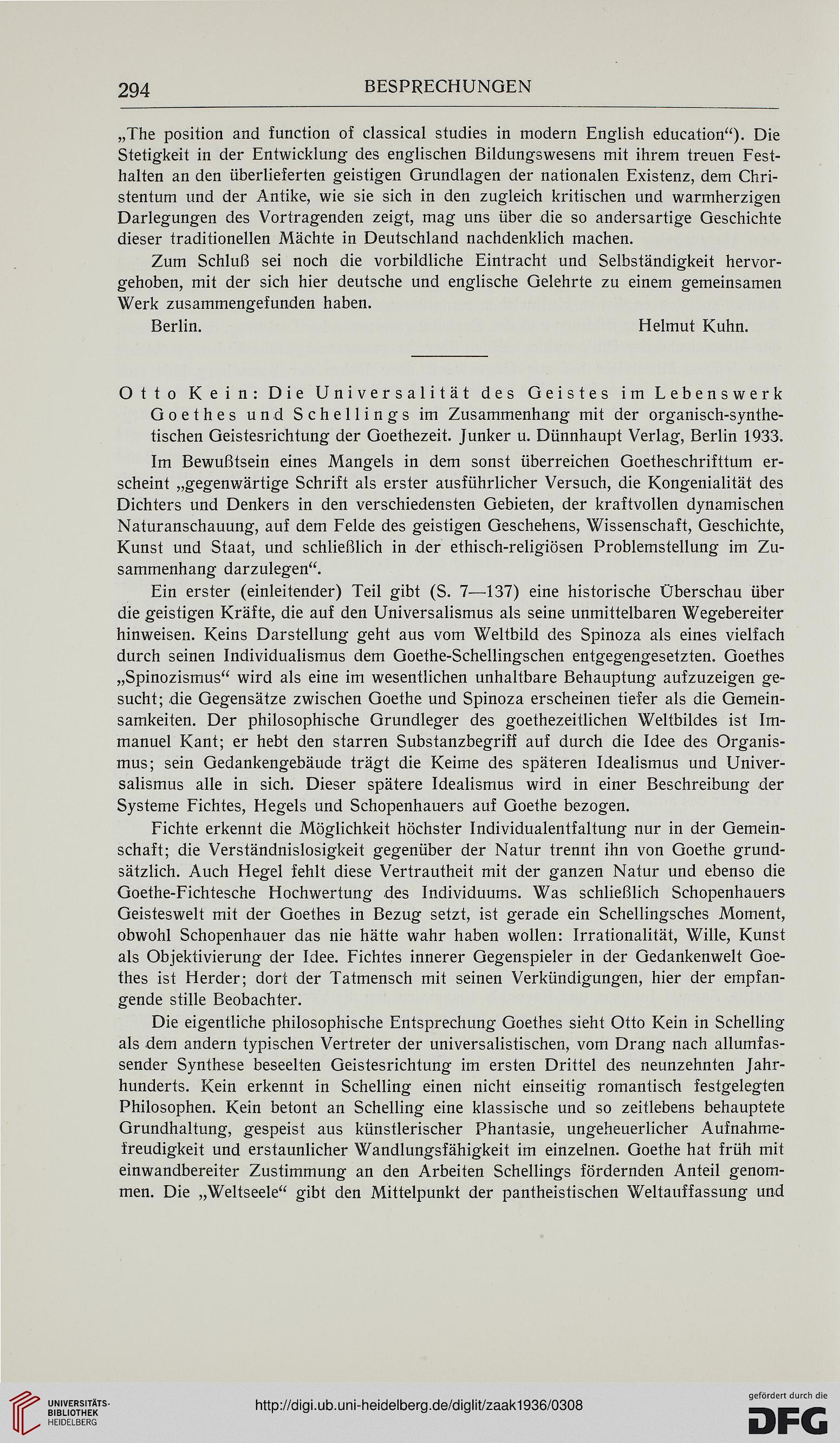294
BESPRECHUNGEN
„The position and function of classical studies in modern English education"). Die
Stetigkeit in der Entwicklung des englischen Bildungswesens mit ihrem treuen Fest-
halten an den überlieferten geistigen Grundlagen der nationalen Existenz, dem Chri-
stentum und der Antike, wie sie sich in den zugleich kritischen und warmherzigen
Darlegungen des Vortragenden zeigt, mag uns über die so andersartige Geschichte
dieser traditionellen Mächte in Deutschland nachdenklich machen.
Zum Schluß sei noch die vorbildliche Eintracht und Selbständigkeit hervor-
gehoben, mit der sich hier deutsche und englische Gelehrte zu einem gemeinsamen
Werk zusammengefunden haben.
Berlin. Helmut Kuhn.
Otto Kein: Die Universalität des Geistes im Lebenswerk
Goethes und Schellings im Zusammenhang mit der organisch-synthe-
tischen Geistesrichtung der Goethezeit. Junker u. Dünnhaupt Verlag, Berlin 1933.
Im Bewußtsein eines Mangels in dem sonst überreichen Goetheschrifttum er-
scheint „gegenwärtige Schrift als erster ausführlicher Versuch, die Kongenialität des
Dichters und Denkers in den verschiedensten Gebieten, der kraftvollen dynamischen
Naturanschauung, auf dem Felde des geistigen Geschehens, Wissenschaft, Geschichte,
Kunst und Staat, und schließlich in der ethisch-religiösen Problemstellung im Zu-
sammenhang darzulegen".
Ein erster (einleitender) Teil gibt (S. 7—137) eine historische Überschau über
die geistigen Kräfte, die auf den Universalismus als seine unmittelbaren Wegebereiter
hinweisen. Keins Darstellung geht aus vom Weltbild des Spinoza als eines vielfach
durch seinen Individualismus dem Goethe-Schellingschen entgegengesetzten. Goethes
„Spinozismus" wird als eine im wesentlichen unhaltbare Behauptung aufzuzeigen ge-
sucht; die Gegensätze zwischen Goethe und Spinoza erscheinen tiefer als die Gemein-
samkeiten. Der philosophische Grundleger des goethezeitlichen Weltbildes ist Im-
manuel Kant; er hebt den starren Substanzbegriff auf durch die Idee des Organis-
mus; sein Gedankengebäude trägt die Keime des späteren Idealismus und Univer-
salismus alle in sich. Dieser spätere Idealismus wird in einer Beschreibung der
Systeme Fichtes, Hegels und Schopenhauers auf Goethe bezogen.
Fichte erkennt die Möglichkeit höchster Individualentfaltung nur in der Gemein-
schaft; die Verständnislosigkeit gegenüber der Natur trennt ihn von Goethe grund-
sätzlich. Auch Hegel fehlt diese Vertrautheit mit der ganzen Natur und ebenso die
Goethe-Fichtesche Hochwertung des Individuums. Was schließlich Schopenhauers
Geisteswelt mit der Goethes in Bezug setzt, ist gerade ein Schellingsches Moment,
obwohl Schopenhauer das nie hätte wahr haben wollen: Irrationalität, Wille, Kunst
als Objektivierung der Idee. Fichtes innerer Gegenspieler in der Gedankenwelt Goe-
thes ist Herder; dort der Tatmensch mit seinen Verkündigungen, hier der empfan-
gende stille Beobachter.
Die eigentliche philosophische Entsprechung Goethes sieht Otto Kein in Schelling
als dem andern typischen Vertreter der universalistischen, vom Drang nach allumfas-
sender Synthese beseelten Geistesrichtung im ersten Drittel des neunzehnten Jahr-
hunderts. Kein erkennt in Schelling einen nicht einseitig romantisch festgelegten
Philosophen. Kein betont an Schelling eine klassische und so zeitlebens behauptete
Grundhaltung, gespeist aus künstlerischer Phantasie, ungeheuerlicher Aufnahme-
freudigkeit und erstaunlicher Wandlungsfähigkeit im einzelnen. Goethe hat früh mit
einwandbereiter Zustimmung an den Arbeiten Schellings fördernden Anteil genom-
men. Die „Weltseele" gibt den Mittelpunkt der pantheistischen Weltauffassung und
BESPRECHUNGEN
„The position and function of classical studies in modern English education"). Die
Stetigkeit in der Entwicklung des englischen Bildungswesens mit ihrem treuen Fest-
halten an den überlieferten geistigen Grundlagen der nationalen Existenz, dem Chri-
stentum und der Antike, wie sie sich in den zugleich kritischen und warmherzigen
Darlegungen des Vortragenden zeigt, mag uns über die so andersartige Geschichte
dieser traditionellen Mächte in Deutschland nachdenklich machen.
Zum Schluß sei noch die vorbildliche Eintracht und Selbständigkeit hervor-
gehoben, mit der sich hier deutsche und englische Gelehrte zu einem gemeinsamen
Werk zusammengefunden haben.
Berlin. Helmut Kuhn.
Otto Kein: Die Universalität des Geistes im Lebenswerk
Goethes und Schellings im Zusammenhang mit der organisch-synthe-
tischen Geistesrichtung der Goethezeit. Junker u. Dünnhaupt Verlag, Berlin 1933.
Im Bewußtsein eines Mangels in dem sonst überreichen Goetheschrifttum er-
scheint „gegenwärtige Schrift als erster ausführlicher Versuch, die Kongenialität des
Dichters und Denkers in den verschiedensten Gebieten, der kraftvollen dynamischen
Naturanschauung, auf dem Felde des geistigen Geschehens, Wissenschaft, Geschichte,
Kunst und Staat, und schließlich in der ethisch-religiösen Problemstellung im Zu-
sammenhang darzulegen".
Ein erster (einleitender) Teil gibt (S. 7—137) eine historische Überschau über
die geistigen Kräfte, die auf den Universalismus als seine unmittelbaren Wegebereiter
hinweisen. Keins Darstellung geht aus vom Weltbild des Spinoza als eines vielfach
durch seinen Individualismus dem Goethe-Schellingschen entgegengesetzten. Goethes
„Spinozismus" wird als eine im wesentlichen unhaltbare Behauptung aufzuzeigen ge-
sucht; die Gegensätze zwischen Goethe und Spinoza erscheinen tiefer als die Gemein-
samkeiten. Der philosophische Grundleger des goethezeitlichen Weltbildes ist Im-
manuel Kant; er hebt den starren Substanzbegriff auf durch die Idee des Organis-
mus; sein Gedankengebäude trägt die Keime des späteren Idealismus und Univer-
salismus alle in sich. Dieser spätere Idealismus wird in einer Beschreibung der
Systeme Fichtes, Hegels und Schopenhauers auf Goethe bezogen.
Fichte erkennt die Möglichkeit höchster Individualentfaltung nur in der Gemein-
schaft; die Verständnislosigkeit gegenüber der Natur trennt ihn von Goethe grund-
sätzlich. Auch Hegel fehlt diese Vertrautheit mit der ganzen Natur und ebenso die
Goethe-Fichtesche Hochwertung des Individuums. Was schließlich Schopenhauers
Geisteswelt mit der Goethes in Bezug setzt, ist gerade ein Schellingsches Moment,
obwohl Schopenhauer das nie hätte wahr haben wollen: Irrationalität, Wille, Kunst
als Objektivierung der Idee. Fichtes innerer Gegenspieler in der Gedankenwelt Goe-
thes ist Herder; dort der Tatmensch mit seinen Verkündigungen, hier der empfan-
gende stille Beobachter.
Die eigentliche philosophische Entsprechung Goethes sieht Otto Kein in Schelling
als dem andern typischen Vertreter der universalistischen, vom Drang nach allumfas-
sender Synthese beseelten Geistesrichtung im ersten Drittel des neunzehnten Jahr-
hunderts. Kein erkennt in Schelling einen nicht einseitig romantisch festgelegten
Philosophen. Kein betont an Schelling eine klassische und so zeitlebens behauptete
Grundhaltung, gespeist aus künstlerischer Phantasie, ungeheuerlicher Aufnahme-
freudigkeit und erstaunlicher Wandlungsfähigkeit im einzelnen. Goethe hat früh mit
einwandbereiter Zustimmung an den Arbeiten Schellings fördernden Anteil genom-
men. Die „Weltseele" gibt den Mittelpunkt der pantheistischen Weltauffassung und