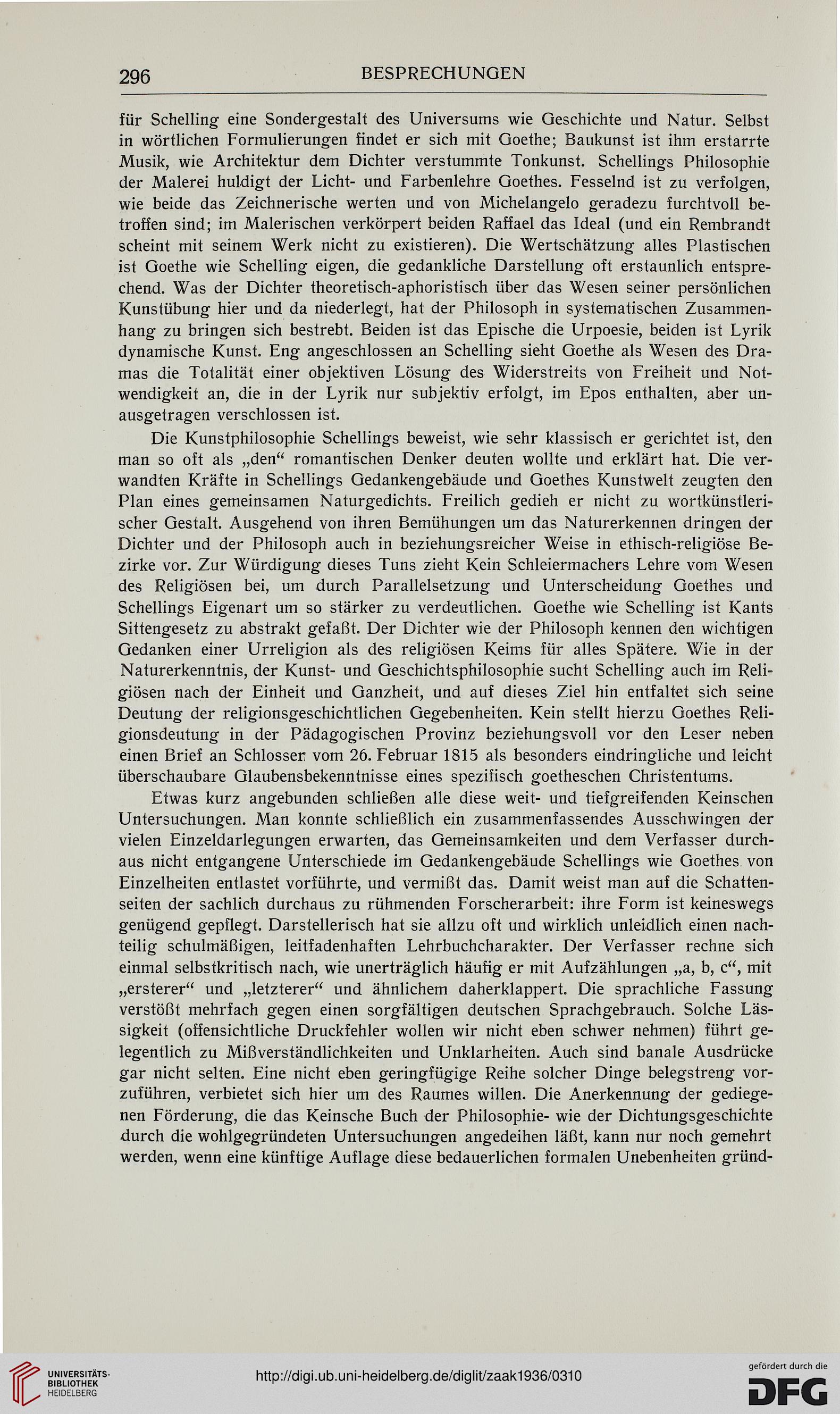296
BESPRECHUNGEN
für Schelling eine Sondergestalt des Universums wie Geschichte und Natur. Selbst
in wörtlichen Formulierungen findet er sich mit Goethe; Baukunst ist ihm erstarrte
Musik, wie Architektur dem Dichter verstummte Tonkunst. Sendlings Philosophie
der Malerei huldigt der Licht- und Farbenlehre Goethes. Fesselnd ist zu verfolgen,
wie beide das Zeichnerische werten und von Michelangelo geradezu furchtvoll be-
troffen sind; im Malerischen verkörpert beiden Raffael das Ideal (und ein Rembrandt
scheint mit seinem Werk nicht zu existieren). Die Wertschätzung alles Plastischen
ist Goethe wie Schelling eigen, die gedankliche Darstellung oft erstaunlich entspre-
chend. Was der Dichter theoretisch-aphoristisch über das Wesen seiner persönlichen
Kunstübung hier und da niederlegt, hat der Philosoph in systematischen Zusammen-
hang zu bringen sich bestrebt. Beiden ist das Epische die Urpoesie, beiden ist Lyrik
dynamische Kunst. Eng angeschlossen an Schelling sieht Goethe als Wesen des Dra-
mas die Totalität einer objektiven Lösung des Widerstreits von Freiheit und Not-
wendigkeit an, die in der Lyrik nur subjektiv erfolgt, im Epos enthalten, aber un-
ausgetragen verschlossen ist.
Die Kunstphilosophie Schellings beweist, wie sehr klassisch er gerichtet ist, den
man so oft als „den" romantischen Denker deuten wollte und erklärt hat. Die ver-
wandten Kräfte in Schellings Gedankengebäude und Goethes Kunstwelt zeugten den
Plan eines gemeinsamen Naturgedichts. Freilich gedieh er nicht zu wortkünstleri-
scher Gestalt. Ausgehend von ihren Bemühungen um das Naturerkennen dringen der
Dichter und der Philosoph auch in beziehungsreicher Weise in ethisch-religiöse Be-
zirke vor. Zur Würdigung dieses Tuns zieht Kein Schleiermachers Lehre vom Wesen
des Religiösen bei, um durch Parallelsetzung und Unterscheidung Goethes und
Schellings Eigenart um so stärker zu verdeutlichen. Goethe wie Schelling ist Kants
Sittengesetz zu abstrakt gefaßt. Der Dichter wie der Philosoph kennen den wichtigen
Gedanken einer Urreligion als des religiösen Keims für alles Spätere. Wie in der
Naturerkenntnis, der Kunst- und Geschichtsphilosophie sucht Schelling auch im Reli-
giösen nach der Einheit und Ganzheit, und auf dieses Ziel hin entfaltet sich seine
Deutung der religionsgeschichtlichen Gegebenheiten. Kein stellt hierzu Goethes Reli-
gionsdeutung in der Pädagogischen Provinz beziehungsvoll vor den Leser neben
einen Brief an Schlosser vom 26. Februar 1815 als besonders eindringliche und leicht
überschaubare Glaubensbekenntnisse eines spezifisch goetheschen Christentums.
Etwas kurz angebunden schließen alle diese weit- und tiefgreifenden Keinschen
Untersuchungen. Man konnte schließlich ein zusammenfassendes Ausschwingen der
vielen Einzeldarlegungen erwarten, das Gemeinsamkeiten und dem Verfasser durch-
aus nicht entgangene Unterschiede im Gedankengebäude Schellings wie Goethes von
Einzelheiten entlastet vorführte, und vermißt das. Damit weist man auf die Schatten-
seiten der sachlich durchaus zu rühmenden Forscherarbeit: ihre Form ist keineswegs
genügend gepflegt. Darstellerisch hat sie allzu oft und wirklich unleidlich einen nach-
teilig schulmäßigen, leitfadenhaften Lehrbuchcharakter. Der Verfasser rechne sich
einmal selbstkritisch nach, wie unerträglich häufig er mit Aufzählungen „a, b, c", mit
„ersterer" und „letzterer" und ähnlichem daherklappert. Die sprachliche Fassung
verstößt mehrfach gegen einen sorgfältigen deutschen Sprachgebrauch. Solche Läs-
sigkeit (offensichtliche Druckfehler wollen wir nicht eben schwer nehmen) führt ge-
legentlich zu Mißverständlichkeiten und Unklarheiten. Auch sind banale Ausdrücke
gar nicht selten. Eine nicht eben geringfügige Reihe solcher Dinge belegstreng vor-
zuführen, verbietet sich hier um des Raumes willen. Die Anerkennung der gediege-
nen Förderung, die das Keinsche Buch der Philosophie- wie der Dichtungsgeschichte
durch die wohlgegründeten Untersuchungen angedeihen läßt, kann nur noch gemehrt
werden, wenn eine künftige Auflage diese bedauerlichen formalen Unebenheiten gründ-
BESPRECHUNGEN
für Schelling eine Sondergestalt des Universums wie Geschichte und Natur. Selbst
in wörtlichen Formulierungen findet er sich mit Goethe; Baukunst ist ihm erstarrte
Musik, wie Architektur dem Dichter verstummte Tonkunst. Sendlings Philosophie
der Malerei huldigt der Licht- und Farbenlehre Goethes. Fesselnd ist zu verfolgen,
wie beide das Zeichnerische werten und von Michelangelo geradezu furchtvoll be-
troffen sind; im Malerischen verkörpert beiden Raffael das Ideal (und ein Rembrandt
scheint mit seinem Werk nicht zu existieren). Die Wertschätzung alles Plastischen
ist Goethe wie Schelling eigen, die gedankliche Darstellung oft erstaunlich entspre-
chend. Was der Dichter theoretisch-aphoristisch über das Wesen seiner persönlichen
Kunstübung hier und da niederlegt, hat der Philosoph in systematischen Zusammen-
hang zu bringen sich bestrebt. Beiden ist das Epische die Urpoesie, beiden ist Lyrik
dynamische Kunst. Eng angeschlossen an Schelling sieht Goethe als Wesen des Dra-
mas die Totalität einer objektiven Lösung des Widerstreits von Freiheit und Not-
wendigkeit an, die in der Lyrik nur subjektiv erfolgt, im Epos enthalten, aber un-
ausgetragen verschlossen ist.
Die Kunstphilosophie Schellings beweist, wie sehr klassisch er gerichtet ist, den
man so oft als „den" romantischen Denker deuten wollte und erklärt hat. Die ver-
wandten Kräfte in Schellings Gedankengebäude und Goethes Kunstwelt zeugten den
Plan eines gemeinsamen Naturgedichts. Freilich gedieh er nicht zu wortkünstleri-
scher Gestalt. Ausgehend von ihren Bemühungen um das Naturerkennen dringen der
Dichter und der Philosoph auch in beziehungsreicher Weise in ethisch-religiöse Be-
zirke vor. Zur Würdigung dieses Tuns zieht Kein Schleiermachers Lehre vom Wesen
des Religiösen bei, um durch Parallelsetzung und Unterscheidung Goethes und
Schellings Eigenart um so stärker zu verdeutlichen. Goethe wie Schelling ist Kants
Sittengesetz zu abstrakt gefaßt. Der Dichter wie der Philosoph kennen den wichtigen
Gedanken einer Urreligion als des religiösen Keims für alles Spätere. Wie in der
Naturerkenntnis, der Kunst- und Geschichtsphilosophie sucht Schelling auch im Reli-
giösen nach der Einheit und Ganzheit, und auf dieses Ziel hin entfaltet sich seine
Deutung der religionsgeschichtlichen Gegebenheiten. Kein stellt hierzu Goethes Reli-
gionsdeutung in der Pädagogischen Provinz beziehungsvoll vor den Leser neben
einen Brief an Schlosser vom 26. Februar 1815 als besonders eindringliche und leicht
überschaubare Glaubensbekenntnisse eines spezifisch goetheschen Christentums.
Etwas kurz angebunden schließen alle diese weit- und tiefgreifenden Keinschen
Untersuchungen. Man konnte schließlich ein zusammenfassendes Ausschwingen der
vielen Einzeldarlegungen erwarten, das Gemeinsamkeiten und dem Verfasser durch-
aus nicht entgangene Unterschiede im Gedankengebäude Schellings wie Goethes von
Einzelheiten entlastet vorführte, und vermißt das. Damit weist man auf die Schatten-
seiten der sachlich durchaus zu rühmenden Forscherarbeit: ihre Form ist keineswegs
genügend gepflegt. Darstellerisch hat sie allzu oft und wirklich unleidlich einen nach-
teilig schulmäßigen, leitfadenhaften Lehrbuchcharakter. Der Verfasser rechne sich
einmal selbstkritisch nach, wie unerträglich häufig er mit Aufzählungen „a, b, c", mit
„ersterer" und „letzterer" und ähnlichem daherklappert. Die sprachliche Fassung
verstößt mehrfach gegen einen sorgfältigen deutschen Sprachgebrauch. Solche Läs-
sigkeit (offensichtliche Druckfehler wollen wir nicht eben schwer nehmen) führt ge-
legentlich zu Mißverständlichkeiten und Unklarheiten. Auch sind banale Ausdrücke
gar nicht selten. Eine nicht eben geringfügige Reihe solcher Dinge belegstreng vor-
zuführen, verbietet sich hier um des Raumes willen. Die Anerkennung der gediege-
nen Förderung, die das Keinsche Buch der Philosophie- wie der Dichtungsgeschichte
durch die wohlgegründeten Untersuchungen angedeihen läßt, kann nur noch gemehrt
werden, wenn eine künftige Auflage diese bedauerlichen formalen Unebenheiten gründ-