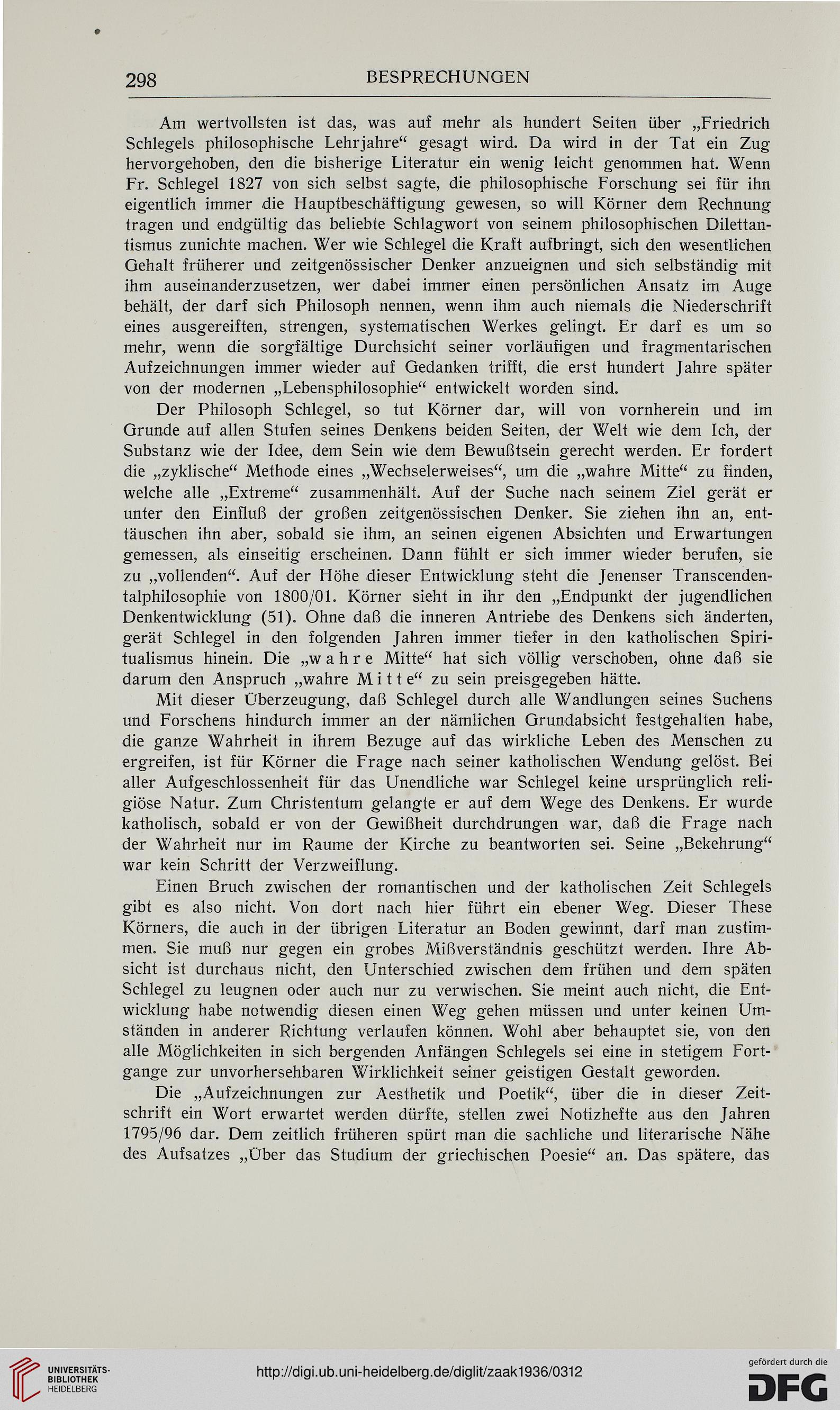Am wertvollsten ist das, was auf mehr als hundert Seiten über „Friedrich
Schlegels philosophische Lehrjahre" gesagt wird. Da wird in der Tat ein Zug
hervorgehoben, den die bisherige Literatur ein wenig leicht genommen hat. Wenn
Fr. Schlegel 1827 von sich selbst sagte, die philosophische Forschung sei für ihn
eigentlich immer die Hauptbeschäftigung gewesen, so will Körner dem Rechnung
tragen und endgültig das beliebte Schlagwort von seinem philosophischen Dilettan-
tismus zunichte machen. Wer wie Schlegel die Kraft aufbringt, sich den wesentlichen
Gehalt früherer und zeitgenössischer Denker anzueignen und sich selbständig mit
ihm auseinanderzusetzen, wer dabei immer einen persönlichen Ansatz im Auge
behält, der darf sich Philosoph nennen, wenn ihm auch niemals die Niederschrift
eines ausgereiften, strengen, systematischen Werkes gelingt. Er darf es um so
mehr, wenn die sorgfältige Durchsicht seiner vorläufigen und fragmentarischen
Aufzeichnungen immer wieder auf Gedanken trifft, die erst hundert Jahre später
von der modernen „Lebensphilosophie" entwickelt worden sind.
Der Philosoph Schlegel, so tut Körner dar, will von vornherein und im
Grunde auf allen Stufen seines Denkens beiden Seiten, der Welt wie dem Ich, der
Substanz wie der Idee, dem Sein wie dem Bewußtsein gerecht werden. Er fordert
die „zyklische" Methode eines „Wechselerweises", um die „wahre Mitte" zu finden,
welche alle „Extreme" zusammenhält. Auf der Suche nach seinem Ziel gerät er
unter den Einfluß der großen zeitgenössischen Denker. Sie ziehen ihn an, ent-
täuschen ihn aber, sobald sie ihm, an seinen eigenen Absichten und Erwartungen
gemessen, als einseitig erscheinen. Dann fühlt er sich immer wieder berufen, sie
zu „vollenden". Auf der Höhe dieser Entwicklung steht die Jenenser Transcenden-
talphilosophie von 1800/01. Körner sieht in ihr den „Endpunkt der jugendlichen
Denkentwicklung (51). Ohne daß die inneren Antriebe des Denkens sich änderten,
gerät Schlegel in den folgenden Jahren immer tiefer in den katholischen Spiri-
tualismus hinein. Die „wahre Mitte" hat sich völlig verschoben, ohne daß sie
darum den Anspruch „wahre Mitte" zu sein preisgegeben hätte.
Mit dieser Überzeugung, daß Schlegel durch alle Wandlungen seines Suchens
und Forschens hindurch immer an der nämlichen Grundabsicht festgehalten habe,
die ganze Wahrheit in ihrem Bezüge auf das wirkliche Leben des Menschen zu
ergreifen, ist für Körner die Frage nach seiner katholischen Wendung gelöst. Bei
aller Aufgeschlossenheit für das Unendliche war Schlegel keine ursprünglich reli-
giöse Natur. Zum Christentum gelangte er auf dem Wege des Denkens. Er wurde
katholisch, sobald er von der Gewißheit durchdrungen war, daß die Frage nach
der Wahrheit nur im Räume der Kirche zu beantworten sei. Seine „Bekehrung"
war kein Schritt der Verzweiflung.
Einen Bruch zwischen der romantischen und der katholischen Zeit Schlegels
gibt es also nicht. Von dort nach hier führt ein ebener Weg. Dieser These
Körners, die auch in der übrigen Literatur an Boden gewinnt, darf man zustim-
men. Sie muß nur gegen ein grobes Mißverständnis geschützt werden. Ihre Ab-
sicht ist durchaus nicht, den Unterschied zwischen dem frühen und dem späten
Schlegel zu leugnen oder auch nur zu verwischen. Sie meint auch nicht, die Ent-
wicklung habe notwendig diesen einen Weg gehen müssen und unter keinen Um-
ständen in anderer Richtung verlaufen können. Wohl aber behauptet sie, von den
alle Möglichkeiten in sich bergenden Anfängen Schlegels sei eine in stetigem Fort-
gange zur unvorhersehbaren Wirklichkeit seiner geistigen Gestalt geworden.
Die „Aufzeichnungen zur Aesthetik und Poetik", über die in dieser Zeit-
schrift ein Wort erwartet werden dürfte, stellen zwei Notizhefte aus den Jahren
1795/96 dar. Dem zeitlich früheren spürt man die sachliche und literarische Nähe
des Aufsatzes „Über das Studium der griechischen Poesie" an. Das spätere, das
Schlegels philosophische Lehrjahre" gesagt wird. Da wird in der Tat ein Zug
hervorgehoben, den die bisherige Literatur ein wenig leicht genommen hat. Wenn
Fr. Schlegel 1827 von sich selbst sagte, die philosophische Forschung sei für ihn
eigentlich immer die Hauptbeschäftigung gewesen, so will Körner dem Rechnung
tragen und endgültig das beliebte Schlagwort von seinem philosophischen Dilettan-
tismus zunichte machen. Wer wie Schlegel die Kraft aufbringt, sich den wesentlichen
Gehalt früherer und zeitgenössischer Denker anzueignen und sich selbständig mit
ihm auseinanderzusetzen, wer dabei immer einen persönlichen Ansatz im Auge
behält, der darf sich Philosoph nennen, wenn ihm auch niemals die Niederschrift
eines ausgereiften, strengen, systematischen Werkes gelingt. Er darf es um so
mehr, wenn die sorgfältige Durchsicht seiner vorläufigen und fragmentarischen
Aufzeichnungen immer wieder auf Gedanken trifft, die erst hundert Jahre später
von der modernen „Lebensphilosophie" entwickelt worden sind.
Der Philosoph Schlegel, so tut Körner dar, will von vornherein und im
Grunde auf allen Stufen seines Denkens beiden Seiten, der Welt wie dem Ich, der
Substanz wie der Idee, dem Sein wie dem Bewußtsein gerecht werden. Er fordert
die „zyklische" Methode eines „Wechselerweises", um die „wahre Mitte" zu finden,
welche alle „Extreme" zusammenhält. Auf der Suche nach seinem Ziel gerät er
unter den Einfluß der großen zeitgenössischen Denker. Sie ziehen ihn an, ent-
täuschen ihn aber, sobald sie ihm, an seinen eigenen Absichten und Erwartungen
gemessen, als einseitig erscheinen. Dann fühlt er sich immer wieder berufen, sie
zu „vollenden". Auf der Höhe dieser Entwicklung steht die Jenenser Transcenden-
talphilosophie von 1800/01. Körner sieht in ihr den „Endpunkt der jugendlichen
Denkentwicklung (51). Ohne daß die inneren Antriebe des Denkens sich änderten,
gerät Schlegel in den folgenden Jahren immer tiefer in den katholischen Spiri-
tualismus hinein. Die „wahre Mitte" hat sich völlig verschoben, ohne daß sie
darum den Anspruch „wahre Mitte" zu sein preisgegeben hätte.
Mit dieser Überzeugung, daß Schlegel durch alle Wandlungen seines Suchens
und Forschens hindurch immer an der nämlichen Grundabsicht festgehalten habe,
die ganze Wahrheit in ihrem Bezüge auf das wirkliche Leben des Menschen zu
ergreifen, ist für Körner die Frage nach seiner katholischen Wendung gelöst. Bei
aller Aufgeschlossenheit für das Unendliche war Schlegel keine ursprünglich reli-
giöse Natur. Zum Christentum gelangte er auf dem Wege des Denkens. Er wurde
katholisch, sobald er von der Gewißheit durchdrungen war, daß die Frage nach
der Wahrheit nur im Räume der Kirche zu beantworten sei. Seine „Bekehrung"
war kein Schritt der Verzweiflung.
Einen Bruch zwischen der romantischen und der katholischen Zeit Schlegels
gibt es also nicht. Von dort nach hier führt ein ebener Weg. Dieser These
Körners, die auch in der übrigen Literatur an Boden gewinnt, darf man zustim-
men. Sie muß nur gegen ein grobes Mißverständnis geschützt werden. Ihre Ab-
sicht ist durchaus nicht, den Unterschied zwischen dem frühen und dem späten
Schlegel zu leugnen oder auch nur zu verwischen. Sie meint auch nicht, die Ent-
wicklung habe notwendig diesen einen Weg gehen müssen und unter keinen Um-
ständen in anderer Richtung verlaufen können. Wohl aber behauptet sie, von den
alle Möglichkeiten in sich bergenden Anfängen Schlegels sei eine in stetigem Fort-
gange zur unvorhersehbaren Wirklichkeit seiner geistigen Gestalt geworden.
Die „Aufzeichnungen zur Aesthetik und Poetik", über die in dieser Zeit-
schrift ein Wort erwartet werden dürfte, stellen zwei Notizhefte aus den Jahren
1795/96 dar. Dem zeitlich früheren spürt man die sachliche und literarische Nähe
des Aufsatzes „Über das Studium der griechischen Poesie" an. Das spätere, das