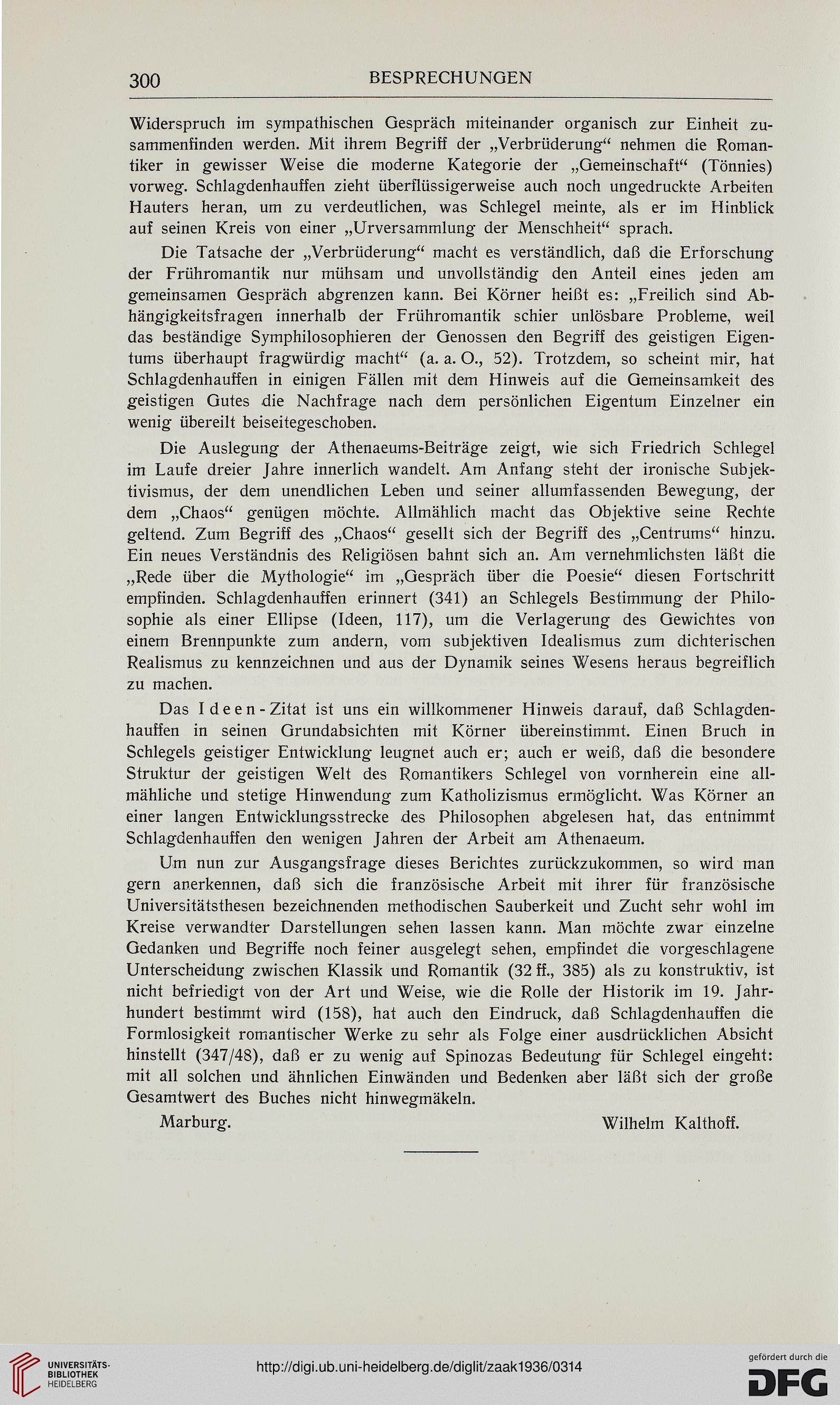300
BESPRECHUNGEN
Widerspruch im sympathischen Gespräch miteinander organisch zur Einheit zu-
sammenfinden werden. Mit ihrem Begriff der „Verbrüderung" nehmen die Roman-
tiker in gewisser Weise die moderne Kategorie der „Gemeinschaft" (Tönnies)
vorweg. Schlagdenhauffen zieht überflüssigerweise auch noch ungedruckte Arbeiten
Hauters heran, um zu verdeutlichen, was Schlegel meinte, als er im Hinblick
auf seinen Kreis von einer „Urversammlung der Menschheit" sprach.
Die Tatsache der „Verbrüderung" macht es verständlich, daß die Erforschung
der Frühromantik nur mühsam und unvollständig den Anteil eines jeden am
gemeinsamen Gespräch abgrenzen kann. Bei Körner heißt es: „Freilich sind Ab-
hängigkeitsfragen innerhalb der Frühromantik schier unlösbare Probleme, weil
das beständige Symphilosophieren der Genossen den Begriff des geistigen Eigen-
tums überhaupt fragwürdig macht" (a. a. O., 52). Trotzdem, so scheint mir, hat
Schlagdenhauffen in einigen Fällen mit dem Hinweis auf die Gemeinsamkeit des
geistigen Gutes die Nachfrage nach dem persönlichen Eigentum Einzelner ein
wenig übereilt beiseitegeschoben.
Die Auslegung der Athenaeums-Beiträge zeigt, wie sich Friedrich Schlegel
im Laufe dreier Jahre innerlich wandelt. Am Anfang steht der ironische Subjek-
tivismus, der dem unendlichen Leben und seiner allumfassenden Bewegung, der
dem „Chaos" genügen möchte. Allmählich macht das Objektive seine Rechte
geltend. Zum Begriff des „Chaos" gesellt sich der Begriff des „Centrums" hinzu.
Ein neues Verständnis des Religiösen bahnt sich an. Am vernehmlichsten läßt die
„Rede über die Mythologie" im „Gespräch über die Poesie" diesen Fortschritt
empfinden. Schlagdenhauffen erinnert (341) an Schlegels Bestimmung der Philo-
sophie als einer Ellipse (Ideen, 117), um die Verlagerung des Gewichtes von
einem Brennpunkte zum andern, vom subjektiven Idealismus zum dichterischen
Realismus zu kennzeichnen und aus der Dynamik seines Wesens heraus begreiflich
zu machen.
Das Ideen-Zitat ist uns ein willkommener Hinweis darauf, daß Schlagden-
hauffen in seinen Grundabsichten mit Körner übereinstimmt. Einen Bruch in
Schlegels geistiger Entwicklung leugnet auch er; auch er weiß, daß die besondere
Struktur der geistigen Welt des Romantikers Schlegel von vornherein eine all-
mähliche und stetige Hinwendung zum Katholizismus ermöglicht. Was Körner an
einer langen Entwicklungsstrecke des Philosophen abgelesen hat, das entnimmt
Schlagdenhauffen den wenigen Jahren der Arbeit am Athenaeum.
Um nun zur Ausgangsfrage dieses Berichtes zurückzukommen, so wird man
gern anerkennen, daß sich die französische Arbeit mit ihrer für französische
Universitätsthesen bezeichnenden methodischen Sauberkeit und Zucht sehr wohl im
Kreise verwandter Darstellungen sehen lassen kann. Man möchte zwar einzelne
Gedanken und Begriffe noch feiner ausgelegt sehen, empfindet die vorgeschlagene
Unterscheidung zwischen Klassik und Romantik (32 ff., 385) als zu konstruktiv, ist
nicht befriedigt von der Art und Weise, wie die Rolle der Historik im 19. Jahr-
hundert bestimmt wird (158), hat auch den Eindruck, daß Schlagdenhauffen die
Formlosigkeit romantischer Werke zu sehr als Folge einer ausdrücklichen Absicht
hinstellt (347/48), daß er zu wenig auf Spinozas Bedeutung für Schlegel eingeht:
mit all solchen und ähnlichen Einwänden und Bedenken aber läßt sich der große
Gesamtwert des Buches nicht hinwegmäkeln.
Marburg. Wilhelm Kalthoff.
BESPRECHUNGEN
Widerspruch im sympathischen Gespräch miteinander organisch zur Einheit zu-
sammenfinden werden. Mit ihrem Begriff der „Verbrüderung" nehmen die Roman-
tiker in gewisser Weise die moderne Kategorie der „Gemeinschaft" (Tönnies)
vorweg. Schlagdenhauffen zieht überflüssigerweise auch noch ungedruckte Arbeiten
Hauters heran, um zu verdeutlichen, was Schlegel meinte, als er im Hinblick
auf seinen Kreis von einer „Urversammlung der Menschheit" sprach.
Die Tatsache der „Verbrüderung" macht es verständlich, daß die Erforschung
der Frühromantik nur mühsam und unvollständig den Anteil eines jeden am
gemeinsamen Gespräch abgrenzen kann. Bei Körner heißt es: „Freilich sind Ab-
hängigkeitsfragen innerhalb der Frühromantik schier unlösbare Probleme, weil
das beständige Symphilosophieren der Genossen den Begriff des geistigen Eigen-
tums überhaupt fragwürdig macht" (a. a. O., 52). Trotzdem, so scheint mir, hat
Schlagdenhauffen in einigen Fällen mit dem Hinweis auf die Gemeinsamkeit des
geistigen Gutes die Nachfrage nach dem persönlichen Eigentum Einzelner ein
wenig übereilt beiseitegeschoben.
Die Auslegung der Athenaeums-Beiträge zeigt, wie sich Friedrich Schlegel
im Laufe dreier Jahre innerlich wandelt. Am Anfang steht der ironische Subjek-
tivismus, der dem unendlichen Leben und seiner allumfassenden Bewegung, der
dem „Chaos" genügen möchte. Allmählich macht das Objektive seine Rechte
geltend. Zum Begriff des „Chaos" gesellt sich der Begriff des „Centrums" hinzu.
Ein neues Verständnis des Religiösen bahnt sich an. Am vernehmlichsten läßt die
„Rede über die Mythologie" im „Gespräch über die Poesie" diesen Fortschritt
empfinden. Schlagdenhauffen erinnert (341) an Schlegels Bestimmung der Philo-
sophie als einer Ellipse (Ideen, 117), um die Verlagerung des Gewichtes von
einem Brennpunkte zum andern, vom subjektiven Idealismus zum dichterischen
Realismus zu kennzeichnen und aus der Dynamik seines Wesens heraus begreiflich
zu machen.
Das Ideen-Zitat ist uns ein willkommener Hinweis darauf, daß Schlagden-
hauffen in seinen Grundabsichten mit Körner übereinstimmt. Einen Bruch in
Schlegels geistiger Entwicklung leugnet auch er; auch er weiß, daß die besondere
Struktur der geistigen Welt des Romantikers Schlegel von vornherein eine all-
mähliche und stetige Hinwendung zum Katholizismus ermöglicht. Was Körner an
einer langen Entwicklungsstrecke des Philosophen abgelesen hat, das entnimmt
Schlagdenhauffen den wenigen Jahren der Arbeit am Athenaeum.
Um nun zur Ausgangsfrage dieses Berichtes zurückzukommen, so wird man
gern anerkennen, daß sich die französische Arbeit mit ihrer für französische
Universitätsthesen bezeichnenden methodischen Sauberkeit und Zucht sehr wohl im
Kreise verwandter Darstellungen sehen lassen kann. Man möchte zwar einzelne
Gedanken und Begriffe noch feiner ausgelegt sehen, empfindet die vorgeschlagene
Unterscheidung zwischen Klassik und Romantik (32 ff., 385) als zu konstruktiv, ist
nicht befriedigt von der Art und Weise, wie die Rolle der Historik im 19. Jahr-
hundert bestimmt wird (158), hat auch den Eindruck, daß Schlagdenhauffen die
Formlosigkeit romantischer Werke zu sehr als Folge einer ausdrücklichen Absicht
hinstellt (347/48), daß er zu wenig auf Spinozas Bedeutung für Schlegel eingeht:
mit all solchen und ähnlichen Einwänden und Bedenken aber läßt sich der große
Gesamtwert des Buches nicht hinwegmäkeln.
Marburg. Wilhelm Kalthoff.