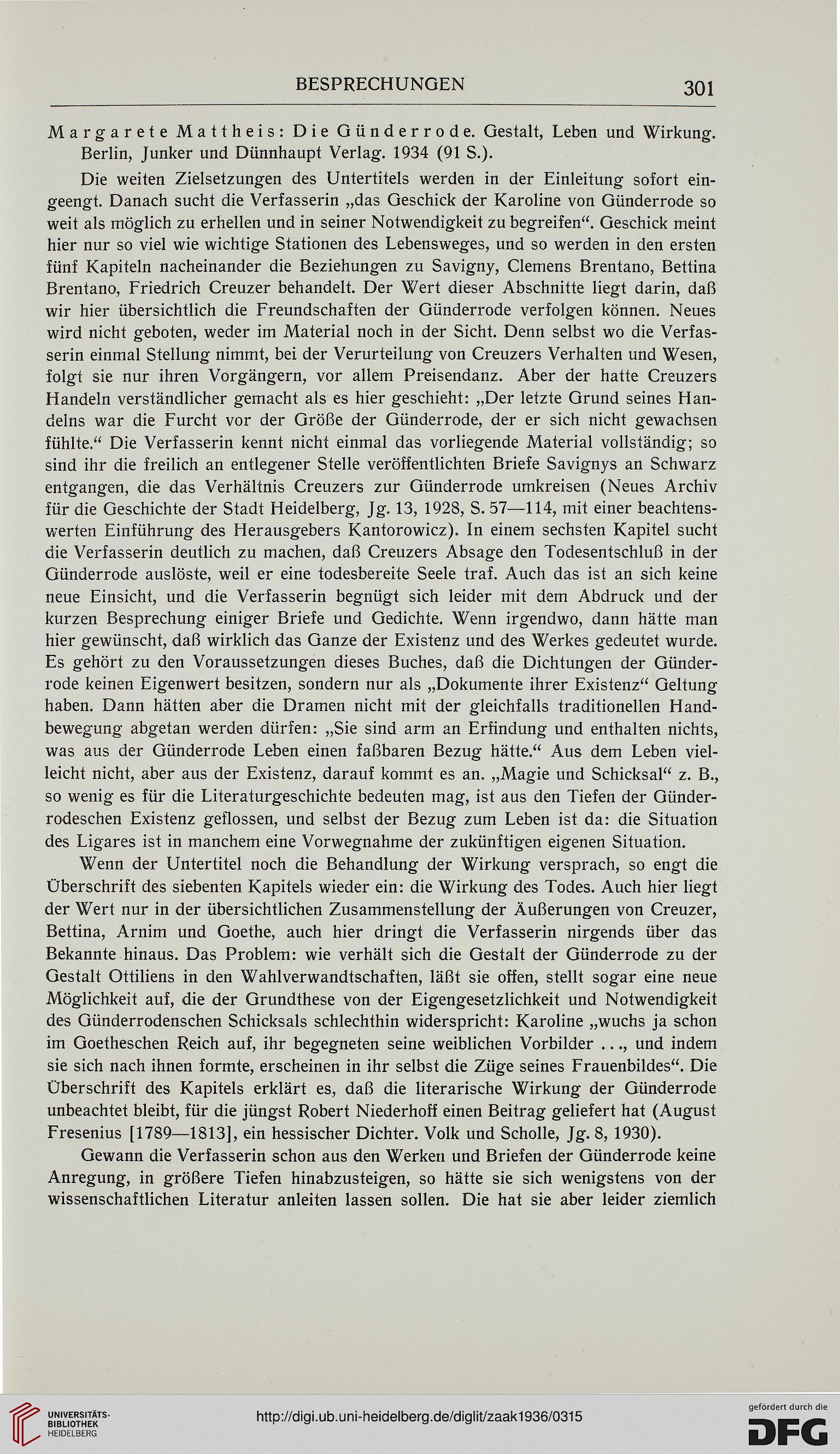Margarete Mattheis: Die Günderrode. Gestalt, Leben und Wirkung.
Berlin, Junker und Dünnhaupt Verlag. 1934 (91 S.).
Die weiten Zielsetzungen des Untertitels werden in der Einleitung sofort ein-
geengt. Danach sucht die Verfasserin „das Geschick der Karoline von Günderrode so
weit als möglich zu erhellen und in seiner Notwendigkeit zu begreifen". Geschick meint
hier nur so viel wie wichtige Stationen des Lebensweges, und so werden in den ersten
fünf Kapiteln nacheinander die Beziehungen zu Savigny, Clemens Brentano, Bettina
Brentano, Friedrich Creuzer behandelt. Der Wert dieser Abschnitte liegt darin, daß
wir hier übersichtlich die Freundschaften der Günderrode verfolgen können. Neues
wird nicht geboten, weder im Material noch in der Sicht. Denn selbst wo die Verfas-
serin einmal Stellung nimmt, bei der Verurteilung von Creuzers Verhalten und Wesen,
folgt sie nur ihren Vorgängern, vor allem Preisendanz. Aber der hatte Creuzers
Handeln verständlicher gemacht als es hier geschieht: „Der letzte Grund seines Han-
delns war die Furcht vor der Größe der Günderrode, der er sich nicht gewachsen
fühlte." Die Verfasserin kennt nicht einmal das vorliegende Material vollständig; so
sind ihr die freilich an entlegener Stelle veröffentlichten Briefe Savignys an Schwarz
entgangen, die das Verhältnis Creuzers zur Günderrode umkreisen (Neues Archiv
für die Geschichte der Stadt Heidelberg, Jg. 13, 1928, S. 57—114, mit einer beachtens-
werten Einführung des Herausgebers Kantorowicz). In einem sechsten Kapitel sucht
die Verfasserin deutlich zu machen, daß Creuzers Absage den Todesentschluß in der
Günderrode auslöste, weil er eine todesbereite Seele traf. Auch das ist an sich keine
neue Einsicht, und die Verfasserin begnügt sich leider mit dem Abdruck und der
kurzen Besprechung einiger Briefe und Gedichte. Wenn irgendwo, dann hätte man
hier gewünscht, daß wirklich das Ganze der Existenz und des Werkes gedeutet wurde.
Es gehört zu den Voraussetzungen dieses Buches, daß die Dichtungen der Günder-
rode keinen Eigenwert besitzen, sondern nur als „Dokumente ihrer Existenz" Geltung
haben. Dann hätten aber die Dramen nicht mit der gleichfalls traditionellen Hand-
bewegung abgetan werden dürfen: „Sie sind arm an Erfindung und enthalten nichts,
was aus der Günderrode Leben einen faßbaren Bezug hätte." Aus dem Leben viel-
leicht nicht, aber aus der Existenz, darauf kommt es an. „Magie und Schicksal" z. B.,
so wenig es für die Literaturgeschichte bedeuten mag, ist aus den Tiefen der Günder-
rodeschen Existenz geflossen, und selbst der Bezug zum Leben ist da: die Situation
des Ligares ist in manchem eine Vorwegnahme der zukünftigen eigenen Situation.
Wenn der Untertitel noch die Behandlung der Wirkung versprach, so engt die
Überschrift des siebenten Kapitels wieder ein: die Wirkung des Todes. Auch hier liegt
der Wert nur in der übersichtlichen Zusammenstellung der Äußerungen von Creuzer,
Bettina, Arnim und Goethe, auch hier dringt die Verfasserin nirgends über das
Bekannte hinaus. Das Problem: wie verhält sich die Gestalt der Günderrode zu der
Gestalt Ottiliens in den Wahlverwandtschaften, läßt sie offen, stellt sogar eine neue
Möglichkeit auf, die der Grundthese von der Eigengesetzlichkeit und Notwendigkeit
des Günderrodenschen Schicksals schlechthin widerspricht: Karoline „wuchs ja schon
im Goetheschen Reich auf, ihr begegneten seine weiblichen Vorbilder ..., und indem
sie sich nach ihnen formte, erscheinen in ihr selbst die Züge seines Frauenbildes". Die
Überschrift des Kapitels erklärt es, daß die literarische Wirkung der Günderrode
unbeachtet bleibt, für die jüngst Robert Niederhoff einen Beitrag geliefert hat (August
Fresenius [1789—1813], ein hessischer Dichter. Volk und Scholle, Jg. 8, 1930).
Gewann die Verfasserin schon aus den Werken und Briefen der Günderrode keine
Anregung, in größere Tiefen hinabzusteigen, so hätte sie sich wenigstens von der
wissenschaftlichen Literatur anleiten lassen sollen. Die hat sie aber leider ziemlich
Berlin, Junker und Dünnhaupt Verlag. 1934 (91 S.).
Die weiten Zielsetzungen des Untertitels werden in der Einleitung sofort ein-
geengt. Danach sucht die Verfasserin „das Geschick der Karoline von Günderrode so
weit als möglich zu erhellen und in seiner Notwendigkeit zu begreifen". Geschick meint
hier nur so viel wie wichtige Stationen des Lebensweges, und so werden in den ersten
fünf Kapiteln nacheinander die Beziehungen zu Savigny, Clemens Brentano, Bettina
Brentano, Friedrich Creuzer behandelt. Der Wert dieser Abschnitte liegt darin, daß
wir hier übersichtlich die Freundschaften der Günderrode verfolgen können. Neues
wird nicht geboten, weder im Material noch in der Sicht. Denn selbst wo die Verfas-
serin einmal Stellung nimmt, bei der Verurteilung von Creuzers Verhalten und Wesen,
folgt sie nur ihren Vorgängern, vor allem Preisendanz. Aber der hatte Creuzers
Handeln verständlicher gemacht als es hier geschieht: „Der letzte Grund seines Han-
delns war die Furcht vor der Größe der Günderrode, der er sich nicht gewachsen
fühlte." Die Verfasserin kennt nicht einmal das vorliegende Material vollständig; so
sind ihr die freilich an entlegener Stelle veröffentlichten Briefe Savignys an Schwarz
entgangen, die das Verhältnis Creuzers zur Günderrode umkreisen (Neues Archiv
für die Geschichte der Stadt Heidelberg, Jg. 13, 1928, S. 57—114, mit einer beachtens-
werten Einführung des Herausgebers Kantorowicz). In einem sechsten Kapitel sucht
die Verfasserin deutlich zu machen, daß Creuzers Absage den Todesentschluß in der
Günderrode auslöste, weil er eine todesbereite Seele traf. Auch das ist an sich keine
neue Einsicht, und die Verfasserin begnügt sich leider mit dem Abdruck und der
kurzen Besprechung einiger Briefe und Gedichte. Wenn irgendwo, dann hätte man
hier gewünscht, daß wirklich das Ganze der Existenz und des Werkes gedeutet wurde.
Es gehört zu den Voraussetzungen dieses Buches, daß die Dichtungen der Günder-
rode keinen Eigenwert besitzen, sondern nur als „Dokumente ihrer Existenz" Geltung
haben. Dann hätten aber die Dramen nicht mit der gleichfalls traditionellen Hand-
bewegung abgetan werden dürfen: „Sie sind arm an Erfindung und enthalten nichts,
was aus der Günderrode Leben einen faßbaren Bezug hätte." Aus dem Leben viel-
leicht nicht, aber aus der Existenz, darauf kommt es an. „Magie und Schicksal" z. B.,
so wenig es für die Literaturgeschichte bedeuten mag, ist aus den Tiefen der Günder-
rodeschen Existenz geflossen, und selbst der Bezug zum Leben ist da: die Situation
des Ligares ist in manchem eine Vorwegnahme der zukünftigen eigenen Situation.
Wenn der Untertitel noch die Behandlung der Wirkung versprach, so engt die
Überschrift des siebenten Kapitels wieder ein: die Wirkung des Todes. Auch hier liegt
der Wert nur in der übersichtlichen Zusammenstellung der Äußerungen von Creuzer,
Bettina, Arnim und Goethe, auch hier dringt die Verfasserin nirgends über das
Bekannte hinaus. Das Problem: wie verhält sich die Gestalt der Günderrode zu der
Gestalt Ottiliens in den Wahlverwandtschaften, läßt sie offen, stellt sogar eine neue
Möglichkeit auf, die der Grundthese von der Eigengesetzlichkeit und Notwendigkeit
des Günderrodenschen Schicksals schlechthin widerspricht: Karoline „wuchs ja schon
im Goetheschen Reich auf, ihr begegneten seine weiblichen Vorbilder ..., und indem
sie sich nach ihnen formte, erscheinen in ihr selbst die Züge seines Frauenbildes". Die
Überschrift des Kapitels erklärt es, daß die literarische Wirkung der Günderrode
unbeachtet bleibt, für die jüngst Robert Niederhoff einen Beitrag geliefert hat (August
Fresenius [1789—1813], ein hessischer Dichter. Volk und Scholle, Jg. 8, 1930).
Gewann die Verfasserin schon aus den Werken und Briefen der Günderrode keine
Anregung, in größere Tiefen hinabzusteigen, so hätte sie sich wenigstens von der
wissenschaftlichen Literatur anleiten lassen sollen. Die hat sie aber leider ziemlich