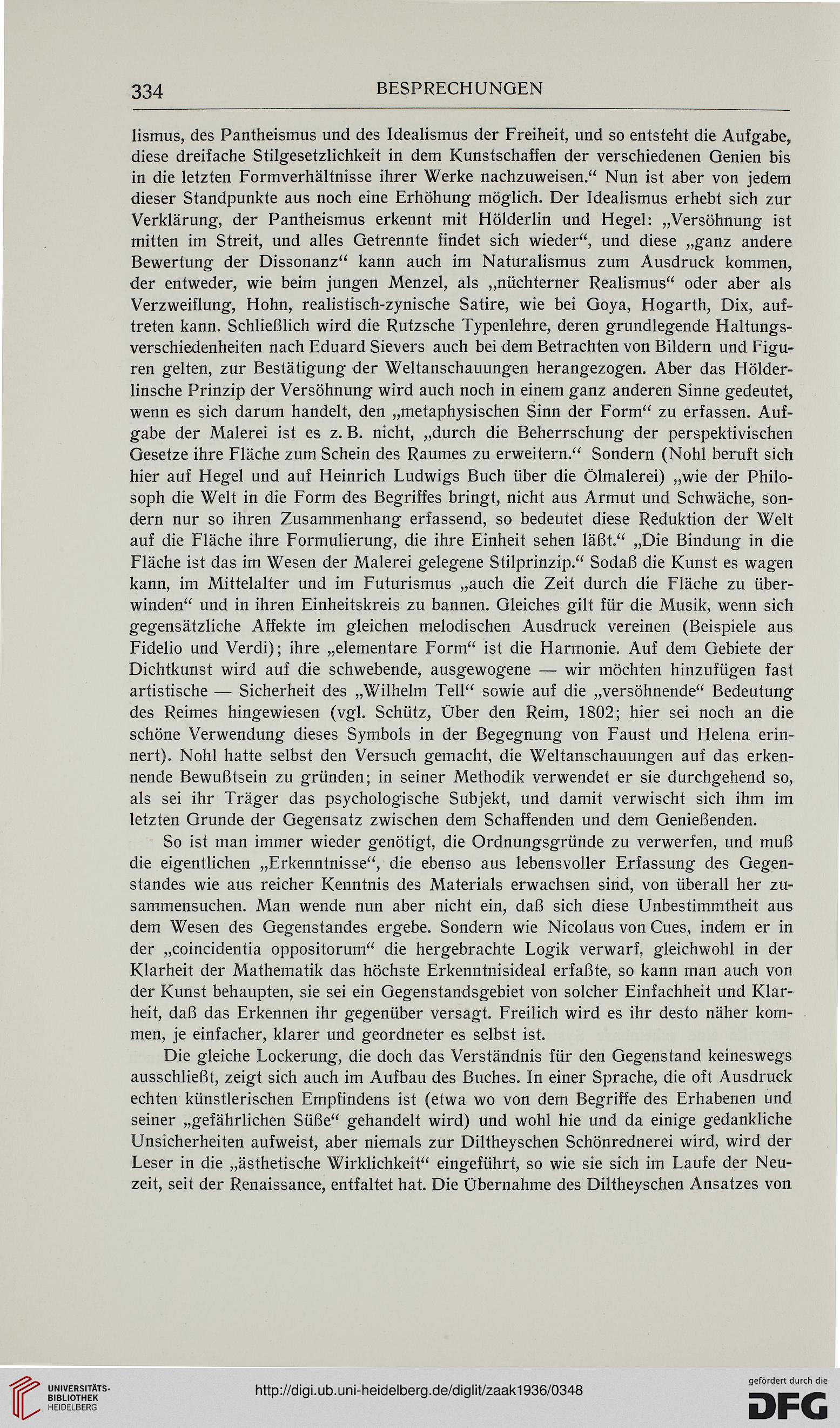334 BESPRECHUNGEN
lismus, des Pantheismus und des Idealismus der Freiheit, und so entsteht die Aufgabe,
diese dreifache Stilgesetzlichkeit in dem Kunstschaffen der verschiedenen Genien bis
in die letzten Formverhältnisse ihrer Werke nachzuweisen." Nun ist aber von jedem
dieser Standpunkte aus noch eine Erhöhung möglich. Der Idealismus erhebt sich zur
Verklärung, der Pantheismus erkennt mit Hölderlin und Hegel: „Versöhnung ist
mitten im Streit, und alles Getrennte findet sich wieder", und diese „ganz andere
Bewertung der Dissonanz" kann auch im Naturalismus zum Ausdruck kommen,
der entweder, wie beim jungen Menzel, als „nüchterner Realismus" oder aber als
Verzweiflung, Hohn, realistisch-zynische Satire, wie bei Goya, Hogarth, Dix, auf-
treten kann. Schließlich wird die Rutzsche Typenlehre, deren grundlegende Haltungs-
verschiedenheiten nach Eduard Sievers auch bei dem Betrachten von Bildern und Figu-
ren gelten, zur Bestätigung der Weltanschauungen herangezogen. Aber das Hölder-
linsche Prinzip der Versöhnung wird auch noch in einem ganz anderen Sinne gedeutet,
wenn es sich darum handelt, den „metaphysischen Sinn der Form" zu erfassen. Auf-
gabe der Malerei ist es z. B. nicht, „durch die Beherrschung der perspektivischen
Gesetze ihre Fläche zum Schein des Raumes zu erweitern." Sondern (Nohl beruft sich
hier auf Hegel und auf Heinrich Ludwigs Buch über die Ölmalerei) „wie der Philo-
soph die Welt in die Form des Begriffes bringt, nicht aus Armut und Schwäche, son-
dern nur so ihren Zusammenhang erfassend, so bedeutet diese Reduktion der Welt
auf die Fläche ihre Formulierung, die ihre Einheit sehen läßt." „Die Bindung in die
Fläche ist das im Wesen der Malerei gelegene Stilprinzip." Sodaß die Kunst es wagen
kann, im Mittelalter und im Futurismus „auch die Zeit durch die Fläche zu über-
winden" und in ihren Einheitskreis zu bannen. Gleiches gilt für die Musik, wenn sich
gegensätzliche Affekte im gleichen melodischen Ausdruck vereinen (Beispiele aus
Fidelio und Verdi); ihre „elementare Form" ist die Harmonie. Auf dem Gebiete der
Dichtkunst wird auf die schwebende, ausgewogene — wir möchten hinzufügen fast
artistische — Sicherheit des „Wilhelm Teil" sowie auf die „versöhnende" Bedeutung
des Reimes hingewiesen (vgl. Schütz, Über den Reim, 1802; hier sei noch an die
schöne Verwendung dieses Symbols in der Begegnung von Faust und Helena erin-
nert). Nohl hatte selbst den Versuch gemacht, die Weltanschauungen auf das erken-
nende Bewußtsein zu gründen; in seiner Methodik verwendet er sie durchgehend so,
als sei ihr Träger das psychologische Subjekt, und damit verwischt sich ihm im
letzten Grunde der Gegensatz zwischen dem Schaffenden und dem Genießenden.
So ist man immer wieder genötigt, die Ordnungsgründe zu verwerfen, und muß
die eigentlichen „Erkenntnisse", die ebenso aus lebensvoller Erfassung des Gegen-
standes wie aus reicher Kenntnis des Materials erwachsen sind, von überall her zu-
sammensuchen. Man wende nun aber nicht ein, daß sich diese Unbestimmtheit aus
dem Wesen des Gegenstandes ergebe. Sondern wie Nicolaus von Cues, indem er in
der „coincidentia oppositorum" die hergebrachte Logik verwarf, gleichwohl in der
Klarheit der Mathematik das höchste Erkenntnisideal erfaßte, so kann man auch von
der Kunst behaupten, sie sei ein Gegenstandsgebiet von solcher Einfachheit und Klar-
heit, daß das Erkennen ihr gegenüber versagt. Freilich wird es ihr desto näher kom-
men, je einfacher, klarer und geordneter es selbst ist.
Die gleiche Lockerung, die doch das Verständnis für den Gegenstand keineswegs
ausschließt, zeigt sich auch im Aufbau des Buches. In einer Sprache, die oft Ausdruck
echten künstlerischen Empfindens ist (etwa wo von dem Begriffe des Erhabenen und
seiner „gefährlichen Süße" gehandelt wird) und wohl hie und da einige gedankliche
Unsicherheiten aufweist, aber niemals zur Diltheyschen Schönrednerei wird, wird der
Leser in die „ästhetische Wirklichkeit" eingeführt, so wie sie sich im Laufe der Neu-
zeit, seit der Renaissance, entfaltet hat. Die Übernahme des Diltheyschen Ansatzes von
lismus, des Pantheismus und des Idealismus der Freiheit, und so entsteht die Aufgabe,
diese dreifache Stilgesetzlichkeit in dem Kunstschaffen der verschiedenen Genien bis
in die letzten Formverhältnisse ihrer Werke nachzuweisen." Nun ist aber von jedem
dieser Standpunkte aus noch eine Erhöhung möglich. Der Idealismus erhebt sich zur
Verklärung, der Pantheismus erkennt mit Hölderlin und Hegel: „Versöhnung ist
mitten im Streit, und alles Getrennte findet sich wieder", und diese „ganz andere
Bewertung der Dissonanz" kann auch im Naturalismus zum Ausdruck kommen,
der entweder, wie beim jungen Menzel, als „nüchterner Realismus" oder aber als
Verzweiflung, Hohn, realistisch-zynische Satire, wie bei Goya, Hogarth, Dix, auf-
treten kann. Schließlich wird die Rutzsche Typenlehre, deren grundlegende Haltungs-
verschiedenheiten nach Eduard Sievers auch bei dem Betrachten von Bildern und Figu-
ren gelten, zur Bestätigung der Weltanschauungen herangezogen. Aber das Hölder-
linsche Prinzip der Versöhnung wird auch noch in einem ganz anderen Sinne gedeutet,
wenn es sich darum handelt, den „metaphysischen Sinn der Form" zu erfassen. Auf-
gabe der Malerei ist es z. B. nicht, „durch die Beherrschung der perspektivischen
Gesetze ihre Fläche zum Schein des Raumes zu erweitern." Sondern (Nohl beruft sich
hier auf Hegel und auf Heinrich Ludwigs Buch über die Ölmalerei) „wie der Philo-
soph die Welt in die Form des Begriffes bringt, nicht aus Armut und Schwäche, son-
dern nur so ihren Zusammenhang erfassend, so bedeutet diese Reduktion der Welt
auf die Fläche ihre Formulierung, die ihre Einheit sehen läßt." „Die Bindung in die
Fläche ist das im Wesen der Malerei gelegene Stilprinzip." Sodaß die Kunst es wagen
kann, im Mittelalter und im Futurismus „auch die Zeit durch die Fläche zu über-
winden" und in ihren Einheitskreis zu bannen. Gleiches gilt für die Musik, wenn sich
gegensätzliche Affekte im gleichen melodischen Ausdruck vereinen (Beispiele aus
Fidelio und Verdi); ihre „elementare Form" ist die Harmonie. Auf dem Gebiete der
Dichtkunst wird auf die schwebende, ausgewogene — wir möchten hinzufügen fast
artistische — Sicherheit des „Wilhelm Teil" sowie auf die „versöhnende" Bedeutung
des Reimes hingewiesen (vgl. Schütz, Über den Reim, 1802; hier sei noch an die
schöne Verwendung dieses Symbols in der Begegnung von Faust und Helena erin-
nert). Nohl hatte selbst den Versuch gemacht, die Weltanschauungen auf das erken-
nende Bewußtsein zu gründen; in seiner Methodik verwendet er sie durchgehend so,
als sei ihr Träger das psychologische Subjekt, und damit verwischt sich ihm im
letzten Grunde der Gegensatz zwischen dem Schaffenden und dem Genießenden.
So ist man immer wieder genötigt, die Ordnungsgründe zu verwerfen, und muß
die eigentlichen „Erkenntnisse", die ebenso aus lebensvoller Erfassung des Gegen-
standes wie aus reicher Kenntnis des Materials erwachsen sind, von überall her zu-
sammensuchen. Man wende nun aber nicht ein, daß sich diese Unbestimmtheit aus
dem Wesen des Gegenstandes ergebe. Sondern wie Nicolaus von Cues, indem er in
der „coincidentia oppositorum" die hergebrachte Logik verwarf, gleichwohl in der
Klarheit der Mathematik das höchste Erkenntnisideal erfaßte, so kann man auch von
der Kunst behaupten, sie sei ein Gegenstandsgebiet von solcher Einfachheit und Klar-
heit, daß das Erkennen ihr gegenüber versagt. Freilich wird es ihr desto näher kom-
men, je einfacher, klarer und geordneter es selbst ist.
Die gleiche Lockerung, die doch das Verständnis für den Gegenstand keineswegs
ausschließt, zeigt sich auch im Aufbau des Buches. In einer Sprache, die oft Ausdruck
echten künstlerischen Empfindens ist (etwa wo von dem Begriffe des Erhabenen und
seiner „gefährlichen Süße" gehandelt wird) und wohl hie und da einige gedankliche
Unsicherheiten aufweist, aber niemals zur Diltheyschen Schönrednerei wird, wird der
Leser in die „ästhetische Wirklichkeit" eingeführt, so wie sie sich im Laufe der Neu-
zeit, seit der Renaissance, entfaltet hat. Die Übernahme des Diltheyschen Ansatzes von