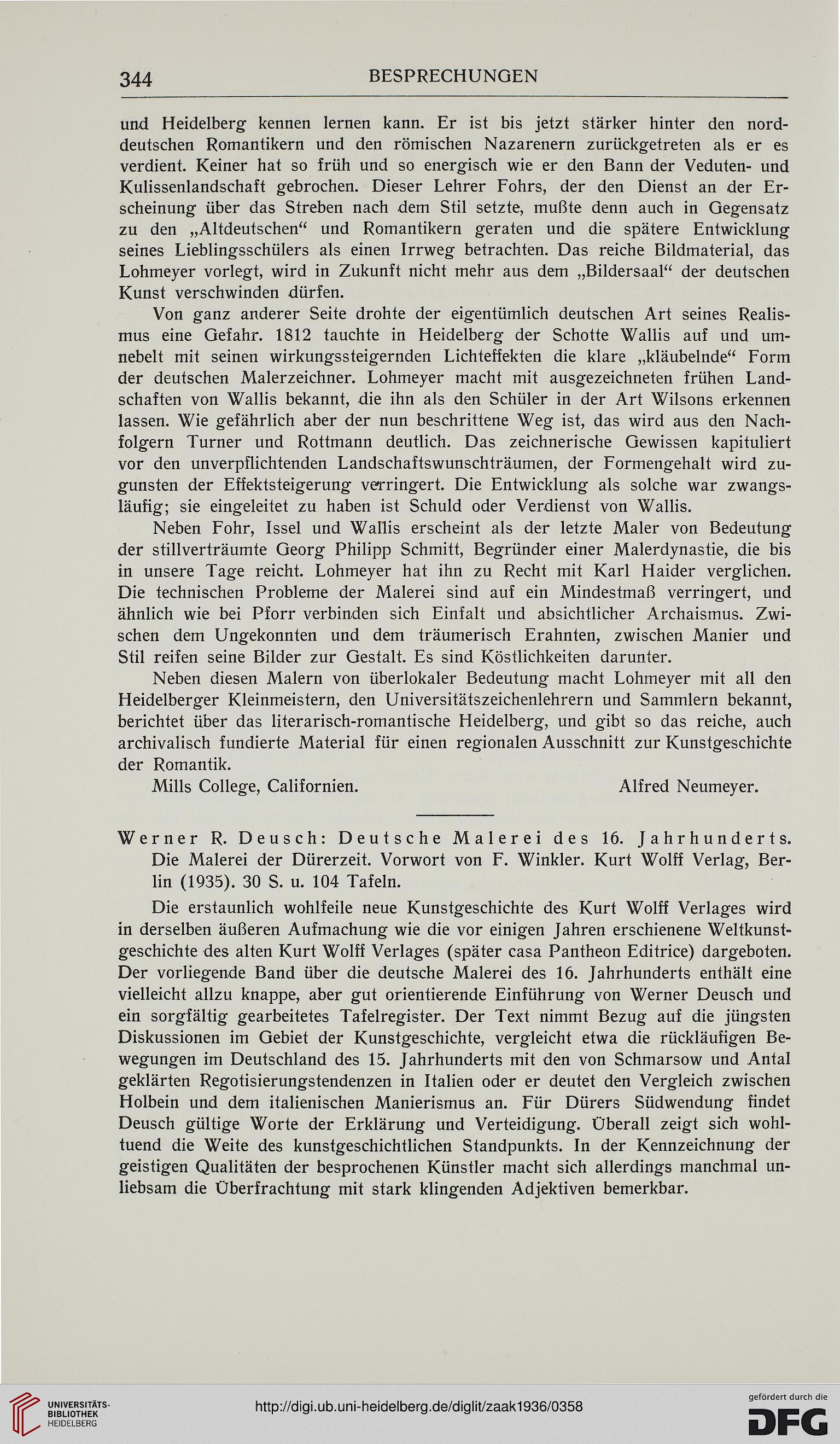344
BESPRECHUNGEN
und Heidelberg kennen lernen kann. Er ist bis jetzt stärker hinter den nord-
deutschen Romantikern und den römischen Nazarenern zurückgetreten als er es
verdient. Keiner hat so früh und so energisch wie er den Bann der Veduten- und
Kulissenlandschaft gebrochen. Dieser Lehrer Fohrs, der den Dienst an der Er-
scheinung über das Streben nach dem Stil setzte, mußte denn auch in Gegensatz
zu den „Altdeutschen" und Romantikern geraten und die spätere Entwicklung
seines Lieblingsschülers als einen Irrweg betrachten. Das reiche Bildmaterial, das
Lohmeyer vorlegt, wird in Zukunft nicht mehr aus dem „Bildersaal" der deutschen
Kunst verschwinden dürfen.
Von ganz anderer Seite drohte der eigentümlich deutschen Art seines Realis-
mus eine Gefahr. 1812 tauchte in Heidelberg der Schotte Wallis auf und um-
nebelt mit seinen wirkungssteigernden Lichteffekten die klare „kläubelnde" Form
der deutschen Malerzeichner. Lohmeyer macht mit ausgezeichneten frühen Land-
schaften von Wallis bekannt, die ihn als den Schüler in der Art Wilsons erkennen
lassen. Wie gefährlich aber der nun beschrittene Weg ist, das wird aus den Nach-
folgern Turner und Rottmann deutlich. Das zeichnerische Gewissen kapituliert
vor den unverpflichtenden Landschaftswunschträumen, der Formengehalt wird zu-
gunsten der Effektsteigerung verringert. Die Entwicklung als solche war zwangs-
läufig; sie eingeleitet zu haben ist Schuld oder Verdienst von Wallis.
Neben Fohr, Issel und Wallis erscheint als der letzte Maler von Bedeutung
der stillverträumte Georg Philipp Schmitt, Begründer einer Malerdynastie, die bis
in unsere Tage reicht. Lohmeyer hat ihn zu Recht mit Karl Haider verglichen.
Die technischen Probleme der Malerei sind auf ein Mindestmaß verringert, und
ähnlich wie bei Pforr verbinden sich Einfalt und absichtlicher Archaismus. Zwi-
schen dem Ungekonnten und dem träumerisch Erahnten, zwischen Manier und
Stil reifen seine Bilder zur Gestalt. Es sind Köstlichkeiten darunter.
Neben diesen Malern von überlokaler Bedeutung macht Lohmeyer mit all den
Heidelberger Kleinmeistern, den Universitätszeichenlehrern und Sammlern bekannt,
berichtet über das literarisch-romantische Heidelberg, und gibt so das reiche, auch
archivalisch fundierte Material für einen regionalen Ausschnitt zur Kunstgeschichte
der Romantik.
Mills College, Californien. Alfred Neumeyer.
Werner R. Deusch: Deutsche Malerei des 16. Jahrhunderts.
Die Malerei der Dürerzeit. Vorwort von F. Winkler. Kurt Wolff Verlag, Ber-
lin (1935). 30 S. u. 104 Tafeln.
Die erstaunlich wohlfeile neue Kunstgeschichte des Kurt Wolff Verlages wird
in derselben äußeren Aufmachung wie die vor einigen Jahren erschienene Weltkunst-
geschichte des alten Kurt Wolff Verlages (später casa Pantheon Editrice) dargeboten.
Der vorliegende Band über die deutsche Malerei des 16. Jahrhunderts enthält eine
vielleicht allzu knappe, aber gut orientierende Einführung von Werner Deusch und
ein sorgfältig gearbeitetes Tafelregister. Der Text nimmt Bezug auf die jüngsten
Diskussionen im Gebiet der Kunstgeschichte, vergleicht etwa die rückläufigen Be-
wegungen im Deutschland des 15. Jahrhunderts mit den von Schmarsow und Antal
geklärten Regotisierungstendenzen in Italien oder er deutet den Vergleich zwischen
Holbein und dem italienischen Manierismus an. Für Dürers Südwendung findet
Deusch gültige Worte der Erklärung und Verteidigung. Überall zeigt sich wohl-
tuend die Weite des kunstgeschichtlichen Standpunkts. In der Kennzeichnung der
geistigen Qualitäten der besprochenen Künstler macht sich allerdings manchmal un-
liebsam die Überfrachtung mit stark klingenden Adjektiven bemerkbar.
BESPRECHUNGEN
und Heidelberg kennen lernen kann. Er ist bis jetzt stärker hinter den nord-
deutschen Romantikern und den römischen Nazarenern zurückgetreten als er es
verdient. Keiner hat so früh und so energisch wie er den Bann der Veduten- und
Kulissenlandschaft gebrochen. Dieser Lehrer Fohrs, der den Dienst an der Er-
scheinung über das Streben nach dem Stil setzte, mußte denn auch in Gegensatz
zu den „Altdeutschen" und Romantikern geraten und die spätere Entwicklung
seines Lieblingsschülers als einen Irrweg betrachten. Das reiche Bildmaterial, das
Lohmeyer vorlegt, wird in Zukunft nicht mehr aus dem „Bildersaal" der deutschen
Kunst verschwinden dürfen.
Von ganz anderer Seite drohte der eigentümlich deutschen Art seines Realis-
mus eine Gefahr. 1812 tauchte in Heidelberg der Schotte Wallis auf und um-
nebelt mit seinen wirkungssteigernden Lichteffekten die klare „kläubelnde" Form
der deutschen Malerzeichner. Lohmeyer macht mit ausgezeichneten frühen Land-
schaften von Wallis bekannt, die ihn als den Schüler in der Art Wilsons erkennen
lassen. Wie gefährlich aber der nun beschrittene Weg ist, das wird aus den Nach-
folgern Turner und Rottmann deutlich. Das zeichnerische Gewissen kapituliert
vor den unverpflichtenden Landschaftswunschträumen, der Formengehalt wird zu-
gunsten der Effektsteigerung verringert. Die Entwicklung als solche war zwangs-
läufig; sie eingeleitet zu haben ist Schuld oder Verdienst von Wallis.
Neben Fohr, Issel und Wallis erscheint als der letzte Maler von Bedeutung
der stillverträumte Georg Philipp Schmitt, Begründer einer Malerdynastie, die bis
in unsere Tage reicht. Lohmeyer hat ihn zu Recht mit Karl Haider verglichen.
Die technischen Probleme der Malerei sind auf ein Mindestmaß verringert, und
ähnlich wie bei Pforr verbinden sich Einfalt und absichtlicher Archaismus. Zwi-
schen dem Ungekonnten und dem träumerisch Erahnten, zwischen Manier und
Stil reifen seine Bilder zur Gestalt. Es sind Köstlichkeiten darunter.
Neben diesen Malern von überlokaler Bedeutung macht Lohmeyer mit all den
Heidelberger Kleinmeistern, den Universitätszeichenlehrern und Sammlern bekannt,
berichtet über das literarisch-romantische Heidelberg, und gibt so das reiche, auch
archivalisch fundierte Material für einen regionalen Ausschnitt zur Kunstgeschichte
der Romantik.
Mills College, Californien. Alfred Neumeyer.
Werner R. Deusch: Deutsche Malerei des 16. Jahrhunderts.
Die Malerei der Dürerzeit. Vorwort von F. Winkler. Kurt Wolff Verlag, Ber-
lin (1935). 30 S. u. 104 Tafeln.
Die erstaunlich wohlfeile neue Kunstgeschichte des Kurt Wolff Verlages wird
in derselben äußeren Aufmachung wie die vor einigen Jahren erschienene Weltkunst-
geschichte des alten Kurt Wolff Verlages (später casa Pantheon Editrice) dargeboten.
Der vorliegende Band über die deutsche Malerei des 16. Jahrhunderts enthält eine
vielleicht allzu knappe, aber gut orientierende Einführung von Werner Deusch und
ein sorgfältig gearbeitetes Tafelregister. Der Text nimmt Bezug auf die jüngsten
Diskussionen im Gebiet der Kunstgeschichte, vergleicht etwa die rückläufigen Be-
wegungen im Deutschland des 15. Jahrhunderts mit den von Schmarsow und Antal
geklärten Regotisierungstendenzen in Italien oder er deutet den Vergleich zwischen
Holbein und dem italienischen Manierismus an. Für Dürers Südwendung findet
Deusch gültige Worte der Erklärung und Verteidigung. Überall zeigt sich wohl-
tuend die Weite des kunstgeschichtlichen Standpunkts. In der Kennzeichnung der
geistigen Qualitäten der besprochenen Künstler macht sich allerdings manchmal un-
liebsam die Überfrachtung mit stark klingenden Adjektiven bemerkbar.